5.1 Ascomycota Texte 0-Pl

Onygenales, Hornpilze i.w.S.
1 Grüblerisch
.
Wenig ist’s, was Systematikerherzen[1] erfreut:
Homogene Familien der Ordnung zu geben!
Doch DNA[2] nur bleibt dafür!
Nichts, was Familien sonst so typisch vereint.
.
Doch halt!
Eine der Sippen beschreitet besondere Wege,
Erfand vollkommen Verrücktes, noch nie Dagewesenes,
Um Sporen geballt zu vermehren,
Gemeinsam zu schützen, bis die Zeit,
Sich an Arme zu heften, gekommen.
.
Fußnoten
[1] Systematiker: Wissenschaftler, die sich mit Verwandtschaftssystemen, mit Abstammungsgemeinschaften befassen und entscheidende Merkmale dafür erschließen
[2] Sequenzanalysen: Analysen der Nucleotidreihenfolge (A, C, G, T) in der DNA
Eingestellt am 15. März 2025
.

Onygenaceae, Hornpilze i.e.S.
1 Eine besondere Nische
.
Wenn Federn und Haare den Tieren entfallen,
Mühsam und kunstvoll von ihren Trägern geformt,
Möchte wohl mancher sich sehnen,
Den kostbaren, von andern verworfenen Wert
Für sich als Moleküllieferant zu verwenden,
Wird aber bald sich gestehen:
Zwecklos, zu fest und stabil sind die Fasern gepackt.
.
Wer kann schon die hohe Ordnung
Die paarweise eng aneinandergeschmiegt,
Je zu zweit zu einzelnen Fasern wieder sich legen,
Um erneut, zu dickeren Bündeln vereint,
Zähe, oft starre Komplexe wie Taue zu bilden?[3]
.
Cysteine[4] geben dem ganzen vernetzenden Halt
Mit Disulfidbrücken[5] von Helix zu Helix,
Von +Fibrillen zur Faser, weiter zum Strang.
Proteasen[6] ein Gräuel, falls nicht besonders getrimmt,
Und doch gelingt es ausgepufft Raffinierten
Sich zu bedienen daran.
.
Onygena[7] und ihre Verwandten, wie sie alle noch heißen,
Leben ausgezeichnet von dem haarig-hornigen[8] Zeug;
Zehren allein von verborgenen Dingen,
Die in Horn und Haaren liegen vertäut.
.
Mögen viele im Boden sich bergen,
Fruchtkörper unaufwendig nur formen als
Kleine, runde Gebilde zwischen Haaren, Federn und Streu,
Oygena selbst aber strebt mit Stiel und Köpfchen empor.
.
Doch eines haben sie alle gemein:
Arthrokonidien[9], in Reihe mit Abstand geboren,
Lassen benachbarter Zellen Septen[10] zerreißen, sich zu befreien,
Gehen in trockenen Massen davon;
Suchen, wenige aber werden auch fündig,
Verstreute Haare, Federn und Horn.
.
Fußnoten
[1] Aminosäuren: Organische Säuren mit einer Amino-[–NH2] Seitengruppe. Biologisch bedeutend sind hauptsächlich jene Aminosäuren, die an dem der Säuregruppe benachbarten Kohlenstoffatom diese Gruppe besitzen
[2] Helix: Spirale
[3] Keratin: Sammelbegriff für verschiedene wasserunlösliche Faserproteine, die von Tieren gebildet werden und Hornsubstanz charakterisieren; entsprechend ihrer molekularen Konformation, als α-Helix oder β-Faltblatt unterscheidet man α- und β-Keratin; zu Büdeln treten in hierarchischer Ordnung mehrere Fibrillen zu Fasern zusammen und sind umso steifer, je stärker ihre Komponenten durch Disulfidbrücken der Aminosäure Cystein quervernetzt sind
[4] Cystein: Schwefelhaltige Aminosäure
[5] Disulfidbrücke: [–S–S–]
[6] Proteasen: Proteine oder Peptide abbauende Enzyme, dabei lösen sie durch Hydrolyse die Bindungen zwischen ihren Aminosäuren
[7] Onygena spp.: Hornpilze (Onygenaceae – Onygenales – Eurotiomycetidae – Eurotiomycetes – Bitunicate Ascomycota -…)
[8] Horn: Substanz, die aus abgestorbenen, mit Keratin gefüllten Zellen besteht
[9] Arthrokonidien: Gliederkonidien; thallische Bildungsweise; hintereinanderliegende Hyphenzellen können dabei in je eine dickwandige Gliederkonidie zerfallen, oder jede zweite Zelle nur wird zur Konidie, wobei die zwischenliegende Zelle kollabiert und dem Separieren der Arthrokonidien dient.
[10] Septum (Algen, Pilze): Querwand eines einzellreihigen Fadens, eines Trichoms, eines Zellausläufers, einer Hyphe
Eingestellt am 15. März 2025
.
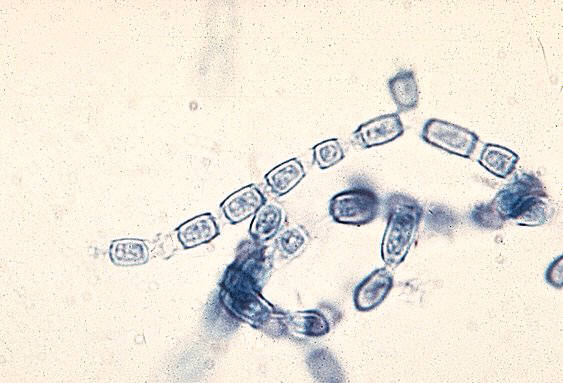
Arthrokonidien von Coccidioides immitis, Onygenaceae
Hier bildet jede zweite Zelle intern eine Konidie (enterothallisch); Zellen dazwischen kollabieren, helfen den Arthrokonidien sich zu separieren.
Autor: Dr. Hardin
Lizenz: Gemeinfrei; unverändert
Eingestellt am 15. März 2025
.

Onygenaceae, Hornpilze i.e.S.
2 Was die einen gekotzt, kommt den anderen recht
.
Irgendwo landen sie
– Vergeblich der meisten Bemüh‘n –
Federn und Haare in naher Umgebung zu finden,
Bevor Reserven für immer dahin;
Doch der Sporen Menge sichert ihnen Erfolg.
.
Auf einen Ballen schleimverbundener Federn treffen sie,
Gelangten irgendwie genau dorthin;
Lassen die Speise sich, wie serviert kommt ihnen sie vor,
Bestimmt nicht entgeh‘n,
Treiben ihre Vorhut hinaus und hinein und schließen:
Hier hast du Nahrung, hier bist du zuhaus.
.
Durchzieh‘n – die Mühe hat sich gelohnt, die Strahlen[3], zu lösen –
Dicht mit Fäden[4] das ganze Gezaus,
Finden, mit Feuchte frisch noch durchtränkt
Für Stickstoff und Schwefel, den sie nicht brauchen
– Kein Wunder weil Onygena nur mit Keratin[5] sich ernährt –
Genügend Raum, ihn elegant zu entsorgen.
.
Feine Flocken formen sie nahe der Grenze des Balls[6]
Dem Licht entgegen; noch fühlen die Richtung sie nur,
Doch schon durchdringen Knäuel die weich gewordenen Federn,
Strecken ein Stielchen mit Köpfchen zur Helle empor[7].
.
Noch liegen sie wirr, die Hyphen, darin,
Bald aber drängen Ascogone[8] die Fäden zur Seite,
Treiben, nachdem sie männliche Kerne empfangen,
Mächtige Hyphen, Asci[9] zu bilden, hervor. –
.
Als sie von ihren Ururahnen sich trennten,
Um alles, was viel zu kompliziert,
Beiseitezuschieben, für ein unaufwendigeres Leben. –
.
Acht Sporen – wie sich‘s für Pezizomycotina[12] gehört –
Ellipsoid, glatt, fast farblos, bilden sie in
Staubig zerfallenden Asci[13];
Pulvrig füllen sie damit das trockene Köpfchen;
Dazwischen lagern sich einstmaliger Hyphen Fäden[14],
Lockern die staubige Masse,
Dem Wind, nachdem die schützende Hülle zerbröselt, die
Sporen in kleinen Portionen zu geben.
.
Auch Onygena fand Risikostreuen[15] von Vorteil für sich!
Was nützte, alles auf eine Karte zu setzen,
Alle Sporen auf einmal zu streuen,
Wäre der Eulen Gewürge zu selten, nicht genügend frisch? –
.
So wartet Onygena corvina[16] auf ein gekotztes Gewölle,
Nimmt mit Unverdautem vorlieb.
Equina[17] hingegen, lebt viel trockner und härter,
Hufe, Klauen und Hörner nimmt sie für sich!
So mancher mag dabei denken:
Die hat bestimmt einen Hieb!
Doch, wer buhlt schon um diesen Abfall,
Kaum jemand streitet ernstlich darum:
Wer eine Nische[18] alleine besetzt –
Gewinnt!
.
Fußnoten
[1] Sporenwand
[2] Keimhyphae: Hyphe, mit der eine Spore oder Konidie keimt
[3] Federstrahlen: Des Federschaftes Verzweigung zweiter Ordnung
[4] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände
[5] Keratin: Sammelbegriff für verschiedene wasserunlösliche Faserproteine, die von Tieren gebildet werden und Hornsubstanz charakterisieren; entsprechend ihrer molekularen Konformation, als α-Helix oder β-Faltblatt unterscheidet man α- und β-Keratin; zu Büdeln treten in hierarchischer Ordnung mehrere Fibrillen zu Fasern zusammen und sind umso steifer, je stärker ihre Komponenten durch Disulfidbrücken der Aminosäure Cystein quervernetzt sind
[6] Gewölle: Besonders von Eulen und Greifvögeln herausgewürgter Klumpen unverdaulicher Nahrungsreste, wie Haare, Federn, Knochen
[7] Fruchtkörper: Komplexe Hyphengeflechte, die Überdauerungsorgane oder Sporangien enthalten oder diese oberflächlich tragen
[8] Ascogon: Ein meist bauchiges, vielkerniges weibliches Gametangium, das mit einem Fortsatz dem männlichen Gametangium es erleichtert, es zu umschlingen, um an einer Stelle die trennenden Zellwände für Plasmogamie aufzulösen.
[9] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota
[10] Ascoloculär: Entwicklung eines Pseudotheciums, wobei die einzelnen, hymenienbildenden Höhlungen als Loculi bezeichnet werden. Der Gegensatz dazu ascohymenial, bei dem von Anfang an nur ein Hymenium angelegt wird.
[11] Bitunicat: Die Auswand besteht aus zwei sich funktionell unterscheidenden Schichten, aus Exo- und Endoascus
[12] Pezizomycotina: Becherlingsartige i. w. S. (Ascomycota – Dikaryota – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Oisthokonta –…)
[13] Prototunicat: Ascuswand ohne vorgebildete Öffnungsstelle; die Wand löst sich auf oder zerfällt
[14] Capillitium (Fungi): Zu dickwandigen Fasern umgewandelte Hyphen, die der Auflockerung der Sporenmasse dienen und zugleich sie dem Verbreitungsvektor Wind anbieten
[15] Risikominimieren, Risikostreuen: Ein entscheidendes Prinzip der Evolution. Um Verluste an möglichen Nachkommen möglichst zu reduzieren, haben sich erfolgversprechende Strategien entwickelt; z. B. Risikostreuen, was bedeutet, nicht alles auf eine Karte zu setzen, nicht alle Sporen, Samen oder Früchte, auf einmal reifen zu lassen und in einem Schub zu verbreiten. Zeitliche Streuung z. B. erhöht die Wahrscheinlichkeit, günstige Zeiten für die Verbreitung durch Vektoren zu treffen, oder Perioden für günstiges Wachstum oder fürs Überleben, etc. Freilich wird dabei während eines Zeitpunktes die Menge der Verbreitungseinheiten geringer, doch am Ende wird sich diese Strategie evolutiv für den Organismus lohnen. Wenn aber Organismen fürs Wachstum auf zeitlich beschränktes Vorkommen günstiger Bedingungen angewiesen sind, wird eine explosionsartige Vermehrung die günstigste Lösung sein; in diesem Zusammenhang sind dann schnell reagierende Nebenfruchtformen mit ihren asexuell entstandenen Verbreitungseinheiten von Vorteil, z. B. dann, wenn ein Substrat (Stärke, Zucker, Partner eines Symbionten, Wirt eines Parasiten) stark umworben ist oder nur kurzzeitig zur Verfügung steht.
[16] Onygena corvina: Gewöll-Hornpilz (Onygenaceae – Onygenales – Eurotiomycetidae – Eurotiomycetes – Bitunicate Ascomycota -…)
[17] Onygena equina: Hörner- und Hufpilz (Onygenaceae – Onygenales – Eurotiomycetidae – Eurotiomycetes – Bitunicate Ascomycota -…)
[18] Ökologische Nischen: Meist kleine Gebiete, Habitate, mit relativ einheitlichen Lebensbedingungen
Eingestellt am 15. März 2025
.
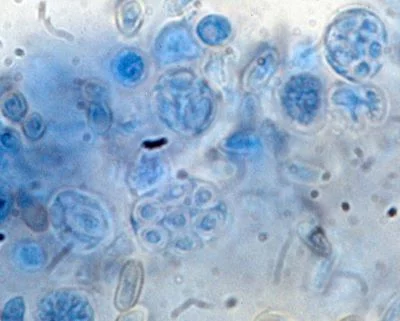
Onygena corvina Asci und Sporen (Original; Reinhard Agerer)
Rundliche Asci in unterschiedlichen Entwicklungsstadien; reife Asci mit acht dickwandigen Sporen.
Eingestellt am 15. März 2025
.

Onygena-Arten
Oben: Onygena corvina auf Gewölle
Autor: Volker Fäßler
Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert
Unten: Onygena equina auf Horn eines Schafs
Autor: Ben Mitchell Wildeep
Lizenz: Public domain; unverändert
Eingestellt am 15. März 2025
.

Penicillium, Pinselschimmel
1 Demarkation
.
In einen viertel Liter Wasser
Mit je einem Esslöffel Vitaminsaft und Zucker versetzt,
Mit geschlossenem Deckel zwei Minuten gekocht,
In fünf Plastikbehälter
– So, wie Delikatessenverkäufer sie nehmen –
Heiß noch verteilt,
Locker, bis Kondenstropfen allmählich verschwinden,
Mit Deckel belegt,
Geben Nährböden für einen aufschlussreichen Versuch:
.
Bring sie, bis auf einen[3], sobald sie erkaltet,
Mit offenem Deckel für ein paar Stunden
In einen Kühlschrank, ans Fenster, unter dein Bett,
Auf deinen Schreibtisch, wo du genascht und Limo
verkleckert,
An Hasen- oder Meerschweinchenkäfig, ans Katzenklo,
Verschließ sie und stell sie ins Dunkel für einige Tage und warm.
.
Blickst du durch ihren Deckel nach ein bis zwei Wochen
– Öffne ja die Brutkammern nicht! –
Entdeckst du Mosaike aus Farben und Formen:
Weiß, graubraun, rötlich, schwärzlich und grün,
Glatt oder flaumig, stumpf oder glänzend,
Rund, dort wo einander sie trafen, oft abgeflacht, gar polygonal.
.
Freche überwuchern des Nachbarn Revier,
Andere breiten zur Rundung unbehindert sich aus,
Drängen, wie‘s so scheint, den Nachbarn zum Halb- oder Sichelmond,
Setzen auch klare Linien zwischen sich und ihm!
.
Bakterien, meist jedoch Pilze, wuchsen, mit je einer Konidie beginnend,
Zu diesen Kolonien[4] heran,
Mussten den Platz in der Schale sich teilen,
Stießen an Nachbarn, bildeten Grenzen, trennten andere von ihrem Glück
Mit antimikrobiellen Substanzen[5], die zur Vorsicht in die Umgebung sie gaben,
Um ihr Gebiet zu verteidigen; an der wandernden Peripherie.
.
Fußnoten
[1] Gelatine: Aus tierischen Knochen und Häuten stammende, bei Erkalten gelatinierende, sich verfestigende Substanz
[2] Agartine: Aus Algen stammende, bei Erkalten gelatinierende, sich verfestigende Substanz
[3] Der als Kontrolle verwendet wird, um zu sehen, ob nicht doch schon bei der Herstellung Pilzpropagulen das Medium kolonisierten (offener Deckel!)
[4] „Kolonie“: Ein auf künstlichen Nährmedien sich ausbreitendes Mycel wird meist als Kolonie bezeichnet, obwohl dies keine Kolonie im eigentlichen Sinne ist, die definitionsgemäß aus vielen Einzelindividuen besteht
[5] Antibiotikum: Ein natürlich gebildetes, oft chemisch modifiziertes, niedermolekulares Stoffwechselprodukt von Pilzen, Bakterien oder Schwämmen, das schon in geringer Konzentration das Wachstum anderer Mikroorganismen hemmt oder diese gar tötet
Eingestellt am 15. März 2025
.
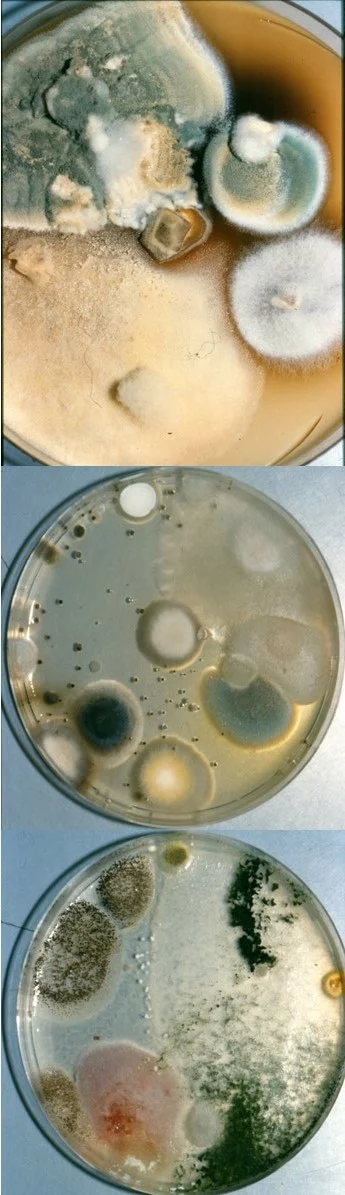
Fängerplatten um Pilzverbreitungseinheiten (Konidien, Sporen) nachzuweisen (Originale; Reinhard Agerer)
Sogenannte Petrischalen, mit Nähragar gefüllt, wurden einige Zeit offen an verschiedenen Stellen stehengelassen, Pilzsporen/-konidien die Möglichkeit zu geben, sich darauf niederzulassen. Nach auflegen des Deckels und einigen Tagen Bebrüten bei Raumtemperatur ließen sich auf diese Weise in der Luft befindliche Pilzverbreitungseinheiten nachweisen. Koloniegrößen, -form, -farben- und Oberflächen weisen auf unterschiedliche Pilzarten hin.
Im oberen Bild zeigen sich Trennungslinien zwischen einigen Kolonien, so zum Beispiel zwischen dem gelblichen und dem weißen Mycel; eine Hemmung ohne freie Zone zwischen dem gelben und dem grünen (Penicillium)-Mycel. Auch zwischen zwei Penicillium-Kolonien (grün) scheint eine Hemmung mit freier Zone vorzuliegen. Ein weißes Mycel in der kleinen, runden und grünen Penicillium-Kolonie, hat ebenso um sich eine hyaline Zone, was auf Hemmung von Penicillium hinweist. Pilzfreie Zonen deuten auf abgegebene, hemmende, vielleicht sogar tötende Substanzen hin.
In den darunter liegenden Petrischalen lassen sich ebenfalls unterschiedliche Farben, Formen, Oberflächen, Wachstumsgeschwindigkeiten und Verhalten gegeneinander erkennen.
Unterste Schale, rechts oben: Ein Penicillium-Mycel (dunkelgrüne Front) überwächst hemmungslos ein weißes Mycel.
Eingestellt am 15. März 2025
.

Penicillium, Pinselschimmel
2 Rettung
.
Wie oft schon forderten Schicksale Opfer und Tote,
Weil bahnbrechendes Wissen im Schreibtisch verstaubte,
Interesse der Science Community[1] grundsätzlich fehlte,
Oder Revolutionäres zum Nachteil schlichtweg verkannte,
Fehlendes Geld intensiveres Arbeiten stoppte?
.
Und doch spielt der Zufall eine nicht zu unterschätzende Rolle,
Wenn plötzlich und vollkommen ohne Signal
Die Tür in die Zukunft sich meilenweit öffnet,
Eine Erkenntnis der Menschheit Leben und Zuversicht prägt.
.
In den Zwanzigern des letzten Jahrhunderts zog Dr. Fleming[2]
Ließ sie, in die Ferien wollte er ziehen,
Einige Wochen unbetreut liegen;
Sah bei der Rückkehr – welche Enttäuschung! –
Eines Schimmels Wirken in der bewahrten Kultur.
.
Mit einem zweiten, dann prüfenden Blick erkannte er schnell
Wie den grünlichen Schimmel[5], rund war sein Rand,
In vollem Umkreis Bakterien[6] mieden,
An Stellen fehlten, die er, so war er sich sicher,
In gleicher Weise mit der Drigalskispatel[7] verteilt
Und die ganze Fläche des Agars beimpfte.
.
Keine Hyphen[8] durchzogen der Staphylococcen Revier,
Trotzdem verschwanden sie, oder sie teilten sich nicht;
So kam er klug zu seinem Befund:
Einen löslichen Stoff sezernierte der Schimmel in das Substrat.
.
So zog er den Pilz, als Penicillium[9] entlarvte den Schimmel das Lichtmikroskop,
In größeren Mengen steril als neues Studienobjekt,
Schob dafür einstweilen Bakterien zur Seite[10].
Isolierte tatsächlich aus der Kultur einen Stoff,
Den er Penicillin[11] zur Ehre des Pilze benannte und
Testete alle Bakterienstämme, in seiner Sammlung verwahrt,
Gegen Penicillin und stellte voll Verwunderung fest, nur Gram-Positive[12], wie
Gegen tierische Zellen und Zellen des menschlichen Bluts
Wirkte es, wie gegen Gram-Negative Bakterien, nicht.
.
Eine Dekade ging der Menschheit verloren,
Denn Ende der Dreißiger Jahre erst griffen
– Obwohl in Fachjournalen gut publiziert –
Amerikaner Flemmings Ergebnisse auf und screenten,
– So dafür heute das richtige Wort –
Hunderte Stämme der Allerweltsschimmel und fanden
– Das Glück liegt oftmals so unglaublich nah –
Einen hochergiebigen Stamm in Penicillium chrysógenum[15],
An einer faulen Melone[16] gleich vor der Tür.
Ein Narr wäre, wer nun daran nicht forschte!
.
Der Zweite Weltkrieg mit Millionen Verletzten,
Auch von Mikroben[17] tödlich bedrohte Soldaten,
Brachte die Forschung an Penicillinen erheblich voran,
.
Großproduktion des besten der vier erforschten Penicilline, Penicillin G[20],
Und Injektionsapparate für Applikation
Erhielten Millionen Menschen das Leben,
Gaben noch Hoffnung, wo der Tod bereits nah. –
.
Heute wär für viele kein Leben mehr denkbar,
Ohne der Antibiotika[21] lebenserhaltende Wirkung!
Forscher veränderten, optimierten Penicilline,
Entdeckten noch viele antimikrobielle Substanzen,
Auch gegen Bakterien Gram-Negativen Verhaltens,
Fanden gegen alle – fast alle – bakterienhemmende Mittel.
.
Sorglosigkeit kehrte bei Arzt und Patienten bald ein,
Verschrieben, verspeisten Antibiotika ohne Bedenken;
Dachten nicht an der Bakterien Flexibilität über Generationen hinweg,
Bis Vertrauen und Hoffnung auf einmal zerstoben.
.
Fütterten Tiere mit diversen Antibiotika prospektiv,
Glaubten gesund sie so zu erhalten, ihr Wachstum zu fördern,
Doch Vieles schieden die Tiere, so wie gefressen, glatt wieder aus,
Gaben Bakterien Anlass zur Evolution,
Bis gegen einige Stämme Antibiotika nicht mehr wirkten:
So ist an ihnen die Forschung, wo Dr. Fleming am Anfang schon stand.
.
Fußnoten
[1] Science Community: Gesamtheit der am internationalen Wissenschaftsbetrieb teilnehmenden Wissenschaftler (der betreffenden Disziplin)
[2] Fleming, Alexander (1881–1945): Mediziner und Bakteriologe, Entdecker des Penicillins; Nobelpreis für Physiologie oder Medizin 1945
[3] Staphylococcen: Staphylococcus (Firmicutes – Grampositive – Bacteria)
[4] Nähragar, Nährboden: Aus Agar gewonnene, sich verfestigende Substanz, versetzt mit speziellen, für bestimmte Organismen zum Wachstum nötigen Nährstoffen
[5] Schimmel (Pilze): Nebenfruchtformen von Pilzen, ein weißlicher, grauer, grünlicher, bräunlicher oder schwärzlicher Belag, der auf feuchten Substraten entsteht
[6] Bakterien: Bilden zusammen mit Archäen die sog. Prokaryo(n)ten, die noch keinen echten Zellkern und keine komplex gebauten Chromosomen besitzen. Sie unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Deshalb wurden die Archäen in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts als eigene Organismen-Domäne der Domäne der Bakterien gegenübergestellt
[7] Drigalskispatel: Ein Zum Triangel gebogener Glasstab mit Glasgriff, mit dessen dem Nährboden aufliegenden Seite eine Bakteriensuspension gleichmäßig verteilt wird
[8] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände
[9] Penicillium: Pinselschimmel (Aspergillaceae – Eurotiales – Eurotiomycetidae – Eurotiales – Bitunicate Ascomycota -…)
[10] Ließ sie für seine weitere Forschung links liegen
[11] Penicilline: Stoffgruppe aus Penicillium; entstehen biologisch aus α-Aminoadipinsäure, Cystein und Valin
[12] Gram-Färbung: Eine Methode, Bakterien anzufärben, die der dänische Arzt Hans Christian Gram entwickelt hatte, um Bakterien nach Farbreaktionen einzuteilen; dabei werden die Bakterien zunächst mit Kristallviolett und Jod angefärbt und anschließend mit Ethanol ausgewaschen und nochmals mit Safranin oder Fuchsin gefärbt; gram-positive Bakterien sind danach purpurn gefärbt, Gram-negative pinkfarben.
[13] Streptokokken: Streptococcus (Streptococcaceae – Lactobacillales – Firmicutes – Grampositive – Bacteria); kugelförmige Bakterien
[14] Pneumokokken: Streptococcus pneumoniae (Streptococcaceae – Lactobacillales – Firmicutes – Grampositive – Bacteria); kugelförmige Bakterien
[15] Penicillium chrysógenum: Gelbgrüner Pinselschimmel (Aspergillaceae – Eurotiales – Eurotiomycetidae – Eurotiales – Bitunicate Ascomycota -…)
[16] Melonen: In subtropischen Gebieten kultivierte Kürbisgewächse mit großen, saftreichen Früchten
[17] Mikroben: Mikroskopisch kleine Lebewesen, die einzeln nicht mit bloßem Auge erkennbar sind, zum Beispiel Bakterien und Archäen. Die meisten dieser Mikroorganismen sind Einzeller, zu ihnen zählen jedoch auch wenigzellige Lebewesen (einige Pilze und Algen, viele Amoebozoa, Chromalveolata, Rhizaria und Excavata) entsprechender Größe
[18] Ratten: Rattus (Murinae – Muridae – Muroidea – Myomorpha – Rodentia –…)
[19] Moderner Mensch: Homo sapiens (Homo spp. – Hominini – Homininae – Hominidae – Hominoidea –…)
[20] Penicillin G: Einziges therapeutisch wichtiges Penicillin
[21] Antibiotikum: Ein natürlich gebildetes, oft chemisch modifiziertes, niedermolekulares Stoffwechselprodukt von Pilzen, Bakterien oder Schwämmen, das schon in geringer Konzentration das Wachstum anderer Mikroorganismen hemmt oder diese gar tötet
Eingestellt am 15. März 2025
.
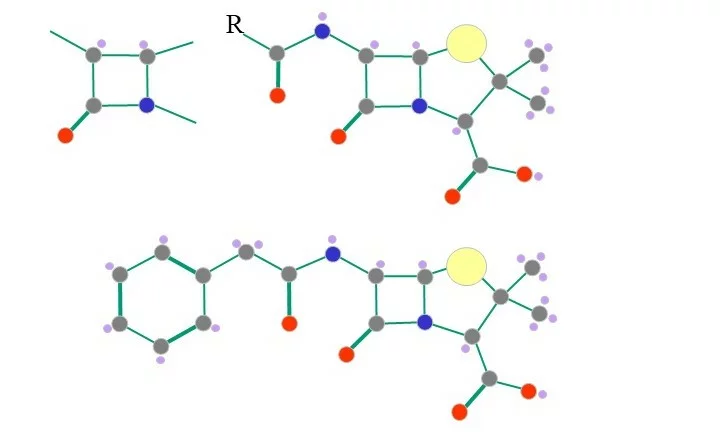
Penicilline (ppt-generiert; Reinhard Agerer)
Oben rechts: Grundbau der Penicilline; je nach Gestaltung des Restes R, liegen unterschiedliche Penicillin-Moleküle vor.
Oben links: Typisch für Penicilline ist der sog. β-Lactam-Ring (ganz links)
Unten: Penicillin G, das einzige therapeutisch bedeutende Penicillin
Kohlenstoff: grau. – Sauerstoff: rot. – Stickstoff: blau. – Schwefel: gelb. - Wasserstoff violett. Einfachbindungen: feiner grüner Strich; Doppelbindungen: breiter grüner Strich. - R: Verschiedene Seitengruppen möglich
Eingestellt am 15. März 2025
.

Penicillium, Pinselschimmel
3 Der Evolution in die Werkstatt geschaut
.
Penicillin[1] in der richtigen Menge Patienten gegeben,
Greift nur Bakterien[2], die gerade sich teilen, ungehemmt an;
Wartet bis neu sich Zellwände bilden,
Ruhende, bescheiden sich gebende, interessieren es nicht.
.
Wird Murein der Sacculi[3] zusammengebaut,
Zur Einhausung stabil vernetzt,
Drängt sich Penicillin, so, wie‘s ihr Sinn,
Lässt die Transporte nicht an ihr Ziel:
Was reißfest geplant, bleibt instabil.
.
Nimmt die Zelle, weil bestens ernährt,
An Volumen, den Sacculus dehnend, wie geplant zu,
Hält die Hülle dem inneren Druck nicht mehr stand,
Zerplatzt, lässt die Zelle schutzlos und nackt:
Ihr Tod ist damit bestimmt,
Der Bakterien Vermehrung gestoppt.
.
Doch nichts ist sicher auf dieser Erde,
Auch wenn Antibiotika wirken zielgenau!
.
Wird Penicillin zu lange, zu oft Patienten gegeben,
Wissen manche Bakterien geschickt sich zu helfen;
Binden Penicillin an eines der eignen Enzyme,
Nehmen ihm einen entscheidenden Teil[6],
Verknüpfen die Fäden des Sacculus
Auf neue Weise wieder stabil.
.
Resistent[7] gegen Penicillin sind diese geworden,
Würden bestimmt mit der Zeit auch wieder verschwinden,
Blieben Nichtmutierte unbekämpft noch am Leben.
Mutierten allein gehört nun die Nahrung, die sie umspült;
Vermehren sich munter,
Denn Penicillin lässt sie für immer in Ruh! –
.
Sehr unwahrscheinlich mag dem Betrachter der Vorgang erscheinen,
Annehmen, Mutationen[8], um Penicilline an eigne Enzyme zu binden, seien sicher zu selten, um
Damit Resistenz einer ganzen Population zu begründen.
Doch müssen auch Skeptiker akzeptieren:
Das integrierte Lactam, von Penicillin rührt es her,
Hat der Bakterien Hülle, um weiterzuleben, stabilisiert.
.
Zum andern ist der Bakterien Teilungsrate mitzubedenken:
Bei guter Ernährung – wo könnte sie besser noch sein
Als im warmen, nährstoffdurchspülten Körper des Menschen? –
Genügen einer einzigen Zelle genau zwölf Stunden,
Um von sich zehn hoch sieben[9] Nachkommen zu bilden.
So setzen sich Mutationen, seien sie noch so selten,
Binnen kürzester Zeit gegenüber nichtmutierten Bakterien durch!
Und wie viele Populationen werden von Penicillinen
Immer wieder und lang überschwemmt?!
.
Durch Mutation und Anpassung[10] danach
Retten sich Bakterien über die Zeit.
Ein kleines, treffendes Zeichen der Evolution!
Nicht nur lokal kommt es vor, sondern weltweit gestreut.
.
Fußnoten
[1] Penicillin G: Einziges therapeutisch wichtiges Penicillin
[2] Bakterien: Bilden zusammen mit Archäen die sog. Prokaryo(n)ten, die noch keinen echten Zellkern und keine komplex gebauten Chromosomen besitzen. Sie unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Deshalb wurden die Archäen in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts als eigene Organismen-Domäne der Domäne der Bakterien gegenübergestellt
[3] Mureinsacculus: Der Bakterien Murein umgibt die Zelle sackähnlich wegen der Zellwand widerstandsfähigen, massiven Konstruktion
[4] Alanin: Aminosäure, [H3C–CH(NH2)–COOH]
[5] Transpeptidase: Bei der D-Alanin-Transpeptidase handelt es sich um ein Enzym, das nur in Bakterien vorkommt. Es katalysiert die Quervernetzung der Murein-Polysaccharidketten über ihre Peptid-Seitenstränge. Dabei wird der D-Alanyl-Rest eines Peptid-Seitenstrangs mit der Aminogruppe eines anderen Peptid-Seitenstrangs verbunden.
[6] Nehmen dem Penicillin den Lactam-Ring
[7] Resistenz, resistent: Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen, wie Witterungsbedingungen, Parasiten, Bekämpfungsmittel
[8] Mutation: Spontan auftretende, dauerhafte Veränderung des Erbguts
[9] Zehn hoch sieben: 107 = 10 000 000 (zehn Millionen)
[10] Adaptive Radiation (Ausbreitung mit/durch Anpassung): Ein Prozess, bei dem sich Organismen von einer ursprünglichen Art schnell zu einer Vielzahl neuer Formen entwickeln, insbesondere wenn Veränderungen der Umwelt neue Ressourcen verfügbar machen, biotische Interaktionen sich verändern oder sich neue ökologische Nischen öffnen. Ausgehend von einem einzigen Vorfahren führt dieser Prozess zur Artbildung und phänotypischen Anpassung einer Reihe von Arten mit unterschiedlichen morphologischen und physiologischen Merkmalen. Ein bekannteres Beispiel ist die Adaptive Radiation bei Darwinfinken. Die Gattung Argyranthemum auf Teneriffa hat sich, so wird angenommen, stark diversifiziert durch Einnischung in unterschiedlichste klimatische, höhenlagenabhängige Vegetationszonen.
Eingestellt am 15. März 2025
.

Penicillium, Pinselschimmel
4 "Ist ja nur Mikroevolution"
.
„Schön und gut – besser: scheußlich und schlecht –
Ist der Bakterien[1] Bestreben sich gegen Angriff zu wehren,
In dem sie dem Schimmel[2] die Waffen nehmen,
Schärfen, nutzen und integrieren!
.
Dies als Evolution zu bezeichnen
Scheint mir doch recht verwegen!
Was ist das schon im Vergleich, was weltweit als Evolution,
Falls es sie überhaupt gibt, ist akzeptiert:
Von gleichen Ahnen den Ursprung genommen!“ –
.
„Bedenke, Bakterien fanden vielfache Wege bereits,
Antibiotikagriffen[5] sich zu entziehen:
Zudem noch, was Penicillin[6] schon erfuhr,
Produzieren Bakterien Blockierproteine, um,
Wie Abfangraketen fremde Geschosse zu neutralisieren,
Modifizieren der Antibiotika Zielproteine, um sie dem Gift zu entziehen,
Ersetzen auch Zielmoleküle durch analoge Substanzen,
Dichten Zellwände gegen diverse Substanzen,
Pumpen, was eingedrungen, erfolgreich wieder nach außen,
Gleichen durch Mehrproduktion Verlust an Enzymen[7] doch wieder aus,
Oder verbergen sich unter gemeinsamer schützender Schicht!
So bringen Strategiearsenale Bakterien voran!
.
Je breiter gestreut Antibiotika werden verwendet,
Je größer die Menge beim Kampf mit Erregern,
Gar als vorbeugende Gabe in der Nutztiere Mast,
So häufiger zeigt sich bakterielle Widerstandsmacht!
.
Promisk[8], wie Bakterien sich meistens verhalten,
Tauschen sie munter DNA-Stückchen[9] aus,
Verbreiten, was ihnen Vorteile brachte,
Ohne Lohn in die Nachbarschaft.
.
Zwischen engen Verwandten geschieht dies zwar leichter
– Mit gutem Erfolg –
Doch auch ferne Verwandte, ähnliche Nischen[10] besiedelnd,
Profitieren nicht selten davon.
.
Öffnen ein wenig, einen Spalt nur, die Tür zur Evolution;
Sie zeigt ihr Wirken auf das Genom,
Fördert, falls die Umwelt dies fordert,
Nur ein Glied aus Milliarden Gliedern der Population,
Überlässt sie dem Schicksal für einige Zeit.
.
Belegen, wie schnell die Welt der Mikroben[13] sich ändert:
Siebzig Jahre – evolutiv betrachtet eine verschwindende Zeit –
Brachten Bakterien mit Resistenz gegen fünfzehn Antibiotika in diese Welt.
Kein Medikament, sie zu bekämpfen, ist heute zur Hand.“ –
.
„Was bedeuten schon diese winzigen Schritte,
Was ist schon diese Mikroevolution[14],
Wo schon Otto Normalverbraucher[17] große Unterschiede, Diversität erkennt?“ –
.
„Freilich, von außen betrachtet, gleichen sich
Original und Mutanten wirklich aufs Haar
Im Mikroskop, nur aber dort, wo sie
Zwischen zwei Strichen als winzige Körper zu seh’n.
.
Als Objekt der Evolution[18]
Wirken sie dennoch auch als Subjekt[19]:
Reduzieren, wenn nicht rechtzeitig bekämpft,
Der Menschen und Tiere Population[20].
.
Wenn weiter massiv, fast ohne Beschränkung,
Antibiotika Tieren zum besseren Wachstum werden gegeben,
Werden noch stärker sich Resistenzen verbreiten
Und kein Antibiotikum Menschen mehr retten.
.
Dann werden, wie vor Hunderten Jahren schon,
Bakterien Menschen befallen, selektionieren anhand des Genoms,
Nur jenen ihr Leben belassen,
Die der Krankheitserreger vehement sich erwehren.
So werden Bakterien wieder, was früher sie waren:
Subjekt der Evolution und nicht nur Objekt davon,
Wie der Mensch lange so dachte.
Sie drehen den Spieß einfach um!“ –
.
„Und dennoch bleibt meine Frage bestehen:
Was hat dies alles mit Makroevolution[21] denn zu tun?“ –
.
„Die Zeit ist entscheidend,
So wie der Generationen Dauer und Zahl.
Vielleicht brachte durch Bakterien bewirkter Gentransfer[22]
Die Evolution erst so richtig in Schwung!
.
Und gäb‘ es genügend Zeit noch bis hin zum Ende der Welt,
Würde dann die Menschheit noch so besteh‘n, wie sie heute sich sieht?
Doch so weit wird es nicht kommen!
Zuvor wird die Welt zum Licht hin mutiert.[23]“
.
Fußnoten
[1] Bakterien: Bilden zusammen mit Archäen die sog. Prokaryo(n)ten, die noch keinen echten Zellkern und keine komplex gebauten Chromosomen besitzen. Sie unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Deshalb wurden die Archäen in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts als eigene Organismen-Domäne der Domäne der Bakterien gegenübergestellt
[2] Schimmel (Pilze): Nebenfruchtformen von Pilzen; ein weißlicher, grauer, grünlicher, bräunlicher oder schwärzlicher Belag, der auf feuchten Substraten entsteht
[3] Moderner Mensch: Homo sapiens (Homo spp. – Hominini – Homininae – Hominidae – Hominoidea –…)
[4] Affen: Im weitesten Sinne menschenähnlich erscheinende Tiere, die unterschiedlichsten Verwandtschaften zugehören
[5] Antibiotikum: Ein natürlich gebildetes, oft chemisch modifiziertes, niedermolekulares Stoffwechselprodukt von Pilzen, Bakterien oder Schwämmen, das schon in geringer Konzentration das Wachstum anderer Mikroorganismen hemmt oder diese gar tötet
[6] Penicillin G: Einziges therapeutisch wichtiges Penicillin
[7] Enzym: Protein, das, an spezielle Moleküle angepasst, Synthese oder Abbau katalysiert. Meistens werden mehrere Enzyme zu einem Komplex verbunden, um eine räumliche Nähe zwischen den einzelnen, aufeinanderfolgenden Syntheseschritten herzustellen
[8] Promisk (Promiskuität): Häufiger, meist versetzter oder gleichzeitiger Sexualkontakt mit mehreren, wechselnden Partnern
[9] Horizontaler Gentransfer: Im Gegensatz zum vertikalen Gentransfer (von einer Generation zur anderen) wird beim horizontalen Gentransfer genetisches Material, DNA-Bruchstücke, auf andere Individuen, andere Arten oder sogar auf andere Organismengruppen übertragen; dies kann direkt erfolgen (Transformation) oder mit Fremdhilfe
[10] Nischen (ökologische): Meist begrenzte Gebiete mit ziemlich einheitlichen Lebensbedingungen; durch spezifische abiotische und biotische Faktoren bestimmt
[11] Multiresistent: Gegen viele Wirkstoffe, vornehmlich Antibiotika, resistent
[12] Immun: Vor etwas gefeit, gegen etwas unempfindlich sein
[13] Mikroben: Mikroskopisch kleine Lebewesen, die einzeln nicht mit bloßem Auge erkennbar sind, zum Beispiel Bakterien und Archäen. Die meisten dieser Mikroorganismen sind Einzeller, zu ihnen zählen jedoch auch wenigzellige Lebewesen (einige Pilze und Algen, viele Amoebozoa, Chromalveolata, Rhizaria und Excavata) entsprechender Größe
[14] Mikroevolution: Unter Mikroevolution wird landläufig eine Evolution verstanden, die von außen betrachtet, nicht offensichtlich ist; so gilt manchen (je nach Einstellung) die Entstehung von Formen und Unterarten, ja von Arten, nur als Mikroevolution, als eine Evolution, die, wenn auch schwierig, doch Laien irgendwie nachvollziehbar erscheint.
[15] Echte Pflanzen: Plantae (Eukarya)
[16] Echte Tiere: Animalia (Opisthokonta – Eukarya)
[17] Otto Normalverbraucher: Der Nachname „Normalverbraucher“ stammt von Lebensmittelkarten, die im Zweiten Weltkrieg und noch mehrere Jahre danach ausgegeben wurden. Lebensmittelmarken mit dem Aufdruck „Nur für Normalverbraucher“ gingen an Personen, denen kein besonderer Bedarf zuerkannt wurde – anders als etwa Schwerstarbeitern, Schwangeren und Kriegsversehrten. Otto hieß seit der Kaiserzeit im Berlinischen eine Sache, über die in Anredesätzen Hochachtung ausgedrückt wurde, einen Braten etwa: „Das ist aber ein Otto!“ (wikipedia.org/wiki/Otto_Normalverbraucher)
[18] Objekt der Evolution: Wirken der Evolution auf einen Organismus
[19] Subjekt der Evolution: Ein Organismus bewirkt Evolution anderer
[20] Population: Bevölkerung
[21] Makroevolution: Unter Makroevolution wird eine Evolution verstanden, die von außen betrachtet, sofort ins Auge fällt, die sich in unterschiedlichster Verwandtschaftszugehörigkeit ausdrückt, wie Knochenfische (Teleostei), Knorpelfische (Chondrichthyes), Schildkröten (Testudines), Schlangen (Serpentes), Krokodile (Crocodylia), Huftiere (Ungulata), Beuteltiere (Marsupialia), Säugetiere (Mammalia), Nagetiere (Rodentia), Bedecktsamer (Magnoliatae), Apfel (Malus domestica), Orange (Citrus sinensis), Avocado (Persea americana), etc.
[22] Horizontaler Gentransfer
[23] Weltuntergang und Neuschaffung als transzendente Welt aus einer uns noch unbekannten, doch uns bewussten, aber ungreifbaren Materie („Dunkle Materie“) und unfassbaren Energie („Dunkle Energie“)
Eingestellt am 15. März 2025
.

Penicillium, Pinselschimmel
4 Camembert und ähnliche Weichkäse
.
Ob Weich-, Schnitt- oder Hartkäse sollen entstehen,
Entscheidet des Käsebruchs[1] Wassergehalt,
Denn je stärker und öfter mit Lab oder Säure zum
So mehr verliert sie über Siebe Molke[4],
So härter wird Käse, am Ende so hart wie Parmesan[5].
.
Heben entscheidend den Säuregehalt, drücken des Bruchs pH auf Werte um Fünf,
.
Der verschiedenen Weichkäsesorten Aroma
Hängt von beteiligten Pilzen, von Reifebedingungen, sowie Temperaturen ab,
Auch, wann und wie stark Jungkäse außen gesalzen, ob pasteurisierte oder Rohmilch verwendet wird:
So entsteh‘n verschiedn‘e Geschmacksnuancen, zum Beispiel von Brie und Camembert;
Für Rotschimmelkäse, der unter Camembertiis[20] Decke
Zusätzlich rötlich sich zeigt, wurden Rotschmierbakterien[21] zugesetzt. –
.
Blauschimmelkäse wie Roquefort, Gorgonzola[22] und ähnliche blau durchsetze Sorten,
Rühren wesentlich von Penicillium roquefortii[23] her,
Dessen Konidien, nach Vorreifung des Bruchs mit Geotrichum und Hefen,
Dem Käsebruch zugesetzt,
Den Käse mit luftbedürftigen Hyphen[24] durchdringen;
Dafür werden Jungkäsezylinder durchstochen, damit
Reifer Blauschimmelkäse sein charakteristisches Aussehen mit
Gängen voll blauer Konidien erhält. –
.
Merkwürdig-Außergewöhnliches umrahmt des Roquefortkäses Werden:
Gilt er doch nur als solcher, wenn er von der Schafrasse Lacaune[25]
Aus roher Schafsmilch begrenzter Gebiete[26] gewonnen und ausschließlich in Kalkfelsgewölben
.
Eine Sage übernimmt sicher dabei eine Rolle,
Die erzählt, wie der Roquefort-Käse wurde entdeckt:
Ein Hirte, der seinen Bortzeitkäse einmal im Höhlenunterstand liegengelassen,
Als einem hübschen Mädchen er, das vorübereilte, nachgerannt,
Den Käse darüber – wer kanns nicht verstehen? – vergaß,
Ihn dann doch nach wenigen Wochen wiederum sah,
Erstaunt ihn blau bewachsen und doch
Wunderbar schmackhaft mit diesem Schimmel fand. –
.
Dort in den Höhlen natürlich vorkommenden Penicillium roquefortii,
– Ob er im größeren Maßstab dort immer noch kultiviert, sei dahingestellt –
Vermehrt man, indem Brot, das außenherum verkohlt fast gebacken,
In Mengen aufgebrochen, in die Käsehöhlen es legt,
Wartet, bis es, feucht noch im Innern, fast gänzlich verschimmelt,
Trocknet, zu feinem Pulver vermahlt und dann, ihn inokulierend, dem Käsebruch damit inokuliert[29].
.
Eine Woche lang verbleibt in perforierten Tonformen der Käse,
Wird gewendet, mit Salz bestreut,
Mit Nadeln Luftkanäle für den Edelschimmel in ihn gestochen,
In Zinnfolie gewickelt drei Wochen danach,
Und für aromatische Nachreifung für
Drei Monate in kühlere Höhlen gebracht.
.
Siebzehn Höhlen stehen dazu bereit, die sich über
Zwölf Stockwerke durch den Kalk des Combalou-Massivs zieh‘n,
Dem Roquefort Zeit und Klima zu geben, damit er bekannte Aromen entwickelt aus
.
Fußnoten
[1] Käsebruch: Substanz, die nach Zugabe von Lab oder Milchsäure als gestöckelte Milch nach Zerteilen (brechen) entsteht, um Molke abzutrennen.
[2] Gestöckelte Milch, Saure Milch: Durch Säure verfestigt sich die Milch; wird sie entnommen wirkt sie eckig-bröckelig, was als gestöckelt bezeichnet wird
[3] Käseharfe: Besteht zumeist aus einem Edelstahlrahmen, in den bis zu 24 feine, parallel verlaufende Drähte gespannt sind.
[4] Molke: Wässrig-grünlichgelbe Flüssigkeit, die bei der Käseherstellung entsteht; nach Abtropfen, oder Gerinnung durch leichte Erwärmung, flüssiger, aufgefangener Teil der geronnenen Milch
[5] Parmesan: Hartkäse aus Kuhmilch mit mindestens 32% Fett in der Trockenmasse; darf nur in den Provinzen Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna westlich des Reno und Mantua südlich des Po produziert werden.
[6] Milchsäuregärung: Prozesse des Energiestoffwechsels von Lebewesen, bei denen Glucose und andere Monosaccharide zu Milchsäure abgebaut werden
[7] Leuconostoc spp. (Leuconostocaceae; nicht separat behandelt; Lactobacillales – Firmicutes – Grampositive – Bacteria): In der Umwelt weitverbreitete aerotolerante Bakterien; spielen in verschiedenen industriellen und Lebensmittelfermentationen eine wichtige Rolle; vergären Glucose und Fructose zu Milchsäure
[8] Lactococcus spp (Steptococcaceae; nicht separat behandelt – Lactobacillales – Firmicutes – Grampositive – Bacteria); kugelförmige Bakterien; erzeugen durch Gärung Milchsäure
[9] Lactobacillus (Lactobacillaceae; nicht separat behandelt – Lactobacillales – Firmicutes – Grampositive – Bacteria); meist stäbchenförmige Bakterien. Erzeugen durch Gärung Milchsäure
[10] Geotrichum candidum (Dipodascaceae – Saccharomycetales; nicht separat behandelt – Saccharomycotina – Ascomycota – Dikarya –…)
[11] Candida valida (Debaryomycetaceae; nicht separat behandelt – Saccharomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze –…)
[12] Rhodotorula spp. (Sporidiobolales – Microbotryomycetes – Pucciniomycotina – Basidiomycota – Dikarya –…)
[13] Pichia spp. (Saccharomycetales; nicht separat behandelt – Saccharomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze –…)
[14] Kluyveromyces spp. (Saccharomycetaceae – Saccharomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze –…)
[15] Lipolytisch: Lipide hydrolytisch spaltend
[16] Proteolytisch: Proteine zerlegend
[17] Penicillium camembertii: Käse-Weißschimmel (Aspergillaceae – Eurotiales – Eurotiomycetidae – Eurotiomycetes – Bitunicate Ascomycota –…)
[18] Konidie: Asexuell und nach außen gebildete Verbreitungseinheit
[19] Käsemeister: Fachmann für die Herstellung, Reifung und Qualitätssicherung von Käse
[20] Penicillium camembertii
[21] Rotschmierbakterien: Brevibacterium linens (Actinomycetales – Streptomycetes – Actinobacterien – Grampositive – Bacteria)
[22] Gorgonzola: Norditalienischer Blauschimmel-Weichkäse aus Kuhmilch mit mindestens 48 % Fett in der Trockenmasse; Herstellungsgebiete ausschließlich in Piemont und Lombardei
[23] Penicillium roquefortii: Käse-Blauschimmel (Aspergillaceae – Eurotiales – Eurotiomycetidae – Eurotiomycetes – Bitunicate Ascomycota –…)
[24] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände
[25] Schafrasse Lacaune: Trägt weiße Wolle, wobei rassetypisch der Kopf, Unterhals und Bauch oft unbewollt sind
[26] In Frankreichs Départments Lozère, Aveyron, Tarn, Aude, Hérault, Gard, Alpes-Maritimes, in etwa 500 Kommunen von ca. 100 km Radius um Roquefort-sur-Soulzon
[27] Cevennen Combalou-Bergmassiv: südöstlichste Teil des französischen Zentralmassivs; Karstgebirge mit engen, steilen Schluchten und Hochebenen
[28] Roquefort-sur-Soulzon: Ein südfranzösischer Ort und eine Gemeinde mit 528 Einwohnern im Süden des Départements Aveyron in Südfrankreich
[29] Inokulieren (mit einem Mikroorganismus versehen): Bei diesem Vorgang wird ein Substrat mit Bakterien, Hefen, Konidien oder Sporen versehen; nach dem Anwachsen sehen die kleinen Kolonien wie Augen aus, deshalb ‚inokulieren‘.
[30] Methylketone: Ketone, die als Rest einer nicht endständigen [–C=O]-Gruppe mindestens eine Methyl-[ CH3–]-Gruppe enthalten; folgen der allgemein der Formel [CH3–C(O)–R]; Aroma- und Geschmacksstoffe besonders von Roquefort
[31] Capronsäure: eine C6-Säure; Aroma- und Geschmacksstoff besonders von Roquefort
[32] Caprylsäure: eine C8-Säure; Aroma- und Geschmacksstoff besonders von Roquefort
[33] Caprinsäure: eine C10-Säure; Aroma- und Geschmacksstoff besonders von Roquefort
Einestelt am 15. März 2025
.
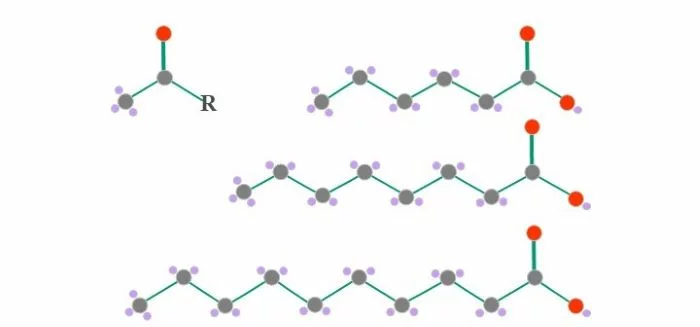
Geschmacks- und Aromastoffe des Roquefort-Käses (ppt-generiert; Reinhard Agerer)
Oben, links: Methylketone. – Oben rechts: Capronsäure. – Mitte: Caprylsäure. – Unten: Caprinsäure.
Kohlenstoff: grau. – Sauerstoff: rot. – Wasserstoff violett. – Einfachbindungen: feiner grüner Strich; Doppelbindungen: breiter grüner Strich.
Eingestellt am 15. März 2025
.

Perithecienascomycota, Krugschlauchpilze
1 Nur eines vereint sie
.
Wer dächte nicht, betrachtete jemand dieser Pezizomycotina[1] Fruchtkörperform,
An die zwar ungestörte Entwicklung, doch auch an der Meiosporangien[2] übertriebenen Schutz,
Der für Sporenverbreitung Asci[3] zwingt, falls zu eng wird des Fruchtkörpers Hals,
Ihr Verhalten zu ändern für erfolgreiche Sporenpropagation[4]:
.
Denn schössen sie wildentschlossen, so wie sie sind,
Füllten Sporen wie einen Trichter des Peritheciums[5] Hals;
Je mehr von ihnen den Hohlraum befüllten,
So mehr drückten Neue die Vorgänger aus der Mündung hinaus,
Blieben zu Fäden, zu Cirren[6], verklebt,
Würden von Insekten[7] genommen, vielleicht nach Trocknen von Winden verstäubt.
.
Warum, fragt sich deswegen manch ein Perithecienträger,
Die Sporen noch schießen,
Wenn der Hals viel zu lang, zu eng für die Asci
Und Sporen sich doch nur in der Höhlung versammeln,
Ohne Aussicht, wie andere zentimeterweit
Propagulen in die Umwelt zu bringen?
.
Konsequent verliert sich vielfach ihr Mühen;
Lösen einfach des Ascus Wand,
Schieben, mit Schleimen umhüllt,
Sporen gegen die Mündung und weiter voran.
.
Elegant lösen Findige dieses Anhäufungsproblem:
Kurz vor Abschuss streckt sich der Ascus,
Einer nach dem andern, erheblich voran,
Erreicht er der Mündung annähernd gleichgroße Öffnung,
Schießt er und zieht sich, der
Nächsten Kanone[8] Platz einzuräumen, wieder zurück.
.
Fußnoten
[1] Pezizomycotina: Becherlingsartige i. w. S. (Ascomycota – Dikaryota – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Oisthokonta –…)
[2] Meiosporangium: Eine sporenbildende Zelle, in der Karyogamie (K!) und Meiose (R!), also Verschmelzung haploider Kerne und anschließend den doppelten Chromosomensatz reduzierende Kernteilungen erfolgen und danach Meiosporen entstehen
[3] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota
[4] Propagation: Ausbreitung
[5] Perithecium, Krugförmiger Fruchtkörper, (Pezizomycotina): Bauchig-flaschenförmiger Fruchtkörper (wie eine Chianti-Flasche) mit enger Mündung, durch die sich die streckenden Asci ihre Sporen in die Umwelt schießen, oder im Innern abgeschossene Sporen allmählich nach außen gedrückt werden.
[6] Cirren: Zu langen Fäden zusammenhängende Konidien oder Sporen
[7] Insekten: Hexapoda (Tetraconata – Mandibulata – Arthropoda – Panarthropoda – Ecdysozoa –…)
[8] Ascus
Eingestellt am 15. März 2025
.

Pezizomycotina, Becherlingsartige i.w.S.
1 Aufs Feinste geregelt
.
Auch sie formen, wie sich’s für Ascomycota[1] gehört,
In freier Zellbildung[2] acht Sporen zumeist:
Nehmen den so genannten Ascusvesikel[3],
Coaxial[4] zur Zelle entstanden, in Pflicht,
Der, sich nach innen in einzelne Lappen zergliedernd,
Alle Kerne je mit Protoplasma[5] umschließt.
.
Des Meisporangiums[6] Wandung,
Apikal besonderes differenziert,
Schießt, wie schon an anderer Stelle gehört,
Über Druck die Sporen
Zentimeterweit in die Luft, damit sie für
Weitertransport in verwirbelte Luftschichten gelangen.
.
Jede Verwandtschaft kreiert ihr eignes Modell,
Hocheffizient ihr Ziel zu erreichen;
Wenige nur verzichten wieder darauf;
Überzeugen, raffiniert wie sie sind,
Darmpassage abzulegen an anderem Ort. –
.
Bleiben mit zentralem, einfachem Porus[14]
Miteinander für interne Transporte verbunden;
Die Öffnung begleiten beidseits des Septums
Um bei Bedarf sie raschestmöglich zu schließen,
Doch wieder öffnen zu können danach.
.
Der Körperchen Form variiert zwar verwandtschaftsbezogen, doch
Einheitlich ist ihr kristallgitterähnlicher Bau.
.
Fußnoten
[1] Ascomycota: Schlauchpilze (Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya)
[2] Sporenbildung durch freie Zellbildung (Ascomycota; keine Zellzerklüftung!): Dabei werden, auf unterschiedliche Weisen beginnend, um den Zellkern mit Zellmembransystemen Protoplasmaportionen des Sporangiums herausgeschnitten; da dies um jeden Zellkern individuell geschieht, bleiben zwischen den separierten Portionen noch Protoplasmareste erhalten, die bei der Sporenbefreiung eine osmotisch wirkende Rolle innehaben.
[3] Ascusvesikel: Wird eine flache Struktur einer dünnen, flächigen Cisterne benannt, die im Zentrum des Ascus (coaxial mit ihm, zunächst zylinderähnlich nahe des Plasmalemmas) entsteht, anfangs sackartig die acht haploiden Kerne umgibt, um dann, sich nach innen zu lappend, zusammen mit jedem Kern eine
Protoplasmaportion zu umhüllen, um eigenständige Zellen, die jungen Sporen, in freier Zellbildung aus dem Protoplasten des Ascus herauszuschneiden. In die flache sporenumgebende Cisterne werden dann Wandsubstanzen für die Sporen sezerniert; Restcytoplasma bleibt dafür noch über, wie auch den ascusinternen Druck zu erhöhen, um damit den Ascus für die Sporenbefreiung zu öffnen.
[4] Coaxial: Bezeichnung für übereinstimmende Zentralachsen dreidimensionaler Elemente
[5] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle
[6] Meiosporangium: Eine sporenbildende Zelle, in der Karyogamie (K!) und Meiose (R!), also Verschmelzung haploider Kerne und anschließend den doppelten Chromosomensatz reduzierende Kernteilungen, erfolgen und danach Meiosporen entstehen
[7] Wirbeltiere: Craniota (Nothochordata – Chordata – Deuterostomia – Bilateria – Animalia –…)
[8] Als Vektoren: Transporteur, Überträger, Ausbreiter
[9] Fruchtkörper (Pilze): Komplexe Hyphengeflechte, die Überdauerungsorgane oder Sporangien enthalten oder diese oberflächlich tragen
[10] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände
[11] Trichal (Algen, Pilze, u.a.): Gebaut aus einzellreihigem Faden, wobei jede Zelle funktionell nur einen Zellkern besitzt, n, 2n (oder n+n, Dikaryon, bei Pezizomycotina und Agaricomycotina)
[12] Septum (Algen, Pilze): Querwand eines einzellreihigen Fadens, eines Trichoms, eines Zellausläufers, einer Hyphe
[13] Dikaryon, dikaryotisch: Zwei konträrgeschlechtliche haploide (n) Kerne [werden als (+)- und (–)-Kerne oder als α- und β-Kerne bezeichnet; unterscheiden sich ihre Behälter in Größe oder die Dikaryen bildenden Kerne in der Wanderungsrichtung, kann auch von männlichen (wandern zu ihren Partnern, die stationär bleiben) und weiblichen Kernen gesprochen werden], bilden funktionell eine Einheit (n+n), ohne miteinander zum diploiden Kern (2n) verschmolzen (K!) zu sein; sie teilen sich mitotisch synchron, um damit zwei Dikaryen zu bilden, sich zu verdoppeln. Im Entwicklungskreislauf erfolgt zwar zunächst die Plasmogamie (P!), doch die Karyogamie (K!) zum diploiden (2n) Kern wird erst kurz vor der Meiose (R!) vollzogen. Man spricht hier auch von verzögerter Karyogamie. Dikaryen treten bei Taphrinomycotina, Pezizomycotina, Pucciniomycotina, Ustilaginomycotina und Agaricomycotina auf.
[14] Einfacher Septenporus: Eine zentrale Öffnung der Querwand, ohne irgendwelche besonders geformte Porenränder
[15] Woronin-Bodies: Organelle, deren im Transmissionselektronenmikroskop (TEM) zu erkennender interner Bau wegen regelmäßiger Anordnung kleinster kugelförmiger Proteinteilchen eine kristallgitterartige Struktur vortäuschen
[16] Woronin, Mikhail Stepanovich (1838 – 1903): Russischer Botaniker mit bemerkenswerten mykologischen Kenntnissen
Eingestellt am 15. März 2025
.
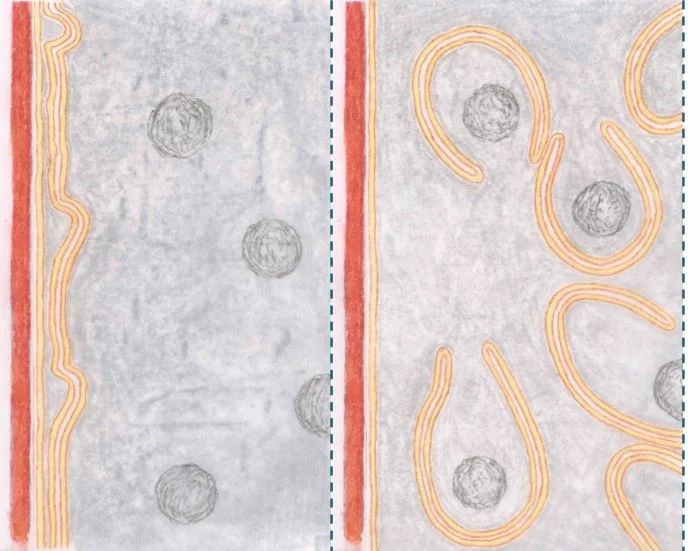
Freie Zellbildung der Sporen bei Pezizomycotina: mit Ascusvesikel (Kreide; Reinhard Agerer)
Jeweils nur die Hälfte des Ascus-Durchmessers gezeichnet; nur Anschnitte und diese nicht maßstabsgetreu. – Zellwand des Ascus: rotbraun. – Lipiddoppelmembran (braun-gelb-braun). – Protoplast: grau. – Zellkern: dunkelgrau.
Links: Beginn der Ascosporenbildung kurz nach der Meiose und anschließender Mitose; nur vier der acht Kerne gezeigt. Ein Ascusvesikel (als Vesikel erkennbar durch den Hohlraum zwischen den beiden Lipiddoppelmembranen) entwickelt sich aus einzelnen Cisternen (nicht gezeigt) parallel zum Plasmalemma (coaxial) als Hohlzylinder rund um die Ascusinnenseite; der anfangs einigermaßen gestreckte Ascusvesikel beginnt schon einige Einwölbungen in den Protoplasten zu bilden.
Rechts: Im fortgeschrittenen Stadium hat sich der Ascusvesikel lappig zerteilt und die Teile beginnen, Protoplasmaportionen um die Kerne herausschneidend, die Kerne mit Cisternen zu umgeben. Sporen noch nicht vollständig herausgeschnitten; Restcytoplasma wird überbleiben.
Nach Müller & Löffler (1982), Seite 239, Abb. 114 und Webster & Weber (2007), Seite 238, Abb. 8.11)
Eingestellt am 15. März 2025
.
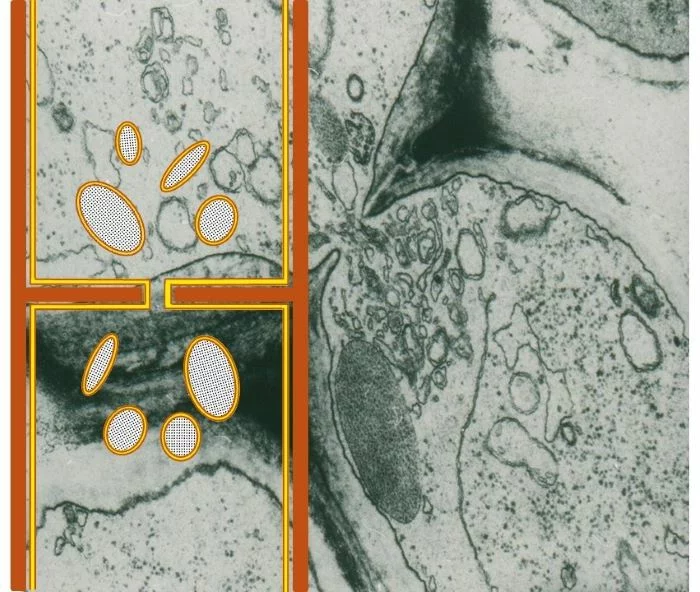
Woronin-Bodies der Pezizomycotina (Schema, ppt-generiert; Reinhard Agerer. Unterlegtes TEM-Bild; Reinhard Agerer, Original)
Links: Schematischer Längsschnitt durch eine Hyphe mit einfachem Porus. Das Plasmalemma (braun-gelb-braun) kleidet auch den Porus aus und umgibt die Woronin-Bodies. Mehrere unterschiedlich große und geformte Woronin-Bodies mit charakteristischer kristallartiger Struktur des Inhalts sind mit dem Porus assoziiert.
Unterlegt: TEM-Bild zeigt die natürliche interne Struktur der Woronin-Bodies.
Eingestellt am 15. März 2025
.

Pezizomycotina, Becherlingsartige i.w.S.
2 Merkmalssyndrom
.
Die einen und andern vergessen zwar nicht den
Vorteil, mit Hefen[1] zu leben und,
Wenn möglich zuckrige Säfte sprossend[2] zu füllen;
.
Dikaryotische[5] Hyphen sind Teil des geschlechtlichen Lebens,
Dort erst, wenn jung noch die Zelle,
.
Beide geben, wenn einmal zusammengekoppelt,
Ein unzertrennliches Paar[10];
Wirken gemeinsam koordiniert in der Zelle,
Als wären sie jetzt schon ein Kern[11]mit doppeltem Chromosomensatz;
Auch wenn sie mitotisch[12] sich teilen,
Vollzieh’n sie dies immer synchron[13].
.
– Vielleicht auch mit mehreren Kernen pro Zelle[16],
Doch lassen diese unbeachtet einander links liegen –
Erst wenn der richtige Partner sich naht,
Umschlingen sie sich, meist von anderen Hyphen bedeckt:
Bauchig mit vorauseilendem, dünnerem Fortsatz[19],
Harrt dem sich mühenden Männchen entgegen.
.
Dort ist der Ort sich für immer zu paaren,
Zu schalten und walten als Dikaryon.
.
Wandern als Paare hinaus in
Austreibende Schläuche[24] des Ascogons;
Was sie danach beginnen scheint fast ohne Sinn.
Wer hilft, den Zweck zu versteh’n?
.
Der Schläuche[25] Spitzen wenden sich
Richtung Ascogon entschlossen zurück,
Geben an ihrer Wendung[26] den Kernpaaren Raum,
Synchron sich gemeinsam zu teilen;
Schicken je eine Tochter[27] etwas von sich,
Eine in den dahinter liegenden Schlauch zurück,
Die andere in die nach hinten gerichtete Spitze
– Wie ein Haken[28] sieht das Ganze nun aus –
Als Paar residieren zwei Töchter davon dort weiter,
Wo die Eltern zuvor bereits lagen.
.
Vereinsamt, hinausgeworfen,
Fühlen die beiden Verschickten sich nun,
Entkoppelt, vereinzelt, entfremdet,
Nachdem das verbliebene Paar[29]
Mit je einem Septum[30]
Von den Verstoß’nen sich trennte.
.
Was ist gescheh’n?
Warum die Entzweiung?
Zwei einkernige Zellen verblieben
Konträrgeschlechtlichen[31] Typs!
.
Sie wollen wieder zusammen,
Der Partner liegt doch so nah!
Lösen, wie sexuell Gestimmte dies immerzu tun,
Trennende Wände[32], werden zum Paar.
.
Doch warum krümmen die Schläuche sich um?
Nur das Kernpaar lenkt; Einzelkerne bewirken dieses
Sonderbare Verhalten nicht!
Auch hier scheint Sex eine Rolle zu spielen,
Empfängt doch eine seitliche Beule des Schlauchs die
Spitze des Hakens, die Getrennten zusammenzubringen.
.
Nun sind die Würfel gefallen,
Dikaryen sind nun für immer etabliert,
Werden mit synchroner mitotischer Teilung weitergegeben und
Tochterzellen voneinander durch ein Septum getrennt,
Verzweigen sich unterhalb ihrer Septen, starten mit Beule den Seitenzweig,
Der, sobald etwas in Läge gewachsen, erneut einen Haken bildet,
Bis der richtige Zeitpunkt gekommen und Hakenbögen
Zur Karyogamie[37] sich entschließen Schritt für Schritt.
.
Ist nicht der permanent unvollzog‘ne
In die Zukunft immer weiter verschobene
Geschlechtlich finale Akt
Der Grund für das sonderbare Verhalten?
Einem immer wieder ‘möchte so gern‘
Folgt die Enttäuschung sofort auf dem Fuß.
Ohnehin, wer Plasmogamie[38] von Karyogamie
So weit voneinander trennt,
Lebt ohne Pause nur für den Sex,
Weil er immer das Letze verschiebt,
Das einmal endlich im Bogen des Hakens
Mit Karyogamie geschieht.
.
Nicht selten argumentieren Mykologen, auch Nichtmykologen,
Mit höherem Raumbedarf für die gekoppelte Teilung des Paars[39],
Vergessend jedoch, wie viele Pilze auch ohne Haken Tochterkerne synchron verteilen,
Auch in dünnerer Hyphen bedeutend engerem Raum!
.
Fußnoten
[1] Hefen i.e.S.: Von Ascomycota durch Knospung gebildete Einzelzellen unterschiedlichster Form; Knospungsstellen sind als Narben in der Zellwand erkennbar
[2] Hefeknospung, Hefesprossung: Wenn Hefen sich vermehren, wird an eng begrenzter Stelle die Zellwand der Zelle erweicht, so, dass intern sich erhöhender Druck dort die Zellwand nach außen beulen kann; diese Beule wird immer größer, wird sich, weil ihre Zellwand noch plastisch ist, zu einer sippenspezifischen Form entwickeln, bis sie ihre endgültige Größe erreicht hat, dann wird die Pore, durch die der Protoplast (mit Zellkern; nach Mitose) von der Mutter- in die Tochterzelle gewandert ist, durch eine Zellwand verschlossen; anschließend zerteilt sich mittig die gemeinsame Zellwand der beiden, so dass die Tochterzelle, passiv abbrechend, sich von der Mutterzelle lösen kann. Dieser Vorgang kann sich an ein und derselben Mutterzelle mehrfach wiederholen. Dadurch kommt es zu einer raschen Vermehrung der Hefezellen, solange der Energievorrat in der Zelle und um sie reicht.
[3] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände
[4] Mycel: Gesamtheit dicht oft wachender Hyphen
[5] Dikaryon, dikaryotisch: Zwei konträrgeschlechtliche haploide (n) Kerne [werden als (+)- und (–)-Kerne oder als α- und β-Kerne bezeichnet; unterscheiden sich ihre Behälter in Größe oder die Dikaryen bildenden Kerne in der Wanderungsrichtung, kann auch von männlichen (wandern zu ihren Partnern, die stationär bleiben) und weiblichen Kernen gesprochen werden], bilden funktionell eine Einheit (n+n), ohne miteinander zum diploiden Kern (2n) verschmolzen (K!) zu sein; sie teilen sich mitotisch synchron, um damit zwei Dikaryen zu bilden, sich zu verdoppeln. Im Entwicklungskreislauf erfolgt zwar zunächst die Plasmogamie (P!), doch die Karyogamie (K!) zum diploiden (2n) Kern wird erst kurz vor der Meiose (R!) vollzogen. Man spricht hier auch von verzögerter Karyogamie. Dikaryen treten bei Taphrinomycotina, Pezizomycotina, Pucciniomycotina, Ustilaginomycotina und Agaricomycotina auf.
[6] Taphrina: Hexenbesen- und Gallbildner (Taphrinales – Taphrinomycetes – Taphrinomycotina – Ascomycota – Dikarya –…)
[7] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota
[8] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon zu Chromatiden verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.
[9] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet
[10] Dikaryon
[11] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer Chromosomen; ausgedrückt mit 2n
[12] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken
[13] Synchrone, konjugierte Mitosen: Mitotische Teilungen von zwei oder mehreren Kernen, die koordiniert gleichzeitig ablaufen
[14] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n
[15] Substrat: Allgemeine Bezeichnung für feste, unterstützende, tragende oder nährende Substanz
[16] Polyenergid, plurinuclear, multinucleär: Vielkernig
[17] Weibliches Gametangium: Ascogon
[18] Acogon: Ein meist bauchiges, vielkerniges weibliches Gametangium, das mit einem Fortsatz dem männlichen Gametangium es erleichtert, es zu umschlingen, um an einer Stelle die trennenden Zellwände für Plasmogamie aufzulösen.
[19] Trichogyne: Fortsatz des weiblichen Geschlechtsorgans bei Rhodophyta und Pezizomycotina
[20] Antheridium: Männliches Gametangium, das seine Kerne in das weibliche einspeist
[21] Gametangien: Behälter für Gameten; oder für Zellkerne, die, ohne Gameten zu bilden, dazu bestimmt sind, früher oder später über Karyogamie der sexuellen Fortpflanzung zu dienen
[22] Plasmogamie: Verschmelzung der Protoplasten zweier Zellen im Zuge sexueller Fortpflanzung; abgekürzt P!
[23] Damit als Männchen definiert, gibt es doch seine Kerne in das Weibchen
[24] Primäre, ascogene, querwandlose Hyphen: Nach Plasmogamie von männlichem mit weiblichem Gametangium wandern männliche Kerne aus dem Antheridium in das Ascogon, gelangen in sich entwickelnde septenlose, in die primären ascogenen Hyphen, worin sich konträrgeschlechtliche Kerne zu Dikaryen paaren, woran sich die sekundären, trichalen ascogenen Hyphen mit dikaryotischen Zellen anschließen
[25] Primäre, ascogene, querwandlose Hyphen
[26] Im entstandenen Bogen
[27] Tochterkern
[28] Haken: Formen sich bei vielen Pezizomycotina im Zuge der Zellteilung der sekundären ascogenen Hyphen. An der Hyphenspitze wächst ein etwas gekrümmter Auswuchs nach unten, findet Kontakt zu einer darunterliegenden Stelle der Hyphe; gleichzeitig teilen sich die zwei Kerne des Dikaryons synchron mitotisch, wobei sich je einer der Tochterkerne der beiden Kerne des Dikaryons in der ursprünglichen Hyphe nach unten separieren. Die anderen Tochterkerne begeben sich zum einen in den gekrümmten Auswuchs, zum andern nach oben, um in der Hakenbiegung mit dem zweiten Kern wieder ein Dikaryon zu bilden. Zwei Querwände werden nun eingezogen: Eine Querwand trennt den Auswuchs von seinem Ursprung, die zweite bildet sich nahe des Auswuchses quer in der Hyphe. Diese zweite trennt das Dikaryon im oberen Teil der Hakenbiegung von der Partie darunter, die momentan nur einen Kern, wie auch die Hakenspitze, besitzt. Um wieder ein Dikaryon bilden zu können, bildet der Auswuchs mit seiner Berührungsstelle an der Hyphe eine Anastomose, lässt seinen Kern zum wartenden wandern, womit auch hier wieder ein Dikaryon etabliert ist. An der Stelle des Auswuchses entsteht eine Verdickung, Reminiszenz des Hakens, geht sie doch auf den rückwärts gerichteten Auswuchs zurück.
[29] Dikaryon
[30] Septum (Algen, Pilze): Querwand eines einzellreihigen Fadens, eines Trichoms, eines Zellausläufers, einer Hyphe
[31] Konträrgeschlechtliche, kompatible Kerne: Für Karyogamie sind zwei sexuell unterschiedliche, konträrgeschlechtliche, damit kompatible Kerne (männlicher und weiblicher Kern oder plus (+)- und minus (–)-Kern oder α- und β-Kern) nötig
[32] Anastomosieren: Sekundäre Verbindungen herstellen zwischen Röhren oder hohlen Trichomen
[33] Sekundäre ascogene Hyphen: Sind trichal organisiert, wobei jede Zelle ein Dikaryon besitzt; sie können sich mehrfach unterhalb Septen verzweigen, so dass eine Vielzahl von solchen Hyphen entsteht, wonach jede Hyphe an einem letzten Haken aus der dikaryotischen Spitzenzelle einen Ascus bilden kann. Sekundäre ascogene Hyphen können aber auch vollkommen ohne Hakenbildungen entstehen.
[34] Sporophyt: Bildet meiotisch (R!), da selbst diploid (oder diakryotisch), haploide Sporen
[35] Gametophyt: Bildet mitotisch, da selbst haploid, haploide Zellen (Gameten)
[36] Trichal (Algen, Pilze, u.a.): Gebaut aus einzellreihigem Faden, wobei jede Zelle funktionell nur einen Zellkern besitzt, n, 2n (oder n+n, Dikaryon, bei Pezizomycotina und Agaricomycotina)
[37] Karyogamie: Verschmelzung zweier haploider Zellkerne; abgekürzt K!
[38] Plasmogamie
[39] Synchrone Kernteilung
Eingestellt am 15. März 2025
.
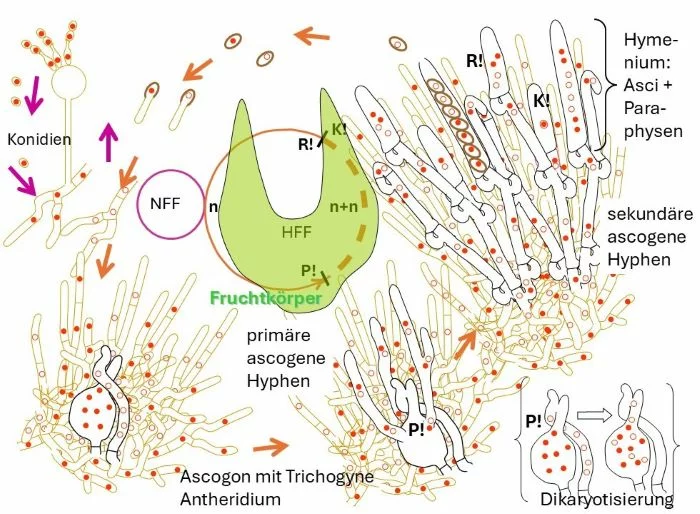
Entwicklungszyklus der Pezizomycotina (ppt-generiert; Reinhard Agerer)
Zwei konträrgeschlechtliche Sporen (dargestellt als Punkt- und Kringelkerne) treffen auf geeignetes Substrat, keimen aus und bilden je ein haploides Mycel, trichaler Organisation, das im Substrat, sich mit Hilfe von Exoenzymen ernährend, immerzu wächst.
Treffen sich zwei ausreichend große und gut ernährte Mycelien unter günstigen Umweltbedingungen, verknäueln sie sich, bilden zusammen als haploide Gametophyten, die Voraussetzung sich sexuell fortzupflanzen.
In diesen Knäueln bilden sich Ascogon mit Trichogyne und Antheridium als je vielkerniges Gametangium; Ascogon als weibliches, Antheridum als männliches Gametangium. Trichogyne und Antheridium umschlingen sich, worauf an einer Stelle die beiden sie noch trennenden Zellwände aufgelöst werden, so dass die Plasmogamie (P!) vonstattengehen kann; des Antheridiums Kerne wandern über die Trichogyne in das Ascogon, worauf Kernpaarungen erfolgen und Dikaryen entstehen.
Dikaryen wandern in die aus dem Ascogon austreibenden primären ascogenen Hyphen.
An ihnen entstehen unter Hakenbildung die sekundären ascogenen Hyphen, die sich verzweigen können und somit die Anzahl potenzieller Asci vermehren, wobei oft kandellaberartige Systeme entstehen. Die dikaryotische Endzelle eines terminalen Hakens vergrößert sich, worauf die Karyogamie (K!) erfolgt (Punkt- in Kringelkern), anschließend die Meiose (R!), durch zusätzliche Mitosen wird die Kernzahl auf acht erhöht. Von den acht Kernen gehören je vier dem gleichen Kreuzungstyp an.
Reifen die Asci, werden die Sporen durch einen apikalen Porus hinausgeschossen (der Druck im Ascus hat sich osmotisch aufgrund von zunächst hoher Zuckerkonzentration zu stark erhöht, so öffnete sich der Ascus an einer apikalen Schwachstelle, die verwandtschaftsabhängig unterschiedlichst gestaltet ist. Meist werden über längere Zeit hinweg ständig Asci reif; so werden Sporen über einen längeren Zeitraum hinweg in die Umwelt abgegeben, womit das evolutive Prinzip der Risikostreuung (nicht alles auf eine Karte setzen, nicht alle Sporen zugleich abgeben) erfüllt ist. Damit ist der Hauptkreislauf (braune Pfeile), der sexuelle Kreislauf, geschlossen, denn die befreiten Sporen können erneut auskeimen.
Zwei Begriffe werden für Pezizomycotina von Bedeutung: Paraphysen (sterile, haploide, sippenabhängig unterschiedlich gestaltete Hyphen des Gametophyten), die sich zwischen die Asci schieben und Hymenium, das die gesamte geschlossene Schicht von Asci und Paraphysen bezeichnet.
In einer Nebenfruchtform (violette Pfeile) können sich viele Pezizomycotina asexuell vermehren, wobei lediglich Konidien und keine in Sporangien gebildete Sporen entstehen.
In Kreisform dargestellt, zeigt sich ein haplo-dikaryotischer Generationswechsel mit haploidem Gametophyten (n) und dikaryotischem (n+n) Sporophyten im sexuellen Kreislauf (braune Linien), Hauptfruchtform (HFF). Der relative Anteil des Sporophyten am Gesamtkreislauf ist im Vergleich zum Anteil des Gametopyhten bedeutend geringer. Die NFF (violette Linie) ist eine asexuelle Vermehrung des Gametophyten.
Wird ein schematisierter Fruchtkörper in den Kreislauf gelegt, zeigt sich, die Fruchtkörper der Pezizomycotina besitzen sowohl gametophytische als auch sporophytische Anteile; die gametophytischen überwiegen dabei.
Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen.
In den nachfolgenden zehn Abbildungen ist der Entwicklungszyklus einer Powerpoint-Präsentation ähnlich aufgebaut
Eingestellt am 15. März 2025
.

Zwei konträrgeschlechtliche Sporen (dargestellt als Punkt- und Kringelkerne) treffen auf geeignetes Substrat, keimen aus und bilden je ein haploides Mycel, trichaler Organisation, das im Substrat, sich mit Hilfe von Exoenzymen ernährend, immerzu wächst.

Treffen sich zwei ausreichend große und gut ernährte Mycelien unter günstigen Umweltbedingungen, verknäueln sie sich, bilden zusammen als haploide Gametophyten, die Voraussetzung sich sexuell fortzupflanzen.
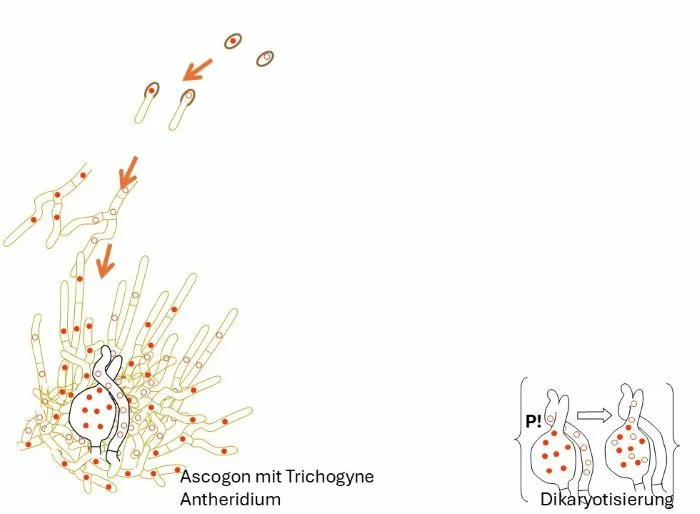
In diesen Knäueln bilden sich Ascogon mit Trichogyne und Antheridium als je vielkerniges Gametangium; Ascogon als weibliches, Antheridum als männliches Gametangium. Trichogyne und Antheridium umschlingen sich, worauf an einer Stelle die beiden sie noch trennenden Zellwände aufgelöst werden, so dass die Plasmogamie (P!) vonstattengehen kann; des Antheridiums Kerne wandern über die Trichogyne in das Ascogon, worauf Kernpaarungen erfolgen und Dikaryen entstehen.
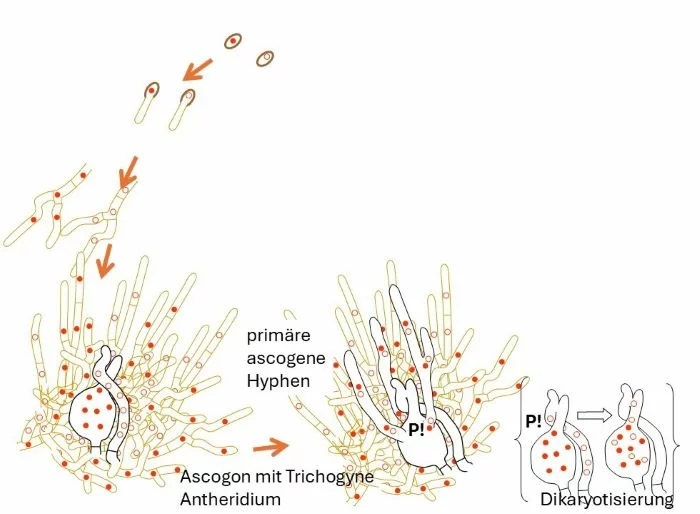
Dikaryen wandern in die aus dem Ascogon austreibenden primären ascogenen Hyphen.
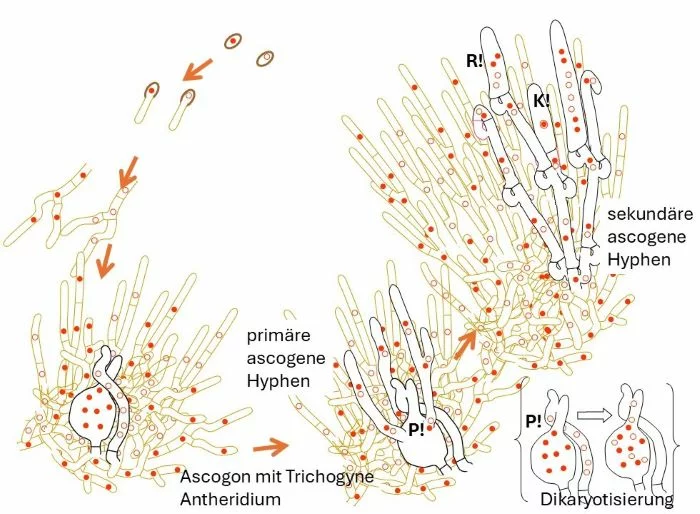
An ihnen entstehen unter Hakenbildung die sekundären ascogenen Hyphen, die sich verzweigen können und somit die Anzahl potenzieller Asci vermehren, wobei oft kandellaberartige Systeme entstehen. Die dikaryotische Endzelle eines terminalen Hakens vergrößert sich, worauf die Karyogamie (K!) erfolgt (Punkt- in Kringelkern), anschließend die Meiose (R!), durch zusätzliche Mitosen wird die Kernzahl auf acht erhöht. Von den acht Kernen gehören je vier dem gleichen Kreuzungstyp an.

Reifen die Asci, werden die Sporen durch einen apikalen Porus hinausgeschossen (der Druck im Ascus hat sich osmotisch aufgrund von zunächst hoher Zuckerkonzentration zu stark erhöht, so öffnete sich der Ascus an einer apikalen Schwachstelle, die verwandtschaftsabhängig unterschiedlichst gestaltet ist. Meist werden über längere Zeit hinweg ständig Asci reif; so werden Sporen über einen längeren Zeitraum hinweg in die Umwelt abgegeben, womit das evolutive Prinzip der Risikostreuung (nicht alles auf eine Karte setzen, nicht alle Sporen zugleich abgeben) erfüllt ist. Damit ist der Hauptkreislauf (braune Pfeile), der sexuelle Kreislauf, geschlossen, denn die befreiten Sporen können erneut auskeimen.
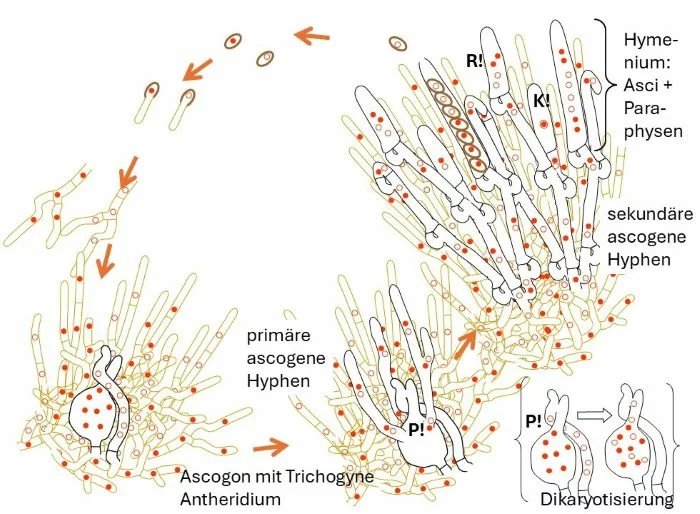
Zwei Begriffe werden für Pezizomycotina von Bedeutung: Paraphysen (sterile, haploide, sippenabhängig unterschiedlich gestaltete Hyphen des Gametophyten), die sich zwischen die Asci schieben und Hymenium, das die gesamte geschlossene Schicht von Asci und Paraphysen bezeichnet.
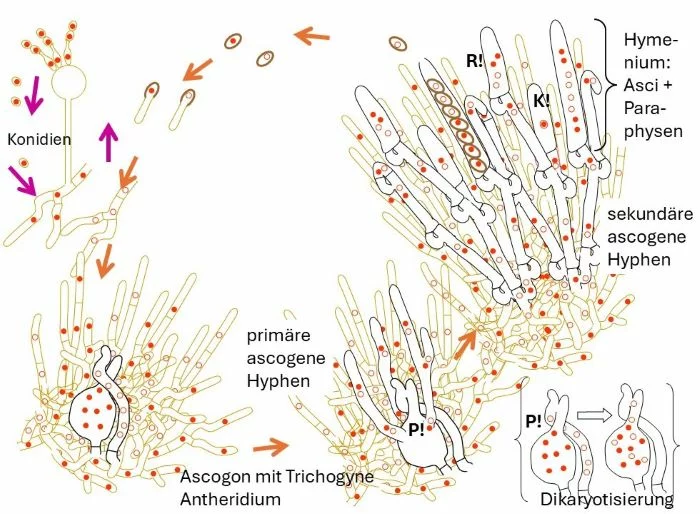
In einer Nebenfruchtform (violette Pfeile) können sich viele Pezizomycotina asexuell vermehren, wobei lediglich Konidien und keine in Sporangien gebildete Sporen entstehen.
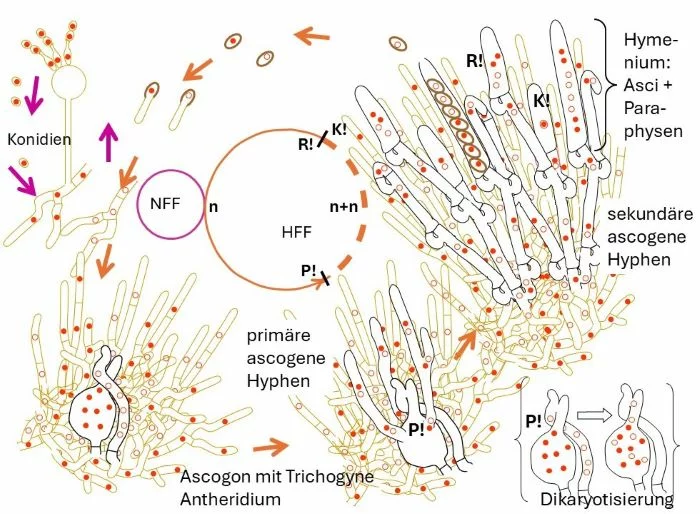
In Kreisform dargestellt, zeigt sich ein haplo-dikaryotischer Generationswechsel mit haploidem Gametophyten (n) und dikaryotischem (n+n) Sporophyten im sexuellen Kreislauf (braune Linien), Hauptfruchtform (HFF). Der relative Anteil des Sporophyten am Gesamtkreislauf ist im Vergleich zum Anteil des Gametopyhten bedeutend geringer. Die NFF (violette Linie) ist eine asexuelle Vermehrung des Gametophyten.
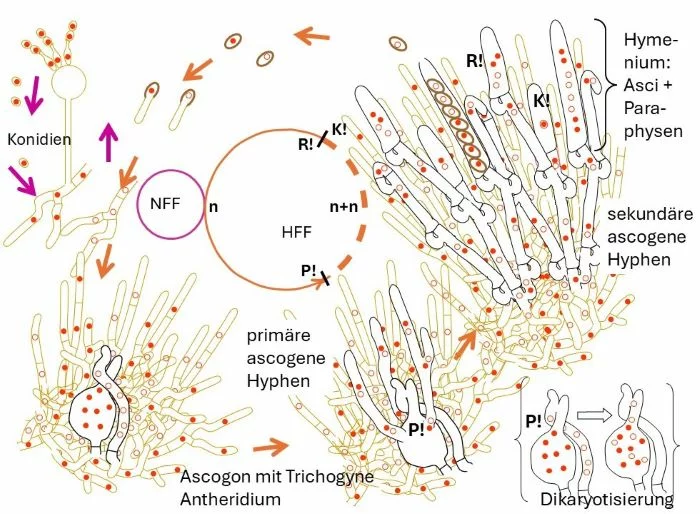
Wird ein schematisierter Fruchtkörper in den Kreislauf gelegt, zeigt sich, die Fruchtkörper der Pezizomycotina besitzen sowohl gametophytische als auch sporophytische Anteile; die gametophytischen überwiegen dabei.
Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen.
Eingestellt am 15. März 2025
.
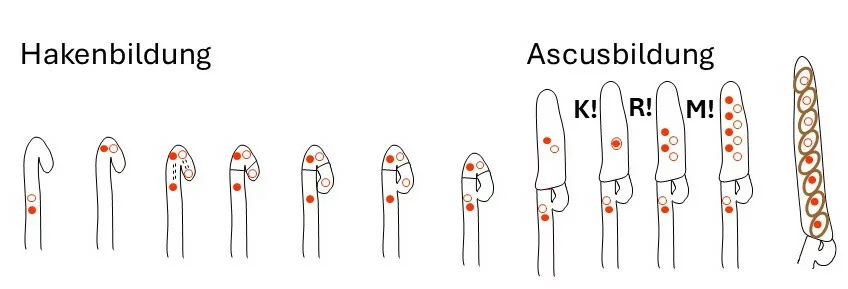
Haken- und nachfolgende Ascusbildung (ppt-geriert; Reinhard Agerer)
An der Hyphenspitze (von links nach rechts) wächst ein etwas gekrümmter Auswuchs nach unten (1), biegt sich zurück zu einer darunterliegenden Stelle der Hyphe (1); das Dikaryon belegt nun die Biegung des Hakens (2), danach teilen sich die zwei Kerne des Dikaryons synchron mitotisch, wobei sich je einer der Tochterkerne der beiden Kerne des Dikaryons nach unten separiert (3), die sich zum einen in den gekrümmten Auswuchs nach unten, zum andern nach unten, in die Hyphe begeben (3); in der Hakenbiegung bilden die beiden anderen Tochterkerne wieder ein Dikaryon (3). Zwei Querwände werden nun eingezogen (4): Eine Querwand trennt den Auswuchs von seinem Ursprung, die zweite bildet sich nahe des Auswuchses quer in der Hyphe (4). Die beiden trennen das Dikaryon im oberen Teil der Hakenbiegung von den Partien darunter, die momentan nur einen Kern besitzen (4). Damit wieder ein Dikaryon entsteht, bildet der Auswuchs mit seiner Berührungsstelle (5) an der Hyphe eine Anastomose (6), lässt seinen Kern zum wartenden wandern, womit auch hier wieder ein Dikaryon etabliert ist (7). An der Stelle des Auswuchses entsteht eine Verdickung, Reminiszenz des Hakens, geht sie doch auf den rückwärts gerichteten Auswuchs zurück (7).
Wird diese Hyphe mit ihrer Spitze (7) zum Ascus, so vergrößert sich die Zelle (8), dann erfolgt die Karyogamie, K! (9) (Punktkern im Kringelkern), anschließend die Meiose, R! (10), wobei vier haploide Kerne entstehen, paarweise unterschiedlichen Geschlechts (zwei Punkt- und zwei Kringelkerne) (10), eine Mitose (M!) erhöht die Anzahl der Kerne auf acht (11), die dann unter freier Zellbildung zu acht Sporen werden (12). Die Hakenbildung ist an den Asci immer noch erkennbar (8 - 12), kann aber bei Reifung des größer werdenden Ascus auch ziemlich stark verformt werden.
Eingestellt am 15. März 2025
.

Pezizomycotina, Becherlingsartige i.w.s.
3 Fruchtkörper
.
Mono[1]- und dikaryotische Hyphen mischen sich,
Wachsen nahe beisammen weg vom Substrat[2] in die Höh.
Erst der sporophytischen[3] Hyphen Hakenendzelle,
– Durch Verzweigen unter den Septen der Kernteilungsstelle,
Formen sie kandelabergleich[4] Büschel davon –
Wird der Sexualität erfüllender Ort.
.
Sie streckt sich ein wenig, wird voluminöser,
Lässt die Vereinigung[5] endgültig zu;
Sieht auch den Kern meiotisch[6] sich teilen,
Schließt, acht Kerne davon zu bekommen, eine Mitose[7] daran.
.
Zur dicht schließenden Fläche, zur Schicht sich vereinen,
Überstehende Hyphen der Asci Köpfe schützend bedecken[13].
.
Zum besseren Schutz der ganzen Entwicklung
Umschließen gametophytische Hyphen
– Sie bestimmen des Fruchtkörpers Form –
Das zukunftsplanende Zentrum der sporophytischen[14] Generation.
.
.Meist reifen die Asci nicht alle auf einmal.
Durchbrechen, ein wenig sich streckend,
Ihrer Paraphysen geschlossene Schicht
Und schießen – der druckaufrechterhaltende Hyphenverbund dazwischen
Erleichtert es ihnen – mit katapultischer Kraft die Sporen davon.
Nur wenige verzichten wieder darauf; sie wissen warum.
.
Als Fruchtkörper[15] einmal, auch mehrfach kreiert,
Greifen evolutive Schritte auf diese Strukturen zurück,
Um mehr der Asci und Sporen großzügig Flächen zu bieten,
Näher Sporen an luftbewegte Schichten zu bringen;
Denn je höher die Zahl, so größer die Chance,
Rechtes Substrat fürs Mycel[16], auch richtige Partner zu finden.
.
Zwei Mycelien genetisch zusammenpassender Sporen[17]
Müssen sich finden,
Fruchtkörper, Asci und Sporen zu bilden.
.
Hyphen in dichter Versammlung,
Sich Hunderte Male verzweigend, sich aneinanderschmiegend, verklebend,
Konstruieren oft wundersame Gestalten,
Schützen Intimes vor dem Vertrocknen;
Verwerten meist krautigen Abfall[20],
Helfen zum Wachsen dem Wald[25].
.
Oftmals gilt es, an heiß umworbenen Orten der Erste zu sein!
Dafür aber, um Konkurrenten mit Sporen Paroli zu bieten,
Dauert der Sex entschieden zu lang!
Übernehmen in Massen die rasche Besiedlung,
Bevor, so die Hoffnung, ein Mitbewerber die Nische[28] bezieht.
.
Fußnoten
[1] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n
[2] Substrat: Allgemeine Bezeichnung für feste, unterstützende, tragende oder nährende Substanz
[3] Sporophyt: Bildet meiotisch (R!), da selbst diploid (oder diakryotisch), haploide Sporen
[4] Kandelaber: Mehrarmiger Leuchter, Kerzenständer; hier für die dichten Endverzweigungen der sekundären ascogenen Hyphen gebraucht
[5] Karyogamie: Verschmelzung zweier haploider Zellkerne; abgekürzt K!
[6] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon zu Chromatiden verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.
[7] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken
[8] Schüsselförmiger Fruchtkörper, Apothecium (Pezizomycotina): Fruchtkörper mit weiter Öffnung für das Hymenium (wie die konkave Seite einer Schüssel), so dass Asci ihre Sporen ungehindert in die Umgebung schießen können
[9] Krugförmiger Fruchtkörper, Perithecium (Pezizomycotina): Bauchig-flaschenförmiger Fruchtkörper (wie eine Chianti-Flasche) mit enger Mündung, durch die sich die streckenden Asci ihre Sporen in die Umwelt schießen, oder im Innern abgeschossene Sporen allmählich nach außen gedrückt werden.
[10] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota
[11] Gametophyt: Bildet mitotisch, da selbst haploid, haploide Zellen (Gameten); oder nur Kerne, die direkt oder nach einer dikaryotischen Phase zur Karyogamie bestimmt sind)
[12] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände
[13] Paraphysen (Pezizomycotina): Sterile, gametophytische (haploide), zum Teil speziell gestaltete, zwischen den Asci stehende Hyphen, die mitunter an ihrem apikalen Ende verbreitert sind und so eine Schutzschicht über den sich entwickelnden Asci bilden, die von ihnen bei Reife durchstoßen wird, um die Sporen unbehindert abschießen zu können
[14] Sporophyt: Bildet meiotisch (R!), da selbst diploid (oder diakryotisch), haploide Sporen
[15] Fruchtkörper (Fungi): Komplexe Hyphengeflechte, die Überdauerungsorgane oder Sporangien enthalten oder diese oberflächlich tragen
[16] Mycel: Gesamtheit dicht oft wachender Hyphen
[17] Konträrgeschlechtliche, kompatible Kerne: Für Karyogamie sind zwei sexuell unterschiedliche, konträrgeschlechtliche, damit kompatible Kerne (männlicher und weiblicher Kern oder plus (+)- und minus (–)-Kern oder α- und β-Kern) nötig
[18] Gametangien: Behälter für Gameten; oder für Zellkerne, die, ohne Gameten zu bilden, dazu bestimmt sind, früher oder später über Karyogamie der sexuellen Fortpflanzung zu dienen
[19] Ascogene Hyhen: Hyphen, die dazu dienen, letztlich Asci zu bilden; es lassen sich primäre und sekundäre ascogene Hyphen unterscheiden
[20] Saprotroph, saprob: Nur von toter organischer Masse lebend
[21] Parasitisch, parasitär: Schmarotzend leben auf Kosten lebender Organismen
[22] Pflanzen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für photosynthetisch aktive Organismen
[23] Echte Tiere: Animalia (Eukarya)
[24] Homo sapiens: Moderner Mensch (Homo spp. – Hominini – Homininae – Hominidae – Hominoidea –…)
[25] Mykorrhiza: Eine Symbiose zwischen Pilz (Myko-) und Pflanze über Pilzhyphen und Wurzeln (-rhiza)
[26] Konidie: Asexuell und nach außen gebildete Verbreitungseinheit
[27] Clonale Vermehrung: Asexuelle Vermehrung (rein mitotisch bedingte Vermehrung, daher Individuen genetisch identisch)
[28] Nischen (ökologische): Meist begrenzte Gebiete mit ziemlich einheitlichen Lebensbedingungen; durch spezifische abiotische und biotische Faktoren bestimmt
Eingestellt am 15. März 2025
.
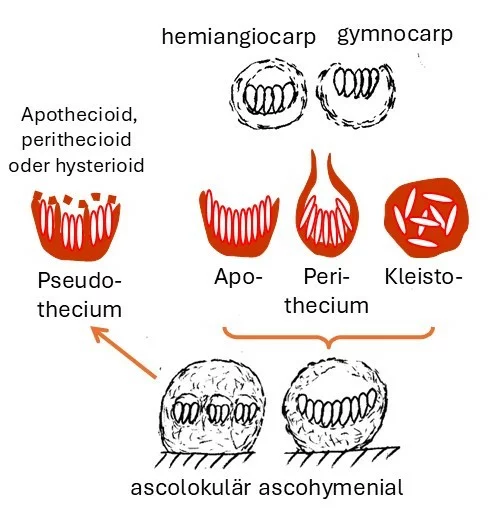
Fruchtkörpergrundtypen der Pezizomycotina (Tusche, ppt-generiert; Reinhard Agerer)
Unten: Ascoloculäre und ascohymeniale Ontogenese. Ascoloculär verläuft die Entwicklung eines Pseudotheciums, wobei die einzelnen, hymenienbildenden Höhlungen als Loculi bezeichnet werden. Der Gegensatz dazu ist ascohymenial, bei dem von Anfang an nur ein Hymenium angelegt wird.
Mitte: Links das ascoloculär entstandene Pseudothecium, das nach Ausprägung apothecioid, apothecienähnlich, perithecioid, perithcienähnlich oder hysterioid sein kann; ein hysterioides Pseudothecium ist zwar apothencienähnlich, doch zeigt sich das Hymenium in Aufsicht langgezogen oder sogar verzweigt. – Dreiergruppe daneben die ascohymenial entstandenen Apotheciem, Peritheciem und Kleistotheciem.
Zweiter von links: Das Apothecium ist ein schüsselförmiger Fruchtkörper mit weiter Öffnung für das Hymenium (wie die konkave Seite einer Schüssel), so dass Asci ihre Sporen ungehindert in die Umgebung schießen können.
Zweiter von rechts: Das Perithecium ist ein krugförmiger, bauchig-flaschenförmig geformter Fruchtkörper (wie eine Chianti-Flasche), der eine enge Mündung besitzt, durch die sich streckende Asci ihre Sporen in die Umwelt schießen, oder durch die im Innern abgeschossene Sporen allmählich nach außen gedrückt werden.
Rechts: Kleistothecium, ein immer geschlossener Fruchtkörper, der auf Zerfall oder auf Gefressenwerden wartet.
Oben links: Ein hemiangiocarper, halbgeschlossener, Fruchtkörper wird anfangs geschlossen angelegt, in dem zunächst in einer Höhlung das Hymenium entsteht; erst danach öffnet er sich, es freizulegen.
Oben rechts: Ein gymnocarper Fruchtkörper bildet von Anfang an sein Hymenium offen, ohne es zunächst schützend einzuschließen
Eingestellt am 15. März 2025
.

Pezizomycetes, Operculate Schlauchpilze
1 Deckel hoch
.
Mit einer Ordnung nur, dafür fast eineinhalb Dutzend Familien umfassend,
Und mehr als eineinhalbtausend Arten,
Gehören Pezizomycetes zu den kleineren Klassen der
Höchstentwickelten Unterabteilung der Ascomycota.
.
Ihr Ascus[1], einmalig in Form und Funktion,
Weist auf ursprüngliche Stellung hin im System:
Weil er anfänglich vergleichsweise breit,
Dennoch recht schlank,
Weil oft stark in Länge gezogen
Und das ganze Hymenium[2] durchmisst.
.
Durch eine große Öffnung jagen sie Sporen,
Geben so ihnen Freiheit,
Sich mit Ornamenten[3] zu schmücken;
Denn allein der innere Druck bringt sie nach außen.
Kein Knallkorkeneffekt[4] unterstützt seine Wirkung,
Sprinterqualiät den Sporen zu geben.
.
Ein Deckel[5], als flache Stelle am Ascus leicht zu erkennen,
Klappt, als solcher mit Linie präformiert,
Plötzlich zurück, wird der Druck innen zu hoch,
Gibt die Startrampe frei für jedes Geschoss[6].
.
Zentral oder subapikal bleiben die Deckel
Nach ihrem Wegklappen hängen,
So wie die Öffnung am Scheitel des Ascus auch lag[7].
Er bremste die Sporen wohl nur, schösse er mit in die Höh.
.
Der Pezizales früheste Sippen
– Auch heute noch existent –
Färben, wenn Jod[8] ihnen gegeben,
Der Asci Wandung durchgehend blau:
Amyloid[9], wie der Forscher dies nennt,
.
Vielleicht ist es die gleiche Substanz,
Deren Taphrinomycetes[12] sich reichlich bedienen,
Wenn Sporen und Hefen sie glättend umgeben;
Und dort sei es, so die Erkenntnis, der Stärke sich bläuender Teil[13].
.
Keine Erfindung, die immer so bleibt,
Wenn sich äußere Umstände ändern!
So auch die Form der Asci, mit Jod ihre Färbung,
Anzahl der Sporen, Vermehrung der Kerne,
Und – kaum verständlich zunächst –
Der Sporen Katapult.
.
Fußnoten
[1] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota
[2] Hymenium: geschlossene Schicht von Asci oder Basidien mit, falls vorhanden, dazwischenstehenden sterilen Elementen, Paraphysen (Ascomycotina) oder Cystiden (Basidiomycota)
[3] Sporenornamente (Pezizomycotina): Viele Meiosporen der Fungi tragen Oberflächenstrukturen (Ornamente) ganz unterschiedlicher Gestalt. Bei Pezizomycotina treten sie nur bei Pezizomycetes (Pezizales) auf, weil deren Ascus eine weite Öffnung aufweist und so die Sporen trotz Oberflächenornamenten ungebremst den Ascus verlassen können. Die übrigen Pezizomycotina besitzen engste Ascusöffnungen, durch die ihre Sporen mit dem sog. Knallkorkeneffekt verschossen werden
[4] Knallkorkeneffekt (Pezizomycotina): Dabei verengt eine Spore mit ihrem größten Durchmesser dicht den Porus (Ornamente wären dabei hinderlich), so erhöht sich der Druck im Innern des Ascus, bis er zu hoch für die verschließende Spore (alias für den Korken) ist und hinausgeschleudert wird; die nächste Spore verlegt dann die Öffnung, bis auch sie wieder abgeschossen wird; dies geschieht in kürzester Abfolge wiederholt, bis auch die letzte Spore den Ascus verlassen hat.
[5] Operculum: Deckel, daher operculat
[6] Spore
[7] Mittig oder leicht schräg am Apex
[8] Melzers Reagens oder Jodjodkalium
[9] Amyloid: Blau nach Jodbehandlung
[10] Amylose: Glocosemoleküle sind in der Amylose fast ausschließlich α-1,4-glycosidisch miteinander verbunden¸ wobei das unverzweigte Molekül in Schraubenform vorliegt; beim Amylosenachweis („Stärkenachweis“) lagert sich Jod in das Schraubeninnere ein, wobei eine bläuliche Färbung entsteht
[11] Stärke: Gemisch aus Amylose und Amylopectin; Speicherpolysaccharid der Pflanzen
[12] Taphrinomycotina, Gallbildner: Ascomycota (Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya)
[13] Amylose
Eingestellt am 15. März 2025
.

Pezizomycetes, Operculate Schlauchpilze
2 Hoch hinaus
.
Helvella[1] folgt dem vielversprechenden Trend,
Abschussrampen für Sporen bereits mit dem Fruchtkörper[2]
Vom Substrat[3] möglichst weit zu erheben,
Damit sie vom Start weg Luftbewegung verspüren.
Ein Unding zwar, für gezielten Schuss,
Doch für Windverbreitung die günstigste Wahl.
.
Zum Stiel, gerippt, um Stabilität zu erlangen,
Verjüngt, verlängert, Helvella die Basis,
Mit der sie im Boden verankert,
Streckt ihr Apothecium[4] atmosphärischen Wirbeln entgegen.
.
Schwestern in ihrer Gattung stülpen die Schüssel
Zur konvexen Gestalt;
Modellieren zu Bergen und Tälern, was
Andere gern als harmonische Hügel behalten,
Um nicht wie zerfleddert zu steh’n.
.
Noch weiter wollen die Morcheln[7]
Auf diesen vielversprechenden Wegen noch geh’n:
Effigurieren es wabig, perfektionierten wie Bienen es,
Doch ohne Akribie.
Kleiden die Gruben des kegligen Huts mit braunem Hymenium aus,
Setzen ihn keck auf hohlen, weißlichen Stiel.
.
Oberflächenvergrößern heißt die Devise![8]
Wenn einmal der Ort, die richtige Zeit, für den Fruchtkörper gefunden,
Soll kostengünstig, ökonomisch perfekt,
Jede Ressourceninvestition optimalen Gewinn erbringen.
.
Verwirklichen noch ein weiteres evolutives Prinzip:
Ressourcen sparen zu hohem Gewinn,
Denn Stiele gestalten innen sie hohl.
Der Rand genügt ihnen, sind sie doch dadurch röhren-, gegen Verbiegen[9], stabil.
.
Die Strategie ‚weg vom Substrat‘, hinein in den Wind[10]
Mit hochpotenzierten Hymenienflächen in engem Verbund,
Treibt der Pezizomycetes – und nicht nur ihre –
Zukunft entschieden voran.
.
Fußnoten
[1] Helvella: Lorcheln (Helvellaceae; nicht separat behandelt – Pezizomycetes – Pezizomycotina – Ascomycota – Dikarya –…)
[2] Fruchtkörper (Fungi): Komplexe Hyphengeflechte, die Überdauerungsorgane, Konidien oder Sporangien enthalten oder diese oberflächlich tragen
[3] Substrat: Allgemeine Bezeichnung für feste, unterstützende, tragende oder nährende Substanz
[4] Apothecium, Schüsselförmiger Fruchtkörper (Pezizomycotina): Fruchtkörper mit weiter Öffnung für das Hymenium (wie die konkave Seite einer Schüssel), so dass Asci ihre Sporen ungehindert in die Umgebung schießen können
[5] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota
[6] Hymenium (Fungi): geschlossene Schicht von Asci oder Basidien mit, falls vorhanden, dazwischenstehenden sterilen Elementen, Paraphysen (Ascomycotina) oder Cystiden (Basidiomycota)
[7] Morcheln: Morchella (Morchellaceae; nicht separat behandelt – Pezizomycetes – Pezizomycotina – Ascomycota – Dikarya –…)
[8] Vergrößern der reproduktiven Oberfläche (Fungi): Ein entscheidendes evolutives Prinzip. Man stelle sich zunächst einmal eine ebene Fläche als Hymenium vor, erhebe sie dann gedanklich zu einer Halbkugel, so lässt sich, auch ohne große Berechnung, schließen, die konvexe Oberfläche einer Halbkugel ist größer als die Ebene gleicher Grundfläche (gilt in gleicher Weise, wird die Ebene zum Becher vertieft); jede Erhebung, jede Vertiefung auf der Halbkugel wird die Oberfläche des geometrischen Körpers erhöhen und damit auch die Gesamtfläche des Hymeniums, wenn Hügel und Tal damit be-/ausgekleidet sind. Wenn einmal als Mycel ein Platz im Substrat oder als Fruchtkörper auf dem Substrat ergattert worden ist, lohnt deshalb es sich evolutiv, diesen so umfangreich wie möglich auszunutzen, um letztlich windverbreitete Sporen (auch wenn sie zunächst abgeschossen werden) in größtmöglicher Zahl zu bilden und abzuschießen. Bei Windverbreitung ist nämlich, um möglichst erfolgreich zu sein (fit zu sein), die Anzahl der Propagulen mitentscheidend.
[9] Röhrenstabilität: Bewirkt Stabilität gegen Verbiegen, werden dabei doch die verfestigenden Elemente an den Rand verlegt; im Gegensatz zur Zugstabilität, bei der die festigenden Elemente im Zentrum angeordnet sind. Auch Statiker berücksichtigen diese Prinzipien.
[10] Abheben vom Substrat, hinein in den Wind (Fungi): Ein entscheidendes evolutives Prinzip. Auch wenn Sporen aktiv weggeschleudert werden, wirken Luftturbulenzen und Windströmungen erheblich mit, besonders für Fernverbreitung, Sporen an Orte zu bringen, die nicht schon von der eigenen Art besiedelt werden und erhöhen auch die Chance wieder geeignetes Substrat vorzufinden. Weil Luftturbulenzen substratnah recht gering sind, wenn überhaupt vorhanden, wirkt sich ein Schießen in luftbewegte Schichten besonders fördernd aus für die Verbreitung und den Erhalt einer Art. Damit trägt ein Abheben vom Substrat fitnessfördernd für eine Art.
Eingestellt am 15. März 2025
.
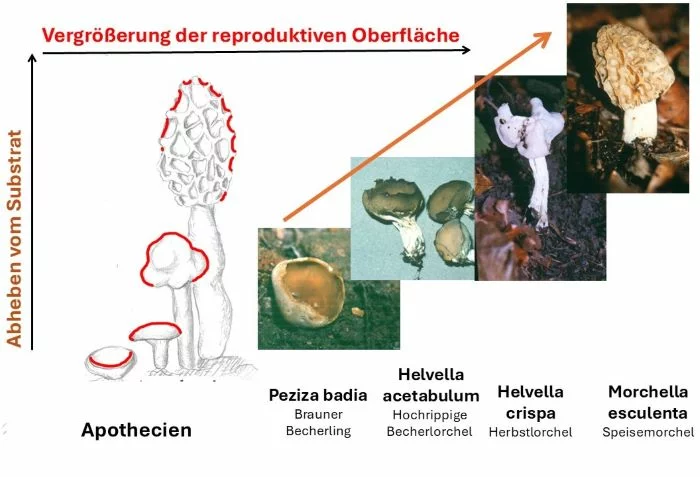
Die evolutiven Prinzipen Abheben vom Substrat und Vergrößerung der reproduktiven Oberfläche; Apothecien als Fruchtkörpergrundtyp (hier bei Pezizomycetes)
Mit den Beispielen Peziza badia, Helvella acetabulum, Helvella crispa und Morchella esculenta sollen die beiden evolutiven Prinzipen in Schemazeichnung und mit wirklichen Vertretern dargestellt werden. Diese Strategien verlaufen gemeinsam, um ein höchstentwickeltes Ziel zu erreichen.
Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen (alle Bilder Originale; Reinhard Agerer)
Eingestellt am 15. März 2025
.
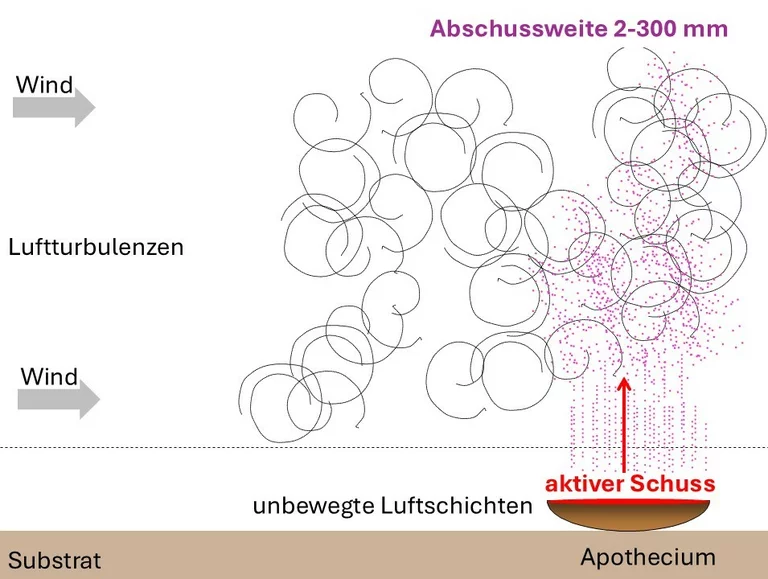
Zusammenwirken von Sporenschießen und Windverbreitung
Weil substratnah meist unbewegte Luftschichten vorherrschen, ist es wichtig, Sporen so weit zu schießen, dass sie in Luftwirbel und Wind gelangen.
Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen (ppt-generiert; Reinhard Agerer)
Eingestellt am 15. März 2025
.

Pezizomycetes, Operculate Schlauchpilze
3 Ab in den Boden
.
Als flache Schüssel, vielleicht als Ebene
Formten Pezizales Fruchtkörper zu Beginn ihrer Existenz
– Oft Ascomata[1], in Einzahl Ascoma genannt;
Denn nichts ist mit Früchten von Pflanzen ihnen gemein –
Wie nicht anders zu erwarten, griff die Evolution,
Der Schüssel[2] Form optimierend, wiederholt zu.
.
Besonders, wenn immer wieder austrocknend die Stellen,
War es weise, offene Schüsseln Schritt für Schritt zu
verbergen,
Den empfindlichen Asci[3] zum Bilden der Sporen,
Nicht zum Verschießen allein, benötigtes Wasser zu sichern.
.
Zum Vorteil mochte es einigen werden,
Ganz im feuchtigkeitpuffernden Boden[4] zu bleiben,
Sich dazu ganz zur Höhle zu schließen.
Doch was nützte es, Sporen noch zu verschießen?
.
In Reihe wie Palisaden zur Schicht noch gruppiert,
Werden, nicht nur durch Paraphysenenden[5],
Auch mit Flechtgewebe[6] sie bedeckt!
Sie stürben, ihre Arten verkämen,
Holten nicht wühlende Tiere
Sie aus dem Boden zum Fressen heraus!
.
Soll Zufall es richten, bis sie von Tieren gefunden?
Gar manche sollten dann mit ihrem Schicksal wohl hadern.
Doch, wer seinen Wohlgeschmack mit Düften garniert,
Bleibt am Büffet bestimmt nicht lange zurück.
.
Eines blieb der Evolution noch zu klären!
Was passiert mit Sporen, wenn sie im Darm?
Dicke, oft bräunliche Wände schützen sie vor dem Verdauen.
Andere brauchen die Säfte zum späteren Keimen sogar.
.
All diese Entwicklungstendenzen
Breiten Pezizaceen[7] noch heute vor uns aus.
Wollen immer nur hoch hinaus;
Tuberaceen[10], die Echten Trüffeln, aber
.
Fußnoten
[1] Ascoma, Ascomata: Fruchtkörper der Pezizomycotina
[2] Apothecium, Schüsselförmiger Fruchtkörper: Fruchtkörper mit weiter Öffnung für das Hymenium (wie die konkave Seite einer Schüssel), so dass Asci ihre Sporen ungehindert in die Umgebung schießen können
[3] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota
[4] Der Boden ist nicht so stark trocknenden Winden ausgesetzt, so hält sich Feuchtigkeit länger; zudem wird Wasser immer wieder kapillar aus tieferen Schichten nachgeliefert.
[5] Paraphysen: Sterile, gametophytische (haploide), zum Teil speziell gestaltete, zwischen den Asci stehende Hyphen, die mitunter an ihrem apikalen Ende verbreitert sind und so eine Schutzschicht über den sich entwickelnden Asci bilden, die von ihnen bei Reife durchstoßen wird, um die Sporen unbehindert abschießen zu können
[6] Flechtgewebe, Plectenchym (Fungi): Der Bau ausgewachsener Fruchtkörper gleicht im Schnitt oft einem echten Gewebe, einem Parenchym, bei dem die Zellen allseits mit den Nachbarzellen durch gemeinsame Zellwände verbunden sind. Beim Flechtgewebe, dem Plectenchym, verkleben verzweigte Hyphen sekundär zu einer dichten Versammlung, wobei die Zellen des Plectenchyms durch Vergrößern und gegenseitiges Abplatten sich in ihrer Gestalt gelegentlich kaum von Zellen echten Gewebes unterscheiden lassen, doch die Zellverbindungen (Poren), zeigen den Verlauf der Hyphen; in ihrer Ontogenese wird der Aufbau aus einzelnen Fäden ohnehin deutlich.
[7] Pezizaceae; nicht separat behandelt: Becherlinge (Pezizomycetes – Pezizomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze – …)
[8] Helvellaceae; nicht separat behandelt: Lorcheln (Pezizomycetes – Pezizomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze –…)
[9] Morchellaceae; nicht separat behandelt: Morcheln (Pezizomycetes –Pezizomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze –…)
[10] Tuberaceae: Echte Trüffeln (Pezizomycetes – Pezizomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze ––…)
[11] Nagetiere: Rodentia (Glires – Euarchontoglires – Boreoeutheria – Placentalia – Theria –…)
[12] Wildschwein: Sus scrofa (Suidae – Suina – Artiodactyla – Übrige Cetartiodactyla – Cetartiodactyla –…)
[13] Reh: Capreolus (Cervidae – Pecora – Ruminantia – Cetruminantia – Übrige Cetartiodactyla –…)
Eingestellt am 15. März 2025
.
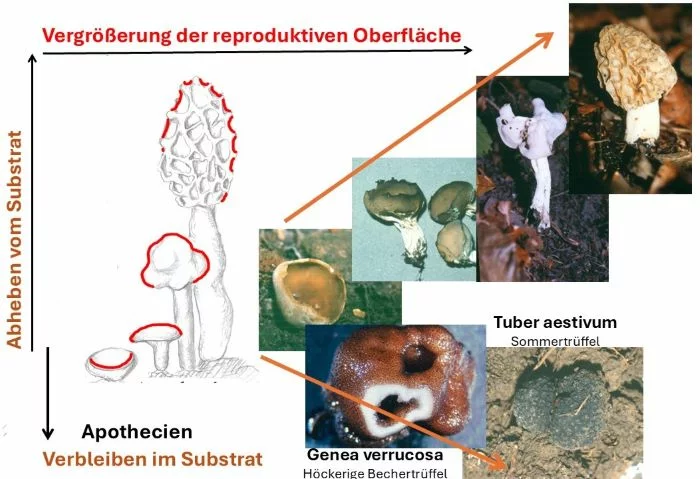
Evolution zu Hypogäen
Von einem Apothecium ausgehend, wölbt sich der Fruchtkörper ein. So ist bei der Gattung Genea noch die ursprüngliche Apothecienöffnung zu erkennen, im Inneren aber ist das Hymenium mit einem Plectenchym bedeckt. Bei der Gattung Gattung Tuber sind keine Hohlräume mehr zu erkennen, meist auch keine ursprüngliche Öffnung, alles ist mit Hyphen gefüllt.
Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen (alle Bilder Originale; Reinhard Agerer)
Eingestellt am 15. März 2025
.

Pezizomycetes, Operculate Schlauchpilze
4 Trüffel (TP)
.
Oft von dunkler, warziger Kruste,
So als wollten sie unerbetener Näherung trotzen,
Liegen sie, vor jeglichen Blicken verborgen,
In nährender Nähe von Wurzeln des Humus‘.
.
Tun gut daran, sich so zu staffieren,
Denn Kostbares liegt von der Rinde umschlossen:
Noch etwas bleich, doch feinnetzig, warzig und hübsch[1],
Zu zweit, vielleicht auch zu Dritt
Im durchsichtigen, keuligen Beutel[2],
Warten, bis bräunlicher Teint sie außenrum ziert.
.
So, als wollten allein sie die Schönheit genießen,
Nicht neidisch sich mit anderen messen,
Liegen die Hüllen[3] entfernt voneinander,
Zwar in Reihe, doch haben sich Hyphen[4] dazwischengedrängt.
.
Noch ist Zeit, in Ruhe zu reifen,
Sich für rauhe Zukunft zu rüsten:
Wände zu stärken, Schutzornamente fertigzustellen,
Zu warten, bis alle zum Aufbruch bereit.
Nicht zu vergessen, doch Hyphen sorgen dafür,
Sich zu parfümieren mit verführerisch attraktivem Duft. –
.
Plötzlich bebt der Boden um sie!
Verspüren, obwohl im Boden zuvor noch bestens versteckt,
Stoß um Stoß und lauthalses Knirschen[5]:
Zerbrochen, zerschmatzt, liegt das kräftig gebaute, warzige Haus,
Rutscht, kaum erblickte es dauernde Helle,
Den stockdunklen Tunnel in sauren matschigen See hinab.
.
Alles lockert und löst sich,
Die Hübschen[6] werden befreit.
Doch, sie wollen’s nicht glauben:
Ramponiert wirkt die Zierde.
Doch was schert sie die Schönheit, die einmal war?
Nur heraus aus der Pampe, aus diesem Schlick,
Hinaus aus dem Tunnel, hin zum Licht!
Dem Gestank nur entfliehen; hin zur erfrischen Luft!
.
Es poltert und platscht; Ruhe tritt ein.
Entsetzlich beengt liegen einstmals so Hübsche;
Immer noch mieft die Umgebung,
Doch Regen setzt ein, wäscht aus der Kacke sie aus!
.
Im Waldluftboden erholt, treiben sie Hyphen,
Finden Wurzeln laubfrischer Bäume.
Gerade treiben erste Würzelchen aus.
Legen sich, weil Nahrung sie finden, möglichst dicht an,
Lösen, fein sich verzweigend, der Wurzel äußere Wände,
Nisten darin[7] sich ein.
.
Fußnoten
[1] Ascosporen: Meiosporen der Ascomycota; meist einfach Sporen genannt
[2] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota
[3] Asci
[4] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände
[5] Wildschwein: Sus scrofa (Suidae – Suina – Artiodactyla – Übrige Cetartiodactyla – Cetartiodactyla –…)
[6] Ascosporen
[7] Bilden Ektomykorrhiza: Eine Symbiose, Mykorrhiza, aus Pilzen (-myko-) und Pflanzenwurzeln (-rhiza). Bei dieser Mykorrhiza wachsen die Hyphen ausschließlich in den Zellwänden der Wurzel (Ekto-; außerhalb des Zellinneren). Der Molekültransfer (Wasser und Nährionen vom Pilz zur Wurzel; Zucker und andere Substanzen von der Wurzel zum Pilz) erfolgt über ausgedünnte Zellwände (Restzellwände) beider Partner. Hyphen bilden außerdem eine dichte Hülle (Mantel) um die Wurzel, aus der Hyphen in den Boden hineinreichen, über die Wasser und Nährionen an die interzellulär wachsenden Hyphen und letztlich an die Wurzel gehen; oftmals stehen vom Mantel auch Cystiden (Mantelcystiden) ab.
Eingestellt am 15. März 2025
.
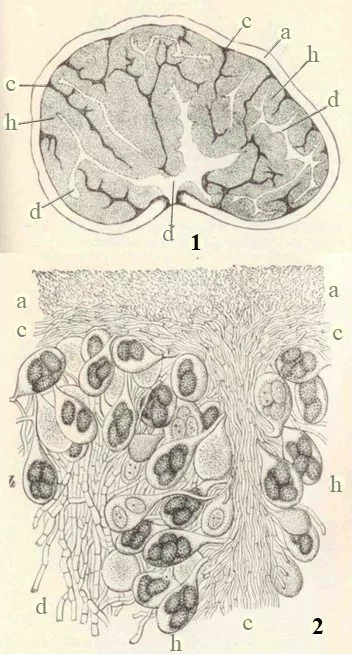
Anatomie von Tuber rufum (Rötliche Trüffel)
Oben (1): Längsschnitt-Übersicht durch den Fruchtkörper.
Unten (2): Detailausschnitt; Peridie, Trama, Hymenium und ehemalige Hohlräume füllende Hyphen.
- Peridie. – c. Trama. – d. ursprüngliche Hohlräume. – h. Hymenium. (Bemerke: Die Art Tuber rufum besitzt stachlige Sporen)
Aus Gäumann (1926), Seite 349, Abb. 241; gemeinfrei wegen Alters der Publikation.
Eingestellt am 15. März 2025
.
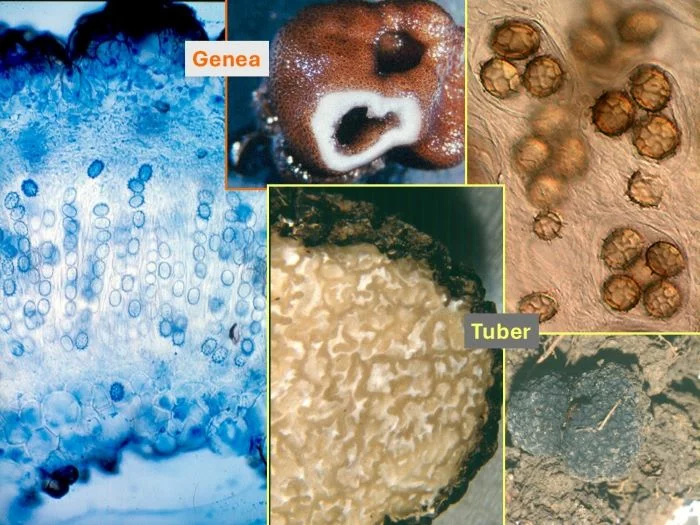
Vergleich der Fruchtkörper von Tuber und Genea
Links und links oben: Genea. Mitte oben ein angeschnittener Fruchtkörper von Genea verrucosa; Öffnung und Höhlung des Fruchtkörpers deutlich sichtbar; Oberfläche des Fruchtkörpers mit Peridie bedeckt, die in ähnlicher Weise auch im Fruchtkörper zu sehen ist. Dort bedeckt eine sterile Hyphenschicht das Hymenium. – Links: Ein Schnitt durch den Fruchtkörper von der Peridie (oben) zur sterilen Bedeckung des Hymeniums (unten; angefärbt mit Baumwollblau). Asci noch schlank, palisadenartig angeordnet und achtsporig (an einigen Asci gut zu sehen). Diese Art besitzt rauhes Oberflächenornament.
Rechts und Mitte unten: Tuber aestivum. Rechts unten Fruchtkörper, frisch aus dem Boden befreit; mit warziger Peridie. Mitte unten der angeschnittene Fruchtkörper mit weißlichen und etwas dunkleren, meandrierenden Linien: Die dunkleren Linien stellen Trama mit Hymenium dar, die weißlichen sind Verfüllungen der ehemaligen Kavitäten. – Rechts oben Schnitt durch das Hymenium mit drei- bis fünfsporigen, beutelförmigen, nicht palisadenartig angeordneten Asci. Diese Art besitzt netziges Oberflächenornament.
Alle Bilder Originale; Reinhard Agerer
Eingestellt am 15. März 2025
.
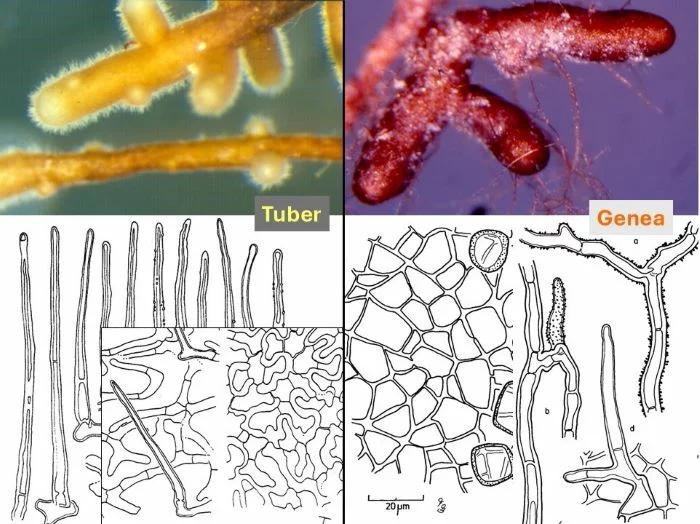
Ectomykorrhizen (ECM) von Tuber borchii (links) und Genea hispidula (rechts)
Links oben: Tuber borchii ECM, Habitus mit hellbraunem Mantel und abstehenden Mantelcystiden. (Original; Thomas Rauscher)
Links unten: Tuber borchii ECM, Anatomie: Hintergrund: Mantelcystiden. Einschub, links: Aufsicht auf Hyphennetz, dem die Cystiden entspringen; Einschub, rechts: Aufsicht auf das Mantelpseudoparenchemy mit epidermoiden, puzzleförmigen Zellen. Aus Rauscher et al. (1996), Seite 177, Teil der Abb. 1 und Seite 178, Teil a und b der Abb. 2)
Rechts oben: Genea hispidula ECM, Habitus mit dunkelbraunem Mantel und abziehenden, in den Boden sich erstreckenden Hyphen. (Original; Felix Brand)
Rechts unten: Genea hispidula ECM, Anatomie. Links Aufsicht auf den wurzelumhüllenden Mantel; Pseudoparenchym aus eckigen Zellen mit einzelnen aufliegenden verdickten eckigen Zellen; rechts vom Mantel abziehende, sich in den Boden erstreckende Hyphen. Aus Brand F (1991), Seite 116, Teil der Abb. 72 und Seite 118, Teil der Abbildung 74)
Eingestellt am 15. März 2025
.

Pezizomycetes, Operculate Schlauchpilze
5 Schnuppern und finden
.
Die im Boden verborgenen Knollen;
Wühlen und holen sie – oh welch ein Schmaus! –
Verdauen sie; Sporen jedoch überstehen dies gut.
.
Lässt sie am Boden eingehend schnuppern.
Geben sie kratzend mit Pfoten ein Zeichen,
Graben sie selbst mit der Schaufel danach.
.
Willst du mit Waldi dies erproben,
So richte ihn, jung sollte er sein, dazu folgendermaßen ab:
Geh mit ihm in den Wald, dorthin, wo du Bröckchen von Käse[5] verstreutest;
Lass ihm die Freude, wenn er sie findet, er lohnt es dir bald.
Eine Woche täglich, solltest mit Waldi im Wald du spazieren.
Vergrabe für folgende Woche den Käse im Boden.
Auch den wird dein Helfer erschnüffeln und finden;
Lass ihm gerne den Schmaus.
.
Jetzt musst du entscheiden, wie teuer dein Hobby darf werden!
Trüffelstückchen, zusammen mit Käse, musst du nun im Boden vergraben.
Lohn ihm die Mühe, er knabbert den Käse, doch
Nimmst du die Trüffelstückchen ihm wieder ab.
.
In der Woche darauf erfolgt die Probe dann aufs Exempel:
Du hast längst die kostbaren Stückchen im Boden versteckt
Und trägst den Käse in deiner Tasche,
Als Belohnung, wird er fündig, für ihn.
.
Nun sollte dein Hund, war er wirklich gelehrig,
Trüffel finden, falls du ihn führst in den richtigen Wald.
Doch bedenke, in Deutschland sind Trüffel gesetzlich geschützt;
Erwischt man dich, zahlst du nicht wenig.
In Italien erlaubt dir niemand nach Trüffeln zu suchen,
Denn dort ist fast jeder Wald privat. –
.
Hausschweine[6] sollen Trüffel ebenfalls finden,
Hast du gehört.
Sie wollen aber die Kostbaren fressen;
So hilft nur ein Stöckchen im Maul, bevor es zu spät.
Nicht nur deshalb eignen sich Hunde viel besser,
Ist doch bestimmt viel angenehmer ihr Transport!
.
Fußnoten
[1] Wildschwein: Sus scrofa (Suidae – Suina – Artiodactyla – Übrige Cetartiodactyla – Cetartiodactyla –…)
[2] Tuber: Echte Trüffel (Tuberaceae – Pezizomycetes – Pezizomycotina – Ascomycota – Dikarya –…)
[3] Moderner Mensch: Homo sapiens (Homo spp. – Hominini – Homininae – Hominidae – Hominoidea –…)
[4] Haushund: Canis lupus familiaris (Cynoidea – Caniformia – Carnivora s.s. – Carnivora s.l. – Euarchonta –…)
[5] Schnittkäse: Käsesorten, die sich gut in Scheiben schneiden lassen; im Gegensatz zu Hartkäse, der, wie der Parmesan, bröckelt
[6] Hausschwein: Sus scrofa domesticus (Suidae – Suina – Artiodactyla – Übrige Cetartiodactyla – Cetartiodactyla –…)
Eingestellt am 15. März 2025
.

Pezizomycetes, Operculate Schlauchpilze
6 Warum zu Pezizales?
.
Wer Trüffel[1] als Luxus im Speiselokal
Lässt auf die Pasta sich hobeln,
Sieht mäandrierende hellbraune Linien:
Der Asci[2] und Sporen ziehende Bahn.
.
Sie folgen Hymeniums[3] ursprünglicher Linie,
Als ihre Schüssel im Innern noch glatt, nicht uneben war;
Mit jeder Wölbung, mit jeder Falte, verengt sich des Fruchtkörpers[4] Lumen;
Schon überwölbt das Gekröse der Rand.
.
Enge bestimmt schon der Asci Revier,
Verspüren den Druck, die Schlankheit wird plump.
Wo bleibt noch Raum, den Deckel[5], der vielleicht noch vorhanden, zu öffnen?
Ein Schießen – wohin denn? – wär ohne Sinn.
Sie bleiben im Trüffel, von Hyphen[6] umschlossen,
Zogen sich in die Trama[7] zurück.
.
Woher so sicher, dass auf diese Weise es geschah?
Einige Arten sind bis heute nicht völlig geschlossen,
Zeigen, wo der Schüssel Öffnung einst war.
Wer jetzt noch zweifelt, befrage der Trüffel DNA[8].
.
Fußnoten
[1] Echte Trüffel: Tuber (Pezizomycetes – Pezizomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze –…)
[2] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota
[3] Hymenium (Fungi): geschlossene Schicht von Asci oder Basidien mit, falls vorhanden, dazwischenstehenden sterilen Elementen, Paraphysen (Ascomycotina) oder Cystiden (Basidiomycota)
[4] Fruchtkörper (Fungi): Komplexe Hyphengeflechte, die Überdauerungsorgane, Konidien oder Sporangien enthalten oder diese oberflächlich tragen
[5] Operculum: Deckel, daher operculater Ascus; Ascus mit Deckel
[6] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände
[7] Trama: Steriles Hyphengeflecht als Träger des Hymeniums
[8] Sequenzanalysen: Analysen der Nucleoidreihenfolge (A, C, G, T) in der DNA
Eingestellt am 15. März 2025
.
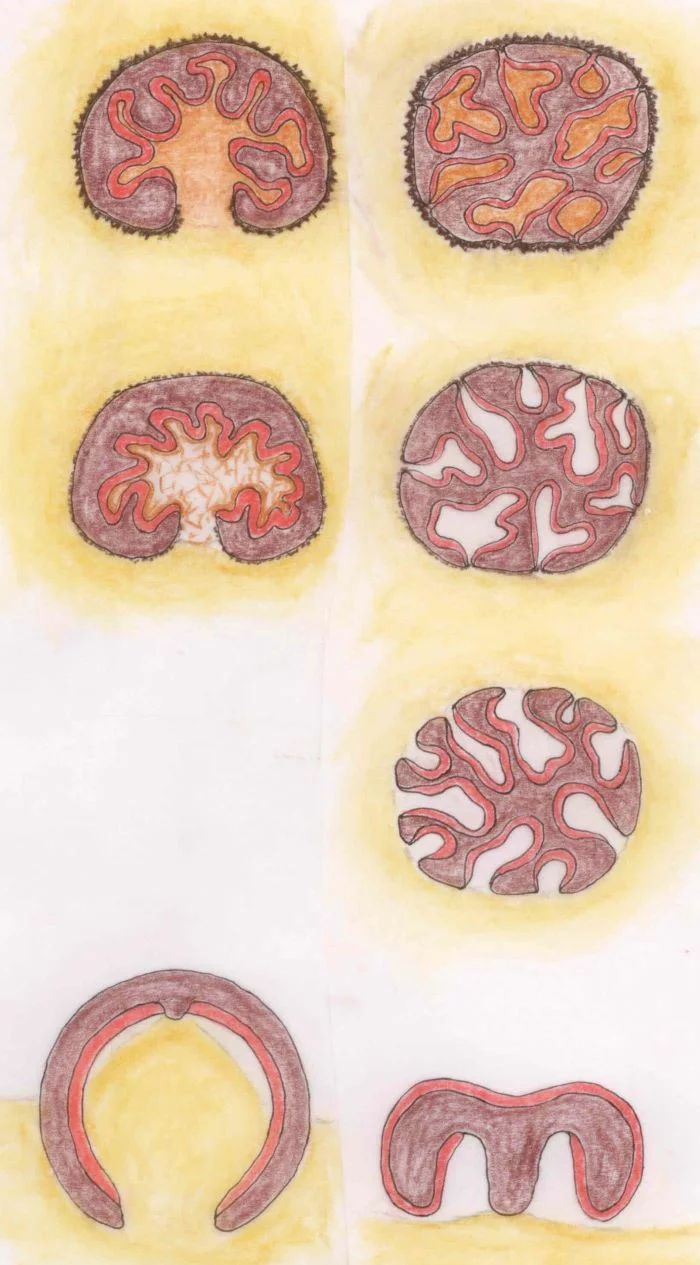
Mutmaßliche Evolutionsschritte von apothecienbildenden Vorfahren zu Tuber (Tusche-, Kreidezeichnung; Reinhard Agerer)
Nach: Gäumann E (1964) Die Pilze, 2. Aufl. Birkhäuser, S. 215, Abb.220
Hier werden verschiedenste rezente Gattungen der Pezizales (nicht im einzelnen dargestellt), die zwar heute unterschiedlichen Familien angehören, miteinander in schematisierter Weise verglichen, um eine Vorstellung zu bekommen, wie die Evolution von epigäischen Apothecien zu geschlossenen, hypogäischen Fruchtkörpern von Tuber, verlaufen sein könnte.
Bedeutung der Farben: Dunkelbraun: Trama des Fruchtkörpers, Plectenchym, das die Form des Fruchtkörpers bestimmt. – Schwarzbraun: Peridie des hypogäischen Fruchtkörpers; widerstandsfähiges, dichtes Abschlusshyphengeflecht. – Gelb: Boden. – Silberfarben, weiß: umgebende oder eingeschlossene Luft. – Rot: Hymenium. – Ocker: Sekundär mit Hyphen gefüllte Kammern.
Rechte Reihe von unten nach oben: Ausgehend von einem mehr oder weniger gestielten, flachen oder noch deutlich schüsselförmigem Apothecium, das bis auf den Stiel mit Hymenium umkleidet ist (Sphaerosoma; unten), dellen sich mehrere hohle, mit Hymenium ausgekleidete Kavernen in den ungestielten und bereits hypogäischen Fruchtkörper ein (Hydnotria; 2. Bild v. unten). – Die Mündungen der Kavernen nach außen werden zusehends verengt, der Fruchtkörper mit einer Peridie versehen; die nun entstandenen geschlossenen Kammern sind weiterhin hohl (Balsamia; 2. Bild von oben). – Letztlich werden die Kammern mit Mycel ausgefüllt, so dass ein kompakter Fruchtkörper entsteht (Tuber brumale; oberstes Bild); bei dieser Art entstanden die Kammern offenbar aus Kavernen, die zunächst rundum sich bildeten (man spricht deshalb von einer Ubiquariae-Reihe der Entwicklung). Das Ausfüllen der Hohlräume beginnt offenbar mit einer Deckschicht (wohl aus Paraphysen entstanden; wie bei Genea schon gesehen) des Hymeniums, die sich dann zur Raumfüllung weiterentwickelt. Am Ende dieser Reihe lassen sich im Fruchtkörperschnitt kaum mehr die ursprüngliche Trama und die Füllung der Kammern unterscheiden, nur noch mäandrierende Linien sind zu erkennen, auch das Hymenium als deutliche Schicht wird aufgelöst.
Linke Reihe von unten nach oben: Ausgehend von einem sich nach unten zu einwölbendem Apothecium (Petchiomyces; unten), das Hymenium weist damit nach unten und nicht nach oben, dellen sich in der Schüssel viele Vertiefungen ein (Stephensia; 2. Bild von oben), wobei sich die Schüsselöffnung immer mehr verengt, das Hymenium mit einer Hyphenschicht bedeckt und die Kammer mit noch lockerem Mycel gefüllt wird; im Wesentlichen geht das Hymenium auf eine einzige ursprüngliche Öffnung, die zudem unterseits liegt, zurück; man spricht deshalb von einer Inferae-Reihe der Entwicklung; eine Peridie wird, wie für Hypogäen oft typisch, gebildet. – Letztlich wird die große Kammer zu einzelnen kleineren Kammern, die mit Mycel ausgefüllt sind (Tuber excavatum; oberstes Bild). Am Ende dieser Reihe lassen sich im Fruchtkörperschnitt nicht mehr die ursprüngliche Trama und die Füllung der Kammern unterscheiden, nur noch mäandrierende Linien sind zu erkennen, auch das Hymenium wird als deutliche Schicht aufgelöst.
Nicht dargestellt: Innerhalb der Pezizales lässt sich auch eine Superae-Reihe feststellen, bei der sich ein Apothecium nach oben verengt, Hymenialtaschen
ausbildet, wonach die Kammern dann mit Mycel verfüllt werden. In dieser Reihe, die mit nach oben becherförmig geöffnetem Petchiomyces beginnt, zu Genea führt und über Peudobalsamia zu Pachyphloeus kommt, wurden die Kammern an der Fruchtkörperoberseite angelegt, weshalb hier von einer Superae-Reihe gesprochen wird.
Am Ende stellt sich verständlicherweise die Frage, warum eine so gestaltete Evolution vonstattenging und welche Vorteile daraus für die Pilze entstehen, damit diese Entwicklung überhaupt in der angegebenen Weise stattgefunden haben kann.
Ein erster Grund dürfte der größere Schutz vor Wasserverlust gewesen sein, denn der Boden puffert Feuchtigkeitsverluste entschieden besser ab als Luft, auch Schutz vor vorzeitigem Gefressenwerden spielt sicher eine Rolle; was aber Hypogäen letztlich zum Sporenverbreiten auch wollen und dafür bodendurchdringende Duftstoffe bilden. Das Füllen der zunächst noch nach außen offenen Kavernen hält Bodentiere ab, in sie einzudringen und das Hymenium abzuweiden (die Deckschicht auf dem Hymenium spielt dabei eine entscheidende Rolle); dazu werden auch die Zugänge eng und mit Peridie überzogen. Der Abschleudermechanismus bringt in solchen Fällen keinen Vorteil und wird konsequent, auch an hypogäischen Agaricomycotina lässt sich dies mehrfach feststellen, reduziert, was offenbar einer Materialersparnis gleichkommt.
Eingestellt am 15. März 2025
.

Pezizomycetes, Operculate Schlauchpilze
7 Sie waren vielleicht nicht die ersten (TP, SP)
.
Saprotroph[1] lebten zu Anfang, bestimmt auch noch heute,
Die meisten Pezizomycotina[2]-Arten, doch fallen,
Korrelationen zwischen Gestalt und ökologisch bestimmtem Verhalten allgemein auf.
.
Arten mit sich schließenden Fruchtkörpern[5],
Besonders, wenn sie in Böden versunken,
Oder gar von ihnen zur Gänze bedeckt,
Suchen an lebenden Wurzeln mit Mycelien[6] den
Leichteren Weg an Glucane[7] zu kommen,
Schlagen den Pfad der Mykorrhizasymbiose[8] ein.
.
Was Familien der Pezizales[9] mehrfach parallel,
Mit Erfolg konvergent[10] etablierten,
War andern Familien sicherlich ebenso recht.
Doch Fossilien, dieses Verhalten zeigend, blieben Mangelware bisher.
Das älteste, aus eozänischen[11] Zeiten bekannt,
.
Der Ektomykorrhizen[14] typischer Bau,
Nicht nur von Tuber ersonnen,
Verbindet die Partner zum Vorteil der beiden in
Rücksicht nehmender Art.
.
Dringen nicht wie Glomeromycoten[17] in Zellen ein,
Lassen immerzu hauchdünne Schichten besteh’n,
So, als gewährten der Wurzel sie Gnaden,
Vergessen aber, wer die ihren bestimmt:
Der Wirt[18] ist‘s, der die Rechnungen stellt!
.
Lässt sie nicht durch finale Schranken,
– Manche Bäume halten viel früher schon den Eindringling fest[21] –
Auch die wachsende Wurzelspitze nennen Bäume tabu.
.
Für möglichst engen Kontakt,
– Viel Raum gibt es nicht –
Drücken zu feinen Lappen, fast wie Finger, sich Hyphen,
Fühlen der Zellmembran[22] Nähe und doch
Trennt sie der lächerlich dünne,
Durch Hypheneinfluss gelockerte Rest an Glucan
– Dies konnte der Wirt nicht verhindern –
Und der kaum bemerkbare, separierende Zwischenraum.
.
Auch Tuber musste den Umständen zollen,
– Wie alle andern, die nämliche Pfade beschritten –
Verdünnt, nicht nur der Enge wegen,
Was von der Quelle ihn trennt[23].
.
So kann Tuber fremden Zellen befehlen,
Sie wandern, nichts kann sie hindern,
Hinaus in den winzigen Spalt, durch die Haut aus Glucan.
.
Darauf wartete nur der findige Pilz!
Nimmt sich Glucose, Fructose lässt er wählerisch liegen,
Holt sich Traubenzucker, schon ist er ihm willens,
Durch seine eigne Membran[26].
.
Dumm wäre der Baum, ließe er unbezahlt sich dieses gefallen!
Auch der Pilz verliert etwas vom dem, was er für sich dem Boden entnommen.
Wasser zumal, mit wichtigen Ionen darin,
.
Ließe der Pilz den Wurzeln nicht diese Retoure,
Trennte er selbst sich von seiner lebenserhaltenden Quelle.
Denn, aufdringlich, wie er sich gibt,
Umhüllt er Saugwurzeln dicht
Mit eignem Geflecht[30],
Schottet vom Boden wie hermetisch sie ab,
Verhindert sogar, jedes saugende Haar[31].
.
So sind sie einander, wie ans Messer geliefert.
Jeder holt für sich, was er nur kann,
Wird aber nicht zu sehr den andern behindern,
Sonst stürben beide, profitierten vom anderen nicht.
.
Auch Tuber hat, wie fast alle seiner Symbiosekonsorten[32],
Im Laufe der Zeit das Können, mit Zucker[33] aus dem Boden sich zu versorgen,
Unwiederbringlich eingebüßt oder gar die Gene[34] dafür verloren.
Wasser mit Ionen[37] beladen, entnimmt er aus dem Boden für sich!
Für Energie sorgt der Zucker[38] des Baums.
.
Aber nicht nur dies! Der Partner, er lässt gut sich so nennen,
Gibt ihm etwas, was der Pilz schon lang nicht mehr hat.
Etwas Unbekanntes, Geheimes, was den Forschern bis heute entgangen,
Was zum Fruchtkörperbilden ihn stimuliert und zu Ende bringt darin seinen Sex. –
.
So hat noch niemand bis heute
Mykorrhizapilze[39] ohne Baum zum Fruchtkörperbilden gebracht.
Nur Saprotrophe lassen auf Kompost sich und anderen Medien ziehen!
Nicht nur Trüffel werden deswegen im Freien unter Bäumen gesucht;
Werden ganz ohne lebende Wurzeln mit hohen Erträgen angebaut.
.
Fußnoten
[1] Saprotroph, saprob: Nur von toter organischer Masse lebend
[2] Pezizomycotina: Becherlingsartige i. w. S. (Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Oisthokonta –…)
[3] Fruchtkörpertypen: Fruchtkörper unterschiedlicher Gestalt
[4] Ernährungsweisen: saprotroph, symbiotisch, parasitisch
[5] Fruchtkörper: Komplexe Hyphengeflechte, die Überdauerungsorgane, Konidien oder Sporangien enthalten oder diese oberflächlich tragen
[6] Mycel: Gesamtheit dicht oft wachender Hyphen
[7] Glucane: Generelle Bezeichnung für aus Zuckern entstandene Substanzen
[8] Mykorrhiza: Eine Symbiose zwischen Pilz (Myko-) und Pflanze über Pilzhyphen und Wurzeln (-rhiza)
[9] Pezizales: Operculate Schlauchpilze (Pezizomycetes – Pezizomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze –…)
[10] Konvergent: Entwicklung von ähnlichen Merkmalen bei miteinander nicht verwandten Arten, die im Lauf der Evolution durch Anpassung an eine ähnliche Funktion und ähnliche Umweltbedingungen ausgebildet wurden.
[11] Eozän-Zeit: vor etwa 56-23 Millionen Jahren
[12] Ascomycota: Schlauchpilze (Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya)
[13] Agaricomycotina, Champignonverwandte: (Basidiomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya)
[14] Ektomykorrhiza: Eine Symbiose, Mykorrhiza, aus Pilzen (-myko-) und Pflanzenwurzeln (-rhiza). Bei dieser Mykorrhiza wachsen die Hyphen ausschließlich in den Zellwänden der Wurzel (Ekto-; außerhalb des Zellinneren). Der Molekültransfer (Wasser und Nährionen vom Pilz zur Wurzel; Zucker und andere Substanzen von der Wurzel zum Pilz) erfolgt über ausgedünnte Zellwände (Restzellwände) beider Partner. Hyphen bilden außerdem eine dichte Hülle (Mantel) um die Wurzel, aus der Hyphen in den Boden hineinreichen, über die Wasser und Nährionen an die interzellulär wachsenden Hyphen und letztlich an die Wurzel gehen; oftmals stehen vom Mantel auch Cystiden (Mantelcystiden) ab.
[15] Interzellulär wachsend: Wenn Hyphen nur in den Zellwänden der Pflanzen wachsen und nicht in die Zelle mit Hyphen oder Haustorien eindringen
[16] Hartigsches Netz: Sowohl im Schnitt durch die Wurzel als auch in Aufsicht der Rindenzellen erscheinen die dicht interzellulär wachsenden Hyphen wie ein Netz; das nach seinem Entdecker Robert Hartig als Hartigsches Netz benannt wurde.
[17] Glomeromycota: Urlandpilze (Multikarya – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya)
[18] Wirt (Parasiten, Symbionten): Opfer eines Parasiten, Partner eines Symbionten
[19] Phloem: Anteil eines pflanzlichen Leitbündels, der vornehmlich Assimilate von grünen, fotosynthetisch aktiven Pflanzenteilen abtransportiert; assoziiert mit wasserleitenden Bahnen des Xylems
[20] Xylem: Wasserleitende Bahnen (Holzteil) von Stelenpflanzen i. w. S. (Tracheophyta – Embryophyta – Streptophyta – Plante – Eukarya).
[21] In der Rhizodermis: Einzellschichtiges Abschlussgewebe von Wurzeln; entspricht der Epidermis oberirdischer Pflanzenteile
[22] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen mit starrer Zellwand; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt
[23] Hyphenzellwände
[24] Saccharose, Rohrzucker, Rübenzucker: Disaccharid aus α-Glucose und β-Fructose in 1,2-Verknüpfung; Zwischenspeicherzucker von Echten Pflanzen
[25] Glucose und Fructose
[26] Plasmalemma
[27] Magnesium, Mg: Als Ion doppelt positiv geladen, das im Zentrum des Chlorophylls von Stickstoff des Purinringsystems festgehalten wird; es ist für Fotosynthese und Kohlenstofffixierung von entscheidender Bedeutung
[28] Spurenelemente, Mikronährelemente: Als Mikronährelemente gelten für Pflanzen Bor (B), Kupfer (Cu), Mangan (Mn), Molybdän (Mo) und Zink (Zn)
[29] Ammoniumionen, [NH4+]: Ammoniak [NH3] mit drei Wasserstoffatomen, wird mit einem weiteren Wasserstoffatom versehen und bekommt dadurch eine positive Ladung
[30] Hyphenmantel: Mantelartige Hyphenhülle um Wurzeln von Ektomykorrhizen
[31] Wurzelhaar: Ein schlauchartiger, dünnwandiger, nicht unterteilter, unverzweigter Auswuchs einer Wurzeloberflächenzelle (einer Rhizodermiszelle) von 0,5-2 cm Länge und 2-10 Tagen Lebensdauer, mit der Aufgabe, engen Kontakt mit dem Boden herzustellen, um über des Wurzelhaars Oberfläche Wasser und darin gelöste Nährstoffe aufzunehmen.
[32] Symbionten: Organismen, die wechselseitig zu beiderseitigem Vorteil dem anderen nehmen; auch als wechselseitige Parasiten verstehbar
[33] Zucker: Kohlenstoffverbindungen mit einem doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] am Ende der Kette, wenn in offener Form dargestellt, oder als Ringform mit einem einfachgebundenen Sauerstoff im Ring, und einer oder mehreren [–OH]-Gruppen; Summenformel meist [Cn(H2O)n]
[34] Gen: Erbanlage, Erbfaktor; Einheit der genetischen Information; Abschnitt auf der DNA der bestimmte Proteinbausteine codiert oder eine bestimmte regulatorische Funktion hat
[35] Aminosäuren: Organische Säuren mit einer Amino-[–NH2] Seitengruppe. Biologisch bedeutend sind hauptsächlich jene Aminosäuren, die an dem der Säuregruppe benachbarten Kohlenstoffatom diese Gruppe besitzen
[36] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt, das zweite der beiden benachbarten den Aminosäurerest
[37] Ionen: Positiv oder negative geladene Atome oder Moleküle
[38] Glucose
[39] Ektomykorrhizapilze: Pilze, die mit ihrem Mycel Ektomykorrhizen bilden
[40] Zuchtchampignon: Agaricus bisporus (Agaricoideae – Agaricaceae – Agaricineae – Agaricales – Agaricanae –…)
[41] Austernseitlinge: Pleurotus spp. (Pleurotaceae – Pluteineae – Agaricales – Agaricanae – Agaricomycetidae –…)
[42] Shiitake: Lentinellus edodes (Omphalotaceae – Marasmiineae – Agaricales – Agaricanae – Agaricomycetidae –…)
Eingestellt am 15. März 2025
.
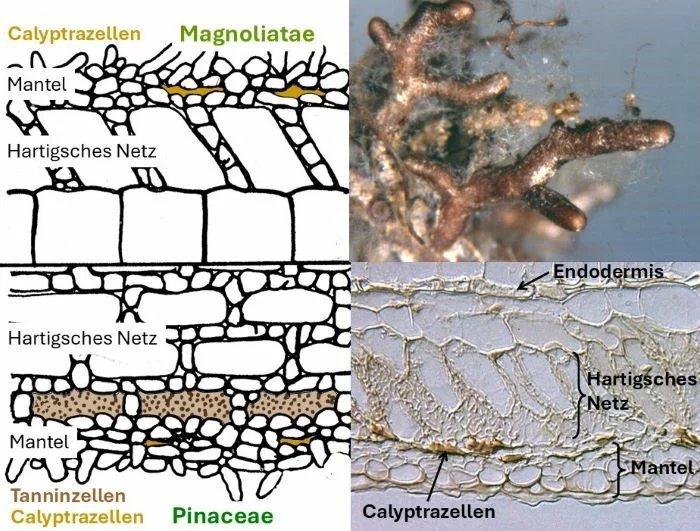
Hartigsches Netz der Ectomykorrhiza
Links schematische Zeichnungen. Oben: Hartigsches Netz im Querschnitt der Wurzelzellwände einer Ectomykorrhiza an Magnoliatae (Bedecktsamer). Nur die Rhizodermiszellen werden von den Hyphen besiedelt; hier beschränkt auf die antiklinen Wände, bei anderen ECM können auch die periklinen Wände von Hyphen bewachsen werden. Im Hyphenmantel bleiben Reste der Calyptrazellen in deformierter Weise eingeschlossen. – Unten: Hartigsches Netz im Querschnitt der Wurzelzellwände einer Ectomykorrhiza an Pinaceae (Kieferngewächse). Hier dehnt sich in der Wurzel das Hartigsche Netz bei vielen ECM bis zur Endodermis aus, ohne die Endodermiszellwände zu bewachsen. Auch hier bleiben Reste der Calyptrazellen im Mantel eingeschlossen, zusätzlich aber werden die Rindenzellen mit Tanninen gefüllt, werden so zu Tanninzellen.
Rechts oben: Ectomykorrhiza von Tomentella sp. an Fagus sylvatica. Deutlich erkennbar der dunkelbraune Hyphenmantel und die abziehenden Hyphen, die den Kontakt zur näheren Bodenumgebung herstellen. – Unten: Tangentialschnitt durch eine Tomentella-Fagus-ECM mit Hartigschem Netz, Mantel und Calyptrazellreste. Hartigsches Netz im Querschnitt und in Aufsicht.
Alle Abbildungen Originale (Reinhard Agerer)
Eingestellt am 15. März 2025
.

Pleosporales, Vollsporpilze i.w.S.
1 Kaum zu unterscheiden
.
Pseudothecien[1] gehör‘n zu ihrem Design,
Auch wenn eine Handvoll – nicht wörtlich zu nehmen –
Lieber geschlossen bis zur Reife der Asci[2] gern bleibt;
Mit Pseudoparaphysen[3], kurz oder lang, sind alle bestückt.
.
Die wenigen Merkmale, die zum Klassifizieren Taxonomen sie gönnen,
Sind, folgt man verborgenen Zeichen der DNA[4],
Familien ohne Zweifel voneinander zu trennen, beinahe wertlos;
Auch Gattungen zeigen im Licht der Moderne Heterogenität.
.
Was bleibt Taxonomen[5] schon anderes über
Als der DNA knurrend sich zu ergeben,
Um Familien nach dem verborgenen Code zu umgrenzen,
Auch wenn das Herz des Morphologen nicht wenig dagegen sich sträubt.
.
Fußnoten
[1] Pseudothecium: Viele Arten lassen zunächst in einem geschlossenen Primordium, einzelne Hymenien durch je eine Gametangiogamie entstehen, die durch sterile Ränder getrennt sind; lassen die trennenden Bereiche bei Reife und Öffnen verschwinden, so dass ein einziges, durchgehendes Hymenium vorgegaukelt wird
[2] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota
[3] Pseudoparaphysen: Paraphysenähnliche, vom Deckel des Pseudotheciums nach unten, zwischen die Asci hängende Hyphen
[4] Sequenzanalysen: Analysen der Nucleotidreihenfolge (A, C, G, T) in der DNA
[5] Taxonomisch, Taxonomie: Die biologische Taxonomie grenzt Organismen anhand alleinstellender Merkmale und Merkmalskombinationen voneinander ab und benennt sie.
Eingestellt am 15. März 2025
.

Pleosporaceae, Vollsporpilze i.e.S.
1 Teuflische Tat (AP)
.
Wie ringt man wehrhafte Völker, Bewohner von Städten,
Die dennoch dem Feind unterlegen, endgültig nieder?
Man nimmt ihnen die nötige Nahrung, hungert sie aus,
Bewirft sie mit Steinen und Bomben,
Oder verteilt der Getreideschmarotzer verderbenbringende Sporen,
Damit sie erkennen, es gibt keine Hilfe, es sei denn vom Himmel[1] herab.
.
So sei es im großen, weltumspannenden Krieg[2]
Japans Bewohner ergangen mit ihrem unverzichtbaren Reis[3],
Als Cochliobolus miyabeanus[4] auf ihre Felder sich niederließ.
Nicht per Zufall! Von oben mit Absicht geschickt!
.
Doch wer konnte und wollte die Folge der Tat überprüfen?
Lastete auf des Schmarotzers Gewissen
Doch bereits der Tod von Millionen Bengalen[5], als ihres Reises Ertrag
Um mehr als die Hälfte zusammenbrach.
.
Auch in Afrika, nicht nur in Asien,
Bringt er Unterernährung, mitunter den Tod,
Wenn er konidiengetrieben[6] Blätter befällt
Und mit bräunenden Stellen gegen der Körner Füllung sich stemmt.
.
Mit Toxinen[7] vergilbt er Zellareale um sich herum,
Bevor er in Saus und Braus für die Konidien lebt.
Formt sie langgezogen ellipsoid
In Reihe, mit Septen[8] mehrfach geteilt,
Verschmäht jede Stelle die einmal geboren[9],
Gibt jeder von ihnen den eigenen Platz.
.
Er tanzt aus der Reihe, vergleicht man die anderen Arten;
Lebt auf, wenn es der Pflanze ohnehin nicht gut geht:
Ihr der Boden zu trocken, doch mit Tau auf den Blättern,
Temperaturen vergleichsweise kühl,
Der Boden nicht bestens mit Nährstoff versorgt,
.
Formt er Pseudothecien[12] auf Überbleibseln von Blättern und Stengeln,
Treibt er mit zylindrischer Mündung sie schwarz aus ihnen hervor,
Gebiert, so wird darüber berichtet,
An manchen von ihnen Konidien;
Geht – wie raffiniert – doppelstrategisch in das Gefecht!
.
Der Gattung Verderber beschränken beileibe sich nicht
Auf Reis in warmen Gebieten der Erde:
Bewirken mit allerlei Giften, dass nichts so werde wie gerne gewollt.
.
Fußnoten
[1] Das Englische Heaven, nicht Sky
[2] Zweiter Weltkrieg: 1. September 1939 – 8. Mai 1945
[3] Reis: Oryza sativa (Oryzoideae – BOP-Verwandtschaft – Poaceae – Poineae – Poales –…)
[4] Cochliobolus miyabeanus: Erreger der Braunfleckenkrankheit bei Reis (Pleosporaceae – Pleosporales – Dothidiomycetes – Bitunicate Ascomycota – Inoperculate Ascomycota –…)
[5] Bengalen: Geografische Region im Nordosten des indischen Subkontinents; im heutigen Sprachgebrauch wird darunter meist das bengalische Sprachgebiet verstanden, während die Grenzen der Region nicht klar definiert sind
[6] Konidie: Asexuell und nach außen gebildete Verbreitungseinheit
[7] Mykotoxine: Von Pilzen produzierte Giftstoffe
[8] Quersepten: Zellwände quer eines Fadens
[9] Keine wiederholte Bildung an ein und derselben Stelle
[10] Mangan: Gelangt als Mn2+ bei Silikatverwitterung in die Bodenlösung und wird als solches aufgenommen
[11] Phosphat, [PO43−]: Als Ion vorliegend, oder an andere Atome oder Moleküle gebunden
[12] Pseudothecium: Viele Arten lassen zunächst in einem geschlossenen Primordium, einzelne Hymenien durch je eine Gametangiogamie entstehen, die durch sterile Ränder getrennt sind; lassen die trennenden Bereiche bei Reife und beim Öffnen verschwinden, so dass ein einziges, durchgehendes Hymenium vorgegaukelt wird
[13] Seta, Setae, Seten (allgemein): Nadelförmiges, dickwandiges Trichom oder Ende davon
[14] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände
[15] Mais: Zea mays (Panicoideae – BOP-Verwandtschaft – Poaceae – Poineae – Poales – …)
[16] Cochliobolus heterostrophus: Erreger der Blattfleckenkrankheit an Mais (Pleosporaceae – Pleosporales – Dothidiomycetes – Bitunicate Ascomycota – Inoperculate Ascomycota –…)
[17] Saatweizen: Triticum sativum (Triticeae – Poideae – BOP-Verwandtschaft – Poaceae – Poineae – …)
Eingestellt am 15. März 2025
.

Pleosporaceae, Vollsporpilze i.e.S.
2 Dunkle Gesellen (AP)
.
Hyphenenden[1] blähen sich auf,
Werden zu kräftigen Keulen;
Sind sich selbst als Zelle zu groß,
Zu groß das Risiko bald zu zerbrechen,
Alles, was sie gesammelt, schnell zu verlieren,
Unterteilen wie mit Mauer deswegen ihr Gut.
.
Schon hat sie sich dunkel getarnt,
Ihre Rüstung übergezogen,
Da beult sie schon wieder am schmalen Ende sich aus
Und treibt eine Hyphe hervor;
Auch sie wird wieder wie ihre Mutter:
In Ketten steh’n sie mit Nachbarn zuhauf.
.
Ihr dünnes Ende wie ein Schwänzchen verlängert,
Entragt dem darunter stehenden Kopf;
Doch zur Zierde sind sie bestimmt nicht geworden,
Nehmen Abschied. Der Wind packt sie beim Schopf.
.
Treibt sie überall hin,
Obwohl sie am Boden geboren,
An Resten von Pflanzen bescheiden sich nährten;
Fliegen trotz ihrer Größe beträchtlich und weit,
Landen, das Fenster zum Lüften stand offen,
An einer feuchten Tapete, in der Dusche, im Bad.
.
Dort fühlt Alternaria[2] sich wohl,
Findet genügend zur Nahrung,
Lebt von Fasern, Resten von Seife, Schuppen und Horn,
Solange Feuchte Zeit dazu lässt,
Genügsam für immer davon.
.
Ärgerlich wird der Duscher im Bad,
Sieht er in Kanten und Ecken
Mächtige Streifen schwarzen Belags;
Schrubbt, entfernt sie, solang er noch kann.
Am Ende wird er zum Messer wohl greifen,
Zu ersetzen das hässliche Altsilicon. –
.
Doch nicht sie allein bewirkt die unappetitlich lästigen Streifen,
Cladosporium[5] hilft gerne noch mit;
Auch seine Konidien wurden vom Wind durch
Spalten ins Zimmer geblasen,
Und nimmt, anstelle von pflanzlicher Streu
Mit menschengemachten Nischen vorlieb.
.
Fußnoten
[1] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände
[2] Alternaria alternata: Pleosporaceae (Pleosporales – Dothidiomycetes – Bitunicate Ascomycota – Inoperculate Ascomycota –…)
[3] Weichmacher: Stoffe, die spröden Materialien zugesetzt werden, um sie weich, biegsam oder dehnbar zu machen, damit sie einfacher zu bearbeiten sind oder bestimmte Gebrauchseigenschaften erreichen; häufig werden Ester der Phthalsäure und der Phosphorsäure eingesetzt.
[4] Silicon(e): Eine Gruppe synthetischer Polymere, bei denen Siliciumatome über Sauerstoffatome verknüpft sind. Es können Molekülketten und/oder Netze auftreten. Die restlichen freien Elektronen des Siliciums sind dabei durch Kohlenwasserstoffreste (meist Methylgruppen) abgesättigt.
[5] Cladosporium spp.: Davidiellaceae; nicht separat behandelt (Capnodiales – Dothidiomycetes – Bitunicate Ascomycota – Inoperculate Ascomycota –…)
Eingestellt am 15. März 2025
.

Alternaria und Cladosporium; Schwärzepilze feuchter Wände (Originale; Reinhard Agerer)
Oben: Mauerförmige, geschwänzte Konidien von Alternaria; Pfeil zeigt auf Bildungsstelle einer Konidie (Kultur)
Unten: Petrischale mit Nähragar befüllt, in einem Raum als Sporenfänger aufgestellt und bei Raumtemperatur anschließend geschlossen stehen gelassen. Die verschiedenfarbigen Kolonien weisen auf unterschiedliche Pilze hin. Pfeile zeigen auf zwei Kolonien von Cladosporium cladosporioides.
Eingestellt am 15. März 2025
.

Pleosporaceae, Vollsporpilze i.e.S.
3 Nicht nur lästig (AP)
.
Solange saprob[1] sie sich geben,
Wirken sie mit im Kreislauf des Lebens:
Zerlegen, was sonst fast ewig bestünde.
Leben davon, werden auch selbst verzehrt.
.
Füllen zu dicht sie den Raum,
Nießen gar viele fast ohne Hemmung;
Nicht nur Pollen, auch Alternarien lösen dies aus,
Bewirken, zwar selten, doch Allergie[2].
.
Dürrfleckigkeit verschied’ner Gemüse,
Ist Alternarias[10] zerstörendes Werk.
.
Steh‘n konzentrisch Pusteln der schwärzlichen Art
Am Rande trockner Ellipsen und Kreise
Und fällt das trockene Auge am Ende heraus,
Weiß der Kenner, wer diese Arbeit getan. –
.
Alternaria genügt, sich clonal[11] zu vermehren,
Büßte Sexualität zur Gänze meist ein.
Warum sie zur Familie Pleosporaceen gehören,
Zeigen eindeutig DNA-Sequenzen uns auf.
.
Fußnoten
[1] Saprotroph, saprob: Von totem, organischem Material lebend
[2] Allergie: Überschießende, krankhafte Abwehrreaktion des Immunsystems auf körperfremde, aber harmlose Umweltstoffe
[3] Tomaten: Solanum lycopersicum (Solanaceae – Solanales – Lamianae – Asteridae – Superasteridae – …)
[4] Paprika: Solanum capsicum (Solanaceae – Solanales – Lamianae – Asteridae – Superasteridae – …)
[5] Auberginen: Solanum melongena (Solanaceae – Solanales – Lamianae – Asteridae – Superasteridae – …)
[6] Möhre, Karotte, Gelbe Rübe: Daucus carota (Apiaceae – Apiales – Campanulanae – Asteridae – Superasteridae –…)
[7] Gartensalat, Kopfsalat: Lactuca sativa (Cichorioideae – Asteraceae – Asterales – Campanulanae – Asteridae –…)
[8] Gemüsezwiebel: Allium cepa (Alliaceae – Asparagales – Lilianae – Liliidae – Dicotyle s.l. –…)
[9] Kohl: Brassica oleracea (Brassicaceae – Brassicales – Malvanae – Rosidae – Superrosidae – …)
[10] Alternaria alternata: Pleosporaceae (Pleosporales – Dothidiomycetes – Bitunicate Ascomycota – Inoperculate Ascomycota –…)
[11] Clonale Vermehrung: Asexuelle Vermehrung (rein mitotisch bedingte Vermehrung, daher Individuen genetisch identisch)
Eingestellt am 15. März 2025
.

Alternaria alternata an Tabak-Blatt
Autor: R.J. Reynolds, Tobacco Company, Bugwood.org
Lizenz: Creative Commons Attribution 3.0 United States license; unverändert
Eingestellt am 15. März 2025
.

Alternaria dauci, Möhrenschwärze (Möhren, Gelbe Rüben, Karotten, Daucus carota)
Oben und rechts unten: Befallene, geschwärzte Blätter
(Original; Thomas Nothnagel, Resistenzprüfungsprojekt des Julius-Kühn-Instituts, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Quedlinburg)
Links unten: Befallene, zu lange und feucht gelagerte Gelbe Rüben.
(Original; Victor Agerer)
Eingestellt am 15. März 2025
.
