1 Bacteria Texte A-L (ohne Viren)
Bakterien bilden zusammen mit Archäen die sogenannten Prokaryoten, weil sie noch keinen echten Zellkern aufweisen, wie dies für Eukaryoten gilt. Wegen ihrer Kleinheit und ihrer einfachen Spaltung, um aus einer Zelle zwei zu bilden – und dies in einer recht kurzen Generationszeit – auch wegen Fehlens oft zeitaufwendiger sexueller Vermehrung, waren Bakterien schon zu frühester Zeit in ihrer Vielfalt die Lebewesen schlechthin für die Besiedlung diversester Habitate. Auch heute noch spielen sie für die Natur und für jeden einzelnen höher entwickelten Organismus eine erhebliche, oft lebenserhaltende, aber auch lebensgefährdende Rolle. Diese Einflussnahme auf die Evolution und auf das Leben generell, wurde lange wegen der Bakterien Kleinheit, die oft kaum ein Tausendstel Millimeter messen, übersehen. Heute werden sie jedoch immer mehr als Grundlage unseres Lebens verstanden. Welch entscheidende Rolle sie nicht nur für den menschlichen Körper spielen, wird immer deutlicher. Das Mikrobiom des Darms, das hauptsächlich aus Prokaryoten besteht, ist buchstäblich in mancher Menschen Mund, wenn es gilt, das Mikrobiom des Darms neu aufzubauen.
Ein Steckbrief mit Wesensmerkmalen charakterisiert die erste Gruppe eigenständig lebensfähiger Bionten (1 Steckbrief). Dabei werden Eigenschaften der Zellwand, der sterilen Hülle um die eigentliche Zelle, in den Blick genommen, wie auch Charakteristika des inneren Baus und der Bakterien Anfälligkeit gegenüber Stoffwechselprodukten anderer Organismen. Diese Zusammenstellung bereitet auf die Unterschiede zu anderen Bionten vor, die an geeigneter Stelle vergleichend hervorgehoben werden. Gemeinschaften von Bakterien (2 Gemeinschaft) bildeten sich, um in einer Art Zusammenwirken Abfallprodukte der anderen zu verwenden. So können einige Heterotrophe, die bezüglich Energie von schwefelhaltigen Mineralien leben, nicht allen Schwefel verwenden. Geben diesen als zunächst in Wasser gelösten, in höherer Konzentration auch gasförmigen Schwefelwasserstoff, H2S, ab, das anderen als Elektronenlieferant dienen kann (2 Gemeinschaft). Genetische Vielfalt zu erreichen und aufrechtzuerhalten, war sicher zu früher Zeit eine wichtige Voraussetzung für die Besiedlung neuer Habitate. Da sexuelle Fortpflanzung noch keine Option war, kam es höchstwahrscheinlich sehr bald zu Übertragung und Austausch von Erbmolekülen, deren Abgabe und Übernahme noch unspezifisch gewesen sein mochten und damit keiner wesentlichen Beschränkung unterlagen, was als Promiskuität aufgefasst werden kann (3 Promiskuität). Durch Unabhängigwerden von organischen Substanzen der näheren Umgebung und Verwendung von Licht als Energielieferant wird es Bionten möglich, weiter entfernte und auch größere Areale zu besiedeln. Um sich erfolgreich über weite Strecken ausbreiten zu können, ist Eigenbeweglichkeit von großem Vorteil (4 Auf zu neuen Ufern). Zwei Neuerungen, die möglicherweise in engem Zusammenhang stehen, kennzeichnen vieler Bakterien Aussehen und Verhalten. Zunächst musste im Laufe der Evolution ein Transportsystem geschaffen werden, das Ionen und Moleküle durch die Lipiddoppelmembran in das Innere der Zelle schleust. Dazu dient auch heute eine Vielzahl sog. Kanäle in Membranen, die von Proteinen umgeben sind. Sie dienen mit Hilfe von ATPasen Energie des ATPs freisetzen, um gegen den Widerstand der Membran und/oder gegen den Widerstand des gegensätzlich geladenen Innenraums, geladene oder ungeladene, Ionen und kleinere Moleküle zu transportieren. Die Mechanik der in mehreren Etagen angeordneten Proteinmoleküle ist einem Trommelrevolver recht ähnlich, denen in Proteintaschen immer wieder Ionen eingefügt, und durch ein Weiterdrehen dann auf der anderen Seite abgesetzt werden. Nur so is es unter Energieaufwand möglich, einen Transport in die Zelle zu gewährleisten. Doch auch für Transportvorgänge nach außen, können solche Kanäle von Bedeutung sein (5 Mit aller Kraft voraus). In ihrem Aufbau recht ähnlich erscheinen die zum Rotieren der bakteriellen Geißel nötigen Motoren. Doch anstelle Ionen und andere Moleküle nach außen zu bringen, wird ein Kanal genutzt, ein spezifischen Proteins, Flagellin, das in der Zelle synthetisiert wird, nach außen zubrinen, wo es schraubenförmig zu einer Hohlröhre zusammengebaut wird. Sie wird an ihrem Ende nach Erreichen der endgültigen Länge geschlossen. An der Basis krümmt dann ein spezielles Protein die Geißel, so dass ihre Schrägstellung eine propellerartige Anordnung bewirkt. Ein Rotieren erfolgt in ähnlicher Weise wie dies für zu transportierende Ionen gilt. Weil aber die Geißel mit den Kanalproteinen fest verbunden ist, dreht sie sich rasch propellerartig und treibt oder zieht das Bakterium voran. Die recht ähnlichen Grundlagen von Transport durch den Kanal und der Geißelbewegung geben Anlass, auf einen gemeinsamen Ursprung der beiden Bauprinzipen zu schließen. Entsprechend der lebenswichtigen Bedeutung von Transportvorgängen, in die und aus der Zelle, kann geschlossen werden, die Etablierung von Transportkanälen war der Prototyp, aus dem sich auch die Geißelbewegung entwickelte. Der Kreationisten Argument der nicht reduzierbaren Komplexität, weil bei Fehlen eines einzigen Bausteins die Geißelbewegung komplett nicht funktionierte (7 Der Streit), kann mit dem schon früher vorliegenden Prinzip der rotierenden Ionentransportbewegung begegnet werden (6 Zum Innehalten). Warum im Laufe der Evolution eigenbewegliche Bakterien entstanden sind, erklärt sich aus der Möglichkeit, damit neue Gebiete zu erreichen, um Nahrung oder einfach nur um bessere Lebensbedingungen zu finden, oder um einschränkender Konkurrenz zu entkommen. Gleichfalls aber kann der energieaufwendige Bewegungsmodus wieder reduziert werden, wenn stationäres Leben sich als ökonomischer erweist. So lässt sich auch die Weiterexistenz von Motoren erklären, obwohl auf die Eigenbeweglichkeit wieder verzichtet wird (7 Der Streit). Auch dies zeigt, selbst bei Einbuße der Beweglichkeit, bei eventuellem Fehlen eines einzigen Bausteins, ist für Bakterien nicht generell alles verloren (7 Der Streit). Ein Modell, wie schnell sich evolutiv Grundsätzliches ändern kann wird am Beispiel von Kohl, Brassica oleracea, dargestellt. Aus einer Grundform dieser Art, haben sich durch des Menschen selektierenden, evolutionsimitierenden Einfluss, unterschiedlichste Sorten ergeben, die sich sogar sexuell fortpflanzen und damit auch als stabile Varietäten, z. B. Brassica oleracea var. gongylodes für Kohlrabi, erkannt werden. Freilich, würde der Mensch seine isolierende Tätigkeit beenden, würden sich unter natürlichen Bedingungen diese Veränderungen wohl nicht erhalten können. Der Mensch schafft aber durch seine Bemühungen diese stabilen ökologischen Nischen, die auch in der Natur als Voraussetzung für ein Bestehenbleiben von Änderungen erforderlich sind (6 Zum Innehalten). Weitere Beispiele für solche vom Menschen hervorgebrachten Veränderungen können diese Tatsache stark untermauern. Ein wesentlicher Faktor für die Geschwindigkeit, mit der sich solche Änderungen manifestieren, ist die Anzahl der Generationen, bzw. die Länge der Generationszeit. Je mehr Generationen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sich Änderungen ergeben und auch durchsetzen. Für Bakterien, die unter guten Bedingungen sich binnen 20 Minuten in ihrer Anzahl verdoppeln können, ist eine evolutive Veränderung schneller zu erwarten, besonders, falls sich ihre Umwelt als sehr heterogen erweist, oder der selektierende Druck sie zu Änderungen gleichsam zwingt. Rezentes Beispiel, wie schnell sich Bakterien an solche evolutiven Drücke anpassen können, ist die Entstehung gegen Antibiotika multiresistenter Vertreter. Dieser Vorgang zeigt, worauf die Evolution gründet und wie schnell Organismen auf neue Herausforderungen reagieren können. Für andere Organismen beträgt die Generationszeit kaum ein halbes Jahr, z. B. für Ratten, ein Jahr für viele Kulturpflanzen und Haustiere, für Menschen, etwa 25-30 Jahre (6 Zum Innehalten). Ein fiktiver Streit zwischen Designisten und Kreationisten einerseits und jenen, die der Tatsache der Evolution anhängen, der verbal, doch auch in Büchern seinen Niederschlag findet, schließt die Einführung zu den Bakterien ab (7 Der Streit).
Eingestellt am 6. April 2024

Bacteria, Bakterien:
1 Steckbrief
.
Lipide[1] bilden doppelte Membranen,
Proteine[8] und andere Substanzen lagern sich dazwischen noch.
.
Bilden ein Enzym[9] nur
Der Helix[10] Holme zart zu trennen.
Nukleotide[13] Kopf an Schwanz zusammenbinden.
.
Lagern sich, falls zart getrennt,
Bei 50S[16] und 30S.
Unzerlegte Ribosomen zeigen sich bei 70S in Summe etwas leichter.
.
Beginnt der Proteine Bau
Mit Transfer-RNA[17],
Startet diese nur und immer
.
Wärme und Kälte im Wechsel, konzentrierte salzige Umgebung
Ließen manche Pioniere vorschnell kollabieren, auch zerplatzen.
Verleiht der Zelle Raum für Leben, Fortbestand und Halt.
.
Binden sich zur Kette, verklammern sich zur Raumstruktur mit
.
Mit dicker Schicht umgeben sich die einen,
Nach Gram[29] gefärbt und nachgespült, gelten sie als positiv.
Nur dünne Lagen formen doch die meisten, sind dafür noch lipidmembranumhüllt[30]:
Wenn sie gut nach Gram gefärbt, nach Spülen dann verblassen, gelten sie als negativ.
Mit resistenten Zuckerketten kapselartig eingehüllt
Schützen manche Zellen so vor Angriff sich, speichern Wasser auch damit.
.
Zum Ärger der Bionten kämpft der Arzt erfolgreich gegen sie
Doch manch ein Stamm wird – ebenso erfolgreich –
Resistent und damit schnell immun. –
.
Des Rätsels Lösung ist – Bakterien!
.
Fußnoten
[1] Lipide (Membranlipide): Stoffe mit zwei verschiedenen Enden, ein fettlösliches (wasser-abweisendes) und ein wasserlösliches, oft phosphatverknüpftes Ende; je nach umgebender Flüssigkeit können sich die Moleküle orientieren und flächige Verbände bilden und auch zu Doppellagen assoziieren, deren wasserabstoßende Seiten zueinander weisen
[2] Hydrophil (Gegensatz: hydrophob): wasserfreundlich
[3] Cholin [(CH3)3N+CH2CH2OH]: ist ein Amin und bildet zusammen mit dem daran gebundenen Phosphat die hydrophile Gruppe des Phospholipids, der Hauptkomponente der Lipidmembranen
[4] Phosphat: An andere Atome oder Moleküle gebundene Phosphorsäure [H3PO4 entspricht O=P(–OH)3]
[5] Glycerin: Dreifachalkohol, [CH2OHCHOHCH2OH], der zwischen Phosphat und den beiden Fettsäuremolekülen des Phospholipids vermittelt; Glycerin gehört noch zum hydrophilen Teil, während die beiden Fettsäureketten hydrophob sind
[6] Hydrophob (Gegensatz: hydrophil): wasserabstoßend
[7] Fettsäuren: Langkettige Kohlenwasserstoffe mit einer Säuregruppe [–COOH] an einem ihrer Enden
[8] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt
[9] Enzym: Protein, das, an spezielle Moleküle angepasst, die Synthese katalysiert.
[10] Helix Holme: gemeint ist hier Die DNA ist aus zwei komplementären, leiterförmig angeordneten Strängen, deren Sprossen durch die gegenüberliegenden Basen A und T, bzw. G und C gebildet werden; diese Stränge sind selbst wiederum verdrillt
[11] Ribonucleasen (RNasen): zerschneiden RNA
[12] DNA (=DNS): Desoxyribonucleinic Acid, Desoxyribonukleinsäure, eine reduzierte Ribose; Baustein der Erbinformation
[13] Nucleotide: Desoxyribonucleosid- bzw. Ribonucleosidtriphosphate (ATP, TTP, CTP, GTP, UTP)
[14] Ribosom: Organell aus ribosomaler RNA und Proteinen. Es dient zur Translation der mRNA-Informationen in Proteine. Meist sind mehrere Ribosomen über die mRNA kettenartig verbunden, um zugleich mehrere Ablesevorgänge hintereinander ablaufen lassen zu können
[15] Ribosomale RNA (rRNA), verknäuelt sich unter Beteiligung von Proteinen zum Ablesegerät (Ribosom) der tRNAs, um Aminosäuren zu Proteinen zu verknüpfen
[16] 50S, 30S, 70S: Die Abkürzung S ist die Sedimentationskonstante beim Zentrifugieren von Teilchen. Je größer die Konstante, umso schwerer sind sie. Die bakteriellen Ribosomen, aus zwei ungleichgroßen Untereinheiten zusammengesetzt, sind mit 70S schwerer als die separierten Teile, mit den Größen 30S und 50S. Dass die Summe der beiden Untereinheiten 70 und nicht 80 ergibt, liegt an der größeren relativen Oberfläche der Einzelteile im Vergleich zur Doppelstruktur
[17] Transfer-RNAs (tRNAs): Übersetzen die Informationen der mRNA in die verschiedenen Aminosäuren
[18] Formyliertes Methionin: Das Methionin, eine Aminosäure, trägt, wenn formyliert, am Stickstoff noch einen Formylrest (–CHO), eine Aldehydgruppe
[19] Methionin: Schwefelhaltige Aminosäure
[20] Murein: Zellwand fast aller Bakterien, in der kettenförmig verbundene Zuckermoleküle, an denen Ammoniumgruppen (–NH2) hängen und diese wieder mit verschiedenen Molekülen verknüpft sind. Diese Ketten sind noch durch kurze Folgen von Aminosäuren verbunden und ergeben so einen sehr stabilen Sack um die Zelle
[21] Osmostress: Osmose ist die Diffusion eines Lösungsmittels (z. B. Wasser) durch eine für eine bestimmte Substanz nur in einer Richtung durchlässige Membran. Ziel der Diffusion des Wassers ist es, einen Konzentrationsausgleich zwischen den beiden durch die Membran getrennten Räume zu erreichen. Ist z. B. die Salzkonzentration innerhalb einer Zelle höher als außen, so wird so lange Wasser in die Zelle aufgenommen, bis es zu einem Konzentrationsausgleich kommt. Ist die Salzkonzentration innerhalb der Zelle niedriger, so wird Wasser nach außen entweichen. Als Folge würde sich im ersten Fall die Zelle ständig vergrößern, bis sie unter Umständen sogar platzt, im zweiten Fall würde sie kollabieren. Zumindest das Zerplatzen infolge des Osmosestresses kann durch eine widerstanderzeugende Zellwand verhindert werden.
[22] Glucose: Ringförmiger Zucker mit sechs [C]-Atomen [C6H12O6]; der Ring besteht aus fünf [C]-Atomen und einem Sauerstoffatom; das restliche [C]-Atom hängt als [–CH2OH]-Gruppe an einem dem Sauerstoff benachbarten [C]-Atom; vier [–OH]-Gruppen stehen an [C]-Atomen des Rings
[23] Amin: Derivat (= Abkömmling) des Ammoniaks [NH3], wobei ein, zwei oder drei Wasserstoffatome durch eine Kohlenstoffverbindung ersetzt sind, z. B [H3C-NH2]
[24] Seitengruppen (von Molekülen): An einer Hauptkette (oder Hauptring) eines Moleküls können verschiedene Seitengruppen (oft als funktionelle Gruppen), z. B. [–CH3], [–CH2OH], [–NH2], [–CHO] oder [–COOH] hängen
[25] Milchsäurerest: [CH3CHOHCO–]; Milchsäure: [CH3CHOHCOOH]
[26] Essigsäurerest: [CH3CO–]
[27] Peptide: Kurze Ketten aus (verschiedenen) Aminosäuren.
[28] Bionten: Allgemeine Bezeichnung für Lebewesen
[29] Gram-Färbung: Eine Methode, Bakterien anzufärben, die der dänische Arzt Hans Christian Gram entwickelt hatte, um Bakterien nach Farbreaktionen einzuteilen. Dabei werden die Bakterien zunächst mit Kristallviolett und Jod angefärbt und anschließend mit Ethanol ausgewaschen und nochmals mit Safranin oder Fuchsin gefärbt. Gram-positive Bakterien sind danach purpur gefärbt, Gram-negative pinkfarben.
[30] Lipidmembran: Lipide, bestehend aus einem mit drei Hydroxylgruppen [–OH] versehenen Glycerinmolekül, an dem zwei Fettsäuren und ein Cholin unter Wasserabspaltung angeknüpft sind, zeigen einen hydrophilen Kopf (Glycerin und Cholin) und den hydrophoben Fettsäureschwanz. Nach dem Motto Gleich zu Gleich gesellt sich gern, ordnen sich die hydrophilen Köpfe zum einen und die hydrophoben Schwänze zum anderen nebeneinander an und bilden eine geschlossene Schicht. Eine Doppelmembran entsteht dann, wenn sich zwei solcher Schichten, hydrophobe Schwänze zueinander gereckt, aneinanderlegen
[31] Streptomycin: Antibiotikum, das heute zum Bekämpfen von Bakterien verwendet wird
[32] Chloramphenicol: Antibiotikum, das heute zum Bekämpfen von Bakterien verwendet wird
Eingestellt am 6. April 2024
.

Murein (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer)
Schräg in der Mitte des Bildes zeigen parallele Stränge den Aufbau des Mureins aus regelmäßig über Sauerstoffbrücken (rot) verknüpften Zuckern, N-Acetyl-Glucosamin (moosgrün) und N-Acetyl-Muraminsäure (ocker). Kurze Peptide verbinden benachbarte Muraminsäuren in lockerer Folge. Peptide sind jeweils (ausgehend vom Zucker) aus L-Alanin (hellgrün), D-Glutaminsäure (dunkelgrün), Diaminopimelinsäure (blaugrün) und D-Alanin (hellgrün) aufgebaut. Der Sauerstoff im Zucker (rot) ermöglicht einen Einblick, an welche Kohlenstoffatome die Zucker und Peptide verknüpft sind. Die beteiligten Moleküle sind in Atomdarstellungen an den Seiten des Bildes detailliert gezeigt und mit den entsprechenden, oben erwähnten Farben hinterlegt: links oben das Peptid, rechts oben die einzelnen Aminosäuren, linke Mitte als einzelne Zucker, rechts unten verknüpft. Links unten ist ein verkleinerter Mureinausschnitt dargestellt, rechts fast mittig drei Mureinschichten übereinander. Freistehende Peptide deuten die Verknüpfung zwischen den einzelnen Schichten an. (Angelehnt an Slonczewski und Foster 2012, Abb. 3.17)
Eingestellt am 6. April 2024

Bacteria, Bakterien:
2 Gemeinschaft
.
An Ufern des Wassers mit steinigem Abhang
Und felsigen Höhlen voll schmutzigen Abfalls
– Aus Resten landnah schwimmendlebender Zellen –
Schweben vielerlei licht- und nahrungsuchende Wesen.
.
Aus Schichten mit Schlick bewegen stinkende Gase
Zuvor noch glatte, ruhig liegende Flächen,
Verpesten die Luft mit schwefelwässrigem Stoff[1]:
Ungenutzte Ressourcen gehen perlend verloren.
.
In der faulenden Masse walten Heterotrophe[2],
Verwenden Proteine[3] abgestorbener Zellen.
Das Zuviel des Schwefels lassen achtlos sie liegen,
Doch gasperlender Schwefelwasserstoff wird Nahrung den andern.
.
In lichtexponierten, gasgekräuselten Wassersystemen
Orientieren sich schwebend grüne Schwefelbionten[4],
Um mit Licht Chlorophylls Porphyrinelektronen[5]
Zur Arbeit zu bringen, so Ladungslücken zu bilden.
.
Leerstellen warten wieder auf Füllung!
Entziehen H2S nun gleichfalls Elektronen[6],
Oxidieren es so zum Schwefelmolekül[7].
.
Versiegen Schwefelwasserstoffquellen,
Oxidieren fremde Bionten molekularen Schwefel,
Liefern Schwefeltetroxid[10] sulfatabhängigen Zellen,
Energiereserven zu bilden, Speicher zu füllen.
.
Abhängigkeiten unterschiedlichster Gruppen
In ersten ökologischen Nischen
Sind Stärke, nicht Schwäche, früher Evolution,
Denn Schwefelbionten leben recht gut in dieser Situation.
.
Vergesellschaftung unterschiedlich wirkenden Lebens
Bringt optimalen Wertschöpfungsgewinn:
Kein kostbares Gut geht ungenutzt seiner Wege,
Der Kreislauf der Stoffe nimmt Enden erneut zum Beginn.
.
Eine Gemeinschaft einander ergänzender Lebensstrategen
Gilt allen als vielversprechend, als Synergismus erzeugende Weise.
Doch Schlüssel und Zukunftshoffnung ist
Fotosynthetisch erzeugtes Kohlenhydrat.
.
Fußnoten
[1] Schwefelwasserstoff, H2S: [H-S-H], ein geknicktes Molekül mit mittigem Schwefel
[2] Heterotrophe: Darunter werden alle Organismen subsumiert, die für ihr Leben auf bereits vorhandene organische Substanzen angewiesen sind
[3] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt
[4] Grüne Schwefelbionten, Grüne Schwefelbakterien: sind einzellige, phototrophe, obligat anaerobe Bakterien mit verschiedenen äußeren Formen, ohne aktive Bewegung.
[5] Porphyrinelektronen: Elektronen des Porphyrinringsystems im Chlorophyll
[6] Elektronen: Negativ geladene Bestandteile von Atomen, die den positiv geladenen Atomkern umgeben. Sie sind an den Atomkern gebunden und bilden die sogenannte Elektronenhülle des Atoms
[7] Schwefelmolekül, [S2]: Elementarer Schwefel, der als Molekül aus zwei Atomen Schwefel besteht; (16S), besitzt sechzehn Protonen; 16 Neutronen kommen noch hinzu. (16S, Anzahl der Protonen = Ordnungszahl 16)
[8] Chlorophyll (Bakterienchlorophyll): „Bakteriengrün“, bestehend aus Porphyrinringsystem mit angehängter Kohlenstoffkette. Es unterscheidet sich vom „Blattgrün“ durch bestimmte Seitenmoleküle am Porphyrinringsystem
[9] Photonen: Lichtquanten, oder Lichtteilchen, aus denen Lichtstrahlung besteht
[10] Schwefeltetroxid (SO42-): Eine maximal oxidierte Schwefelverbindung mit vier Atomen Sauerstoff; liegt als zweifach negativ geladenes Ion vor
Eingestellt am 6. April 2024

Gemeinschaft macht stark (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer)
Eingestellt am 6. April 2024
.

Bacteria, Bakterien:
3 Promiskuität
.
Ringförmig lagern verschlungen Chromosomen[1] im Zentrum.
Sich im Zentrum vereinend, trennt sie die Zelle in gleichgroße Räume,
Chromosomen in zufälligen Raten verteilend.
.
Zuletzt bricht die mitwachsende Zellwand mittig entzwei.
Die anfangs vereinten Zellen gehen bald eigene Wege,
Um allein sich zu nähren, sich erneut zu vergrößern
Und, wiederholt sich spaltend, ihre Zahl zu erhöhen.
.
Die Zeit für Wachstum, für Teilung und Trennung
Ist kurz bei günstiger Umwelt und guter Ernährung:
Kaum dreißig Minuten bis zum Verdoppeln; bei manchen genug,
In wenigen Tagen Massen zu bilden so riesig wie unser Planet.
.
Ungünstig noch die damalige Zeit, um zu leben.
Bakterien breiten sich aus, noch freie Bezirke zu finden,
Passen sich an als genügsame Wesen;
Ihr Wissen gespeichert in schraubigen Ringen der DNA.
.
Mehrfach verändert im Chromosom, treffen Bakterien nah oder fern ihrer Heimat
Fremde Gesellen mit gleichfalls mutiertem Genom,
Nehmen freie Fragmente bereitwillig in ihr eigenes Chromosom,
Bauen sie ein, verändern das Erbgut durch Transformation[4].
.
Andere wiederum bleiben gezielt
An der klebrigen Flanke des Nachbarn,
Schieben heraus, umgehend hinein
In den Partner den gestreckt nun liegenden Faden der DNA.
Etabliert sind auf schonende Weise
Die ersten noch zarten geschlechtlichen Reize,
Und wer sich auch zufällig trifft,
Nimmt gerne neu gestaltete Gene mit sich.
.
Vielleicht half Jeder Jedem zur damaligen Zeit,
Um so zu erhöhen den Wert genetischer Information
Für Modifizierung und Anpassung an neue,
Herausfordernde Nischen der Evolution.
.
Transfer von Genen von Nachbar zu Nachbar
Wird bald schon zum Motor der Evolution.
Auch noch Milliarden Jahre danach
Spricht man von horizontalem Transfer genetischer Information[5].
.
Fußnoten
[1] Chromosom: Genetische Informationseinheit aus unterschiedlichen Mengen DNA diverser Basensequenzen; Bei Bakterien sind die DNA-Helices zu Ringen geschlossen
[2] Cytoplasma: Flüssiger Zellinhalt mit darin liegendem Cytoskelett
[3] Lipiddoppelmembran: Lipide, bestehend aus einem mit drei Hydroxylgruppen [–OH] versehenen Glycerinmolekül, an dem zwei Fettsäuren und ein Cholin unter Wasserabspaltung angeknüpft sind, zeigen einen hydrophilen Kopf (Glycerin und Cholin) und den hydrophoben Fettsäureschwanz. Nach dem Motto Gleich zu Gleich gesellt sich gern, ordnen sich die hydrophilen Köpfe zum einen und die hydrophoben Schwänze zum anderen nebeneinander an und bilden eine geschlossene Schicht. Eine Doppelmembran entsteht dann, wenn sich zwei solcher Schichten, hydrophobe Schwänze zueinander gereckt, aneinanderlegen
[4] Transformation: Direkte Aufnahme von DNA durch andere Organismen.
[5] Horizontaler Gentransfer: Im Gegensatz zum vertikalen Gentransfer (von einer Generation zur anderen) wird beim horizontalen Gentransfer genetisches Material, DNA-Bruchstücke, auf andere Individuen, andere Arten oder sogar auf andere Organismengruppen übertragen. Dies kann direkt erfolgen (Transformation) oder mit Fremdhilfe
Eingestellt am 6. April 2024
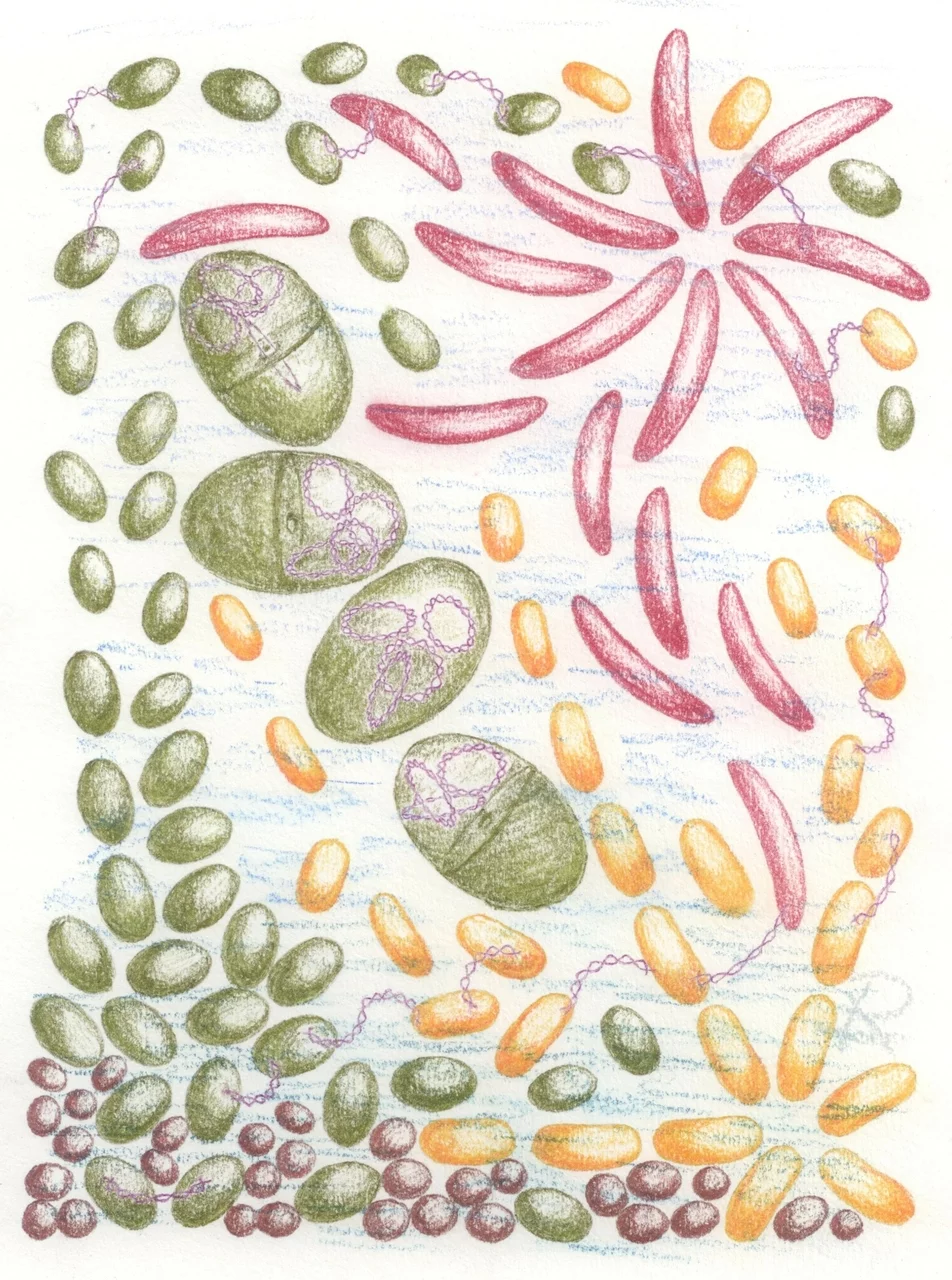
Jede mit Jeder (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer)
Diversität von Bakterien, vermittelt durch unterschiedliche Größen, Formen und Farben (Einzelzellen der Bakterien sind grundsätzlich farblos, in dichten Kolonien können sie aber Farben zeigen). Violett werden DNA-Helices gezeigt, die von Zelle zu Zelle reichen; doch bei so großen Abständen zwischen Spender und Empfänger würde in der Natur die Transformation nicht gelingen. Zwischen gleichen und ungleichen Zellen wird ein DNA-Transfer angedeutet. Die stark vergrößerten grün dargestellten Zellen zeigen ringförmige DNA und deren mögliche ungleichmäßige Verteilung im Zuge der Tochterzellbildung.
Eingestellt am 6. April 2024
.

Bacteria, Bakterien:
4 Auf zu neuen Ufern
.
Viele Bionten[1] kleben an Ort und Stelle ausdauernd fest,
Doch Hunger treibt sie nach Nahrung, Freiheit und Licht.
Unglaublicher Vorteil, geläng‘ ein Absondern,
Um der Nachbarn Konkurrenz zu entflieh‘n!
.
Zwei Wege, raffiniert der eine, wie der andere,
Gingen allmählich sie Schritt für Schritt,
Dicht schon besetzten Raum zu vermeiden:
Eilen schraubend, andere treibend, neuen Quellen entgegen.
.
Fußnote
[1] Bionten: Allgemeine Bezeichnung für Lebewesen
Eingestellt am 6. April 2024
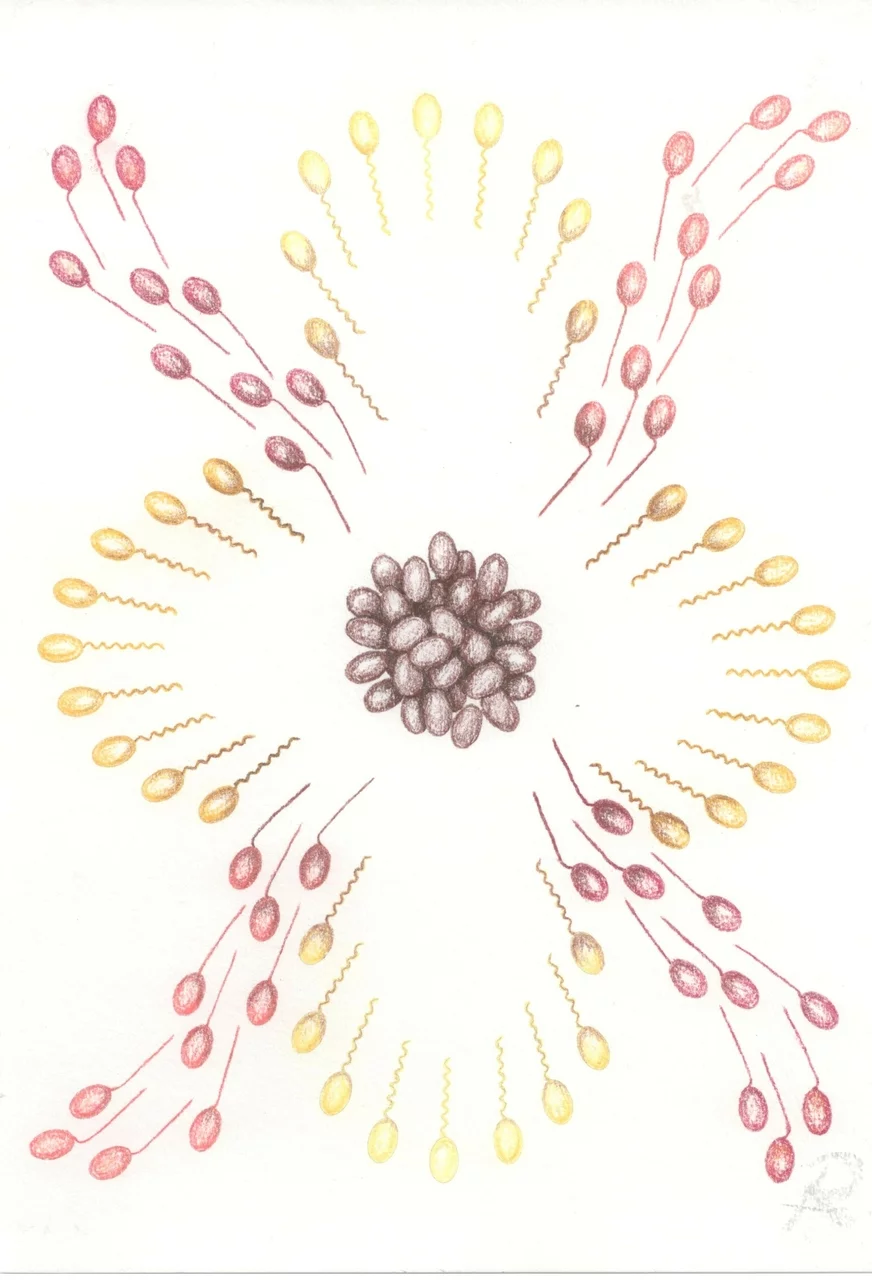
Freiheit! (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer)
Fort streben sie alle, wer ein Flagellum besitzt
Eingestellt am 6. April 2024
.

Bacteria, Bakterien:
5 Mit aller Kraft voraus
.
Der Bakterien äußere Doppelmembran[1]
Gilt als abwechslungsreiche Hülle.
Proteinkomplexe[2], Miniporen eng umgebend, kontrollieren hochspezifisch
Molekültransporte zwischen Außen- und dem Innenraum.
.
Unersetzlich sind Protonenpumpen[3]:
Häufen dadurch positive Ladung[6] außen,
Folglich negative innen an.
.
Diesem Gradienten folgend, wandern positiv gelad‘ne Ionen in das Innere der Zelle
Versorgen damit es mit ladungspositiven Elementen:
Ladungsfreie Moleküle wählen, in der Zelle Zentrum zu gelangen, rückkehrwillige Protonen.
.
Über viele Hunderte von Pforten wachen diese Proteine.
Aus- und Eingang sind geregelt.
Zucker, Säuren und Peptide[10],
Stehen auf der Zelle Aus- und Eintauschliste an.
.
ATP, zentral in diesem Tauschverkehr, nutzt ATPase[11], sein Enzym.
Stockwerkartig hochgetürmt, kontrolliert ein ausgesuchter Satz Peptide,
Die Kanäle[12] fest umgebend, ATPs Bindungsenergie verwendend,
Mengen, auch Transport sich selbst genügender Protonen.
.
Mittig zum Kanal gebracht,
Rasch in trommelrevolvergleiche Fächer aus Peptid gedrängt,
Wird, den Ring des Rades kurz um einen Klick gedreht,
Das Ion schon ausgeliefert, andernseitig abgesetzt. –
.
Des Enzymes Rad dient nun als Modell,
Den motorengleichen Antrieb der Bakterien zu versteh‘n,
Der rotierend bringt Bionten[13] rasch voran,
Um Neuland zu erkunden, Gefahren zu entgeh’n:
.
Ein Transportvehikel dieser Art
War vielleicht die Basis der Motoren:
Klickend dreh‘n sich Ringe, eingespannt in Wand und die Membran,
Flagellin[14] hinauszubringen, der Bionten Geißelprotein.
.
Gramnegative[15], sowie Grampositive
Agieren oft mit ATP-getriebenen Motoren,
Um Flagellen wie Propeller zu bewegen.
Unterschiedlich aber sind die Antriebspeitschen in der Wand vertäut.
Vier der Ringe leisten sich Gramnegative:
Zwei der Ringe eingefügt der inneren Membran[16],
Grampositive brauchen allerdings nur zwei.
.
Ungezählte Moleküle Flagellin,
Stück für Stück nach außen durch die Ringe transportiert,
Lagern sich zur hohlen Röhre
– Bis zum Schluss als Schlauch benutzt –
Eng am fernsten Ende dicht zusammen,
Um das hohle Multiprotein,
Nun der Zelle angehängt,
Als Paddel[19] zu schwingen im Kreis.
.
Gestreckt noch steh‘n die Geißeln von den Zellen.
Ein Haken wird der Basis aber schon geformt,
Gibt der Peitsche[20] einen schrägen Winkel.
Nun in Gang noch den Motor gesetzt, treiben sie die Zellen schnell voran.
Kraftvoll sind Bionten selbstbeweglich,
Noch fehlt die Steuerung jedoch für zielgenaues Orientier‘n. –
.
Vehement bestreiten gegenwärtig Designisten[21]
Eine Schritt für Schritt Entwicklung ihres Triebs,
Betrachten es als Fertigteil des Schöpfers,
Nicht als Resultat der gottgewollten Evolution.
.
Fußnoten
[1] Zellumgebende Lipiddoppelmembran: Gramnegative Bakterien umgibt nur ein dünne Mureinschicht, die aber nach außen hin noch von einer Lipiddoppelmembran, mit Einschlüssen, umhüllt ist.
[2] Proteinkomplexe: Proteine sind häufig zu Komplexen vereint, wobei sich die einzelnen Proteine sich oft in Bau, Eigenschaften und Funktion unterscheiden
[3] Protonenpumpen: Transmembranproteine, die die positiv geladenen Protonen gegen einen elektrochemischen Gradienten transportieren
[4] ATP: Adenosin-tri-phosphat; bestehend aus Ribose und Adenin; Ribose trägt an seiner nicht in den Zuckerring einbezogenen Kohlenstoffgruppe drei hintereinander liegende Phosphatgruppen. Diese lineare Anordnung der Phosphate hat zur Folge, dass das dritte, äußerste Phosphat, mit seiner ihm dadurch innewohnenden Energie, diese leicht unter Abspaltung auf andere Moleküle übertragen kann
[5] Protonen: das positiv geladene (elektronennackte) Wasserstoffatom
[6] Positive Ladung: Fehlt einem Atom, einem Molekül, ein Elektron (oder mehr) so ist die positive Ladung der Protonen des betreffenden Atoms nicht ausgeglichen; das Atom, das Molekül, erscheint deswegen positiv geladen
[7] Calcium: als Ion doppelt positiv geladen, Ca++
[8] Magnesium: als Ion doppelt positiv geladen, Mg++
[9] Kalium: als Ion einfach positiv geladen, K+
[10] Peptide: Kurze Ketten aus (verschiedenen) Aminosäuren.
[11] ATPase: Enzym, das ATP unter Energieweitergabe in ADP und P spaltet; die Endung -ase kennzeichnet ein Protein als Enzym
[12] Kanäle, Membrankanäle: in den Lipiddoppelmembranen werden von bestimmten Proteinen feinen Kanäle gebildet, durch die verschiedene Substanzen transportiert werden können
[13] Bionten: Allgemeine Bezeichnung für Lebewesen
[14] Flagellin: Globuläres Protein, das sich zu vielen selbst zu einem Hohlzylinder anordnet und im westlichen das Flagellum der Prokaryoten (Bakterien und Archäen) bildet
[15] Gram-Färbung: Eine Methode, Bakterien anzufärben, die der dänische Arzt Hans Christian Gram entwickelt hatte, um Bakterien nach Farbreaktionen einzuteilen. Dabei werden die Bakterien zunächst mit Kristallviolett und Jod angefärbt und anschließend mit Ethanol ausgewaschen und nochmals mit Safranin oder Fuchsin gefärbt. Gram-positive Bakterien sind danach purpur gefärbt, Gram-negative pinkfarben.
[16] Innere Lipiddoppelmembran: Lipiddoppelmembran, die jedes Organismus‘ Zellinneres umgibt; im Gegensatz zur zellumgebenden Lipiddoppelmembran Gramnegativer Bakterien
[17] Murein: Zellwand fast aller Bakterien, in der kettenförmig verbundene Zuckermoleküle, an denen Ammoniumgruppen (–NH2) hängen und diese wieder mit verschiedenen Molekülen verknüpft sind. Diese Ketten sind noch durch kurze Folgen von Aminosäuren verbunden und ergeben so einen sehr stabilen Sack um die Zelle
[18] Zellumgebende Lipiddoppelmembran
[19] Flagellum, Geißel (Bakteriengeißel): Aus vielen globulären Flagellinproteinen zusammengesetzte Hohlröhre
[20] Flagellum, Geißel (Bakteriengeißel)
[21] Designisten („Intelligent Design“): Designisten glauben, Gott hätte einen Grundbauplan erschaffen, zum Beispiel den Typ Vogel, der sich dann weiterdifferenziert und -entwickelt hätte
Eingestellt am 6. April 2024

Modell einer ATPase getriebenen Protonenpumpe (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer)
Dargestellt ist eine pflanzliche Protonenpumpe. Der etagierte Aufbau aus verschiedenen Proteinen ist deutlich zu erkennen, auch das trommelrevolverartige Rad (grün), aus dem die Protonen entlassen werden. Die ATP-Hydrolyse findet unter Zusammenwirken der zwei Mal drei Köpfchen statt, wodurch das zentrale Stielchen (hellgrün) durch Konformationsänderung seines Proteins, das Rad drehen wird und so das Proton transportiert. – Nach Lüttge U, Kluge M (2012) Botanik. Die einführende Biologie der Pflanzen. 6. Auflage. WILEY-VCH, S. 52.
Eingestellt am 6. April 2024
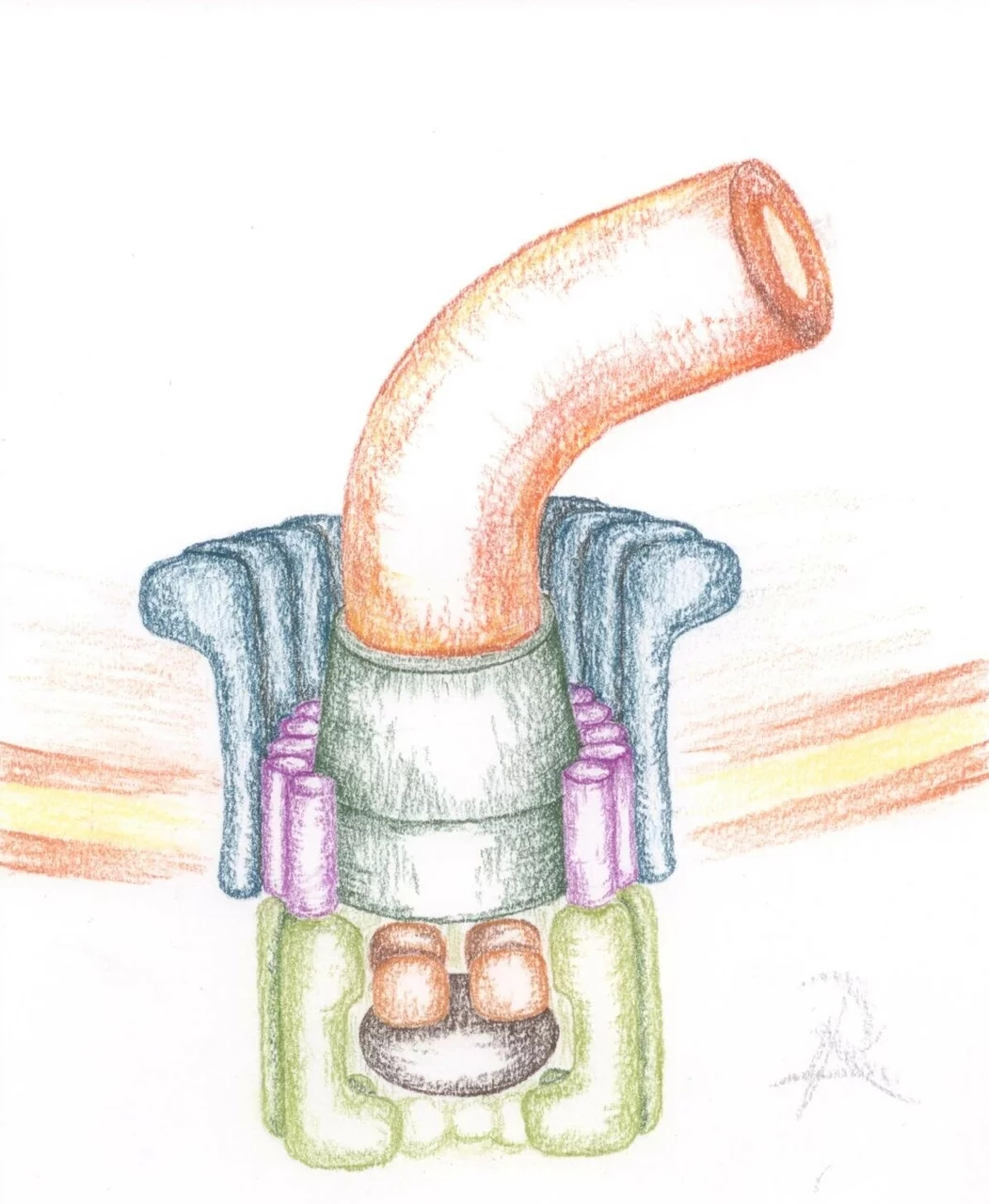
Motor der bakteriellen Flagellen (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer)
Der untere, in Hellgrün gehaltene Ring liegt cytoplasmaseitig, während der darüberliegende Ring mit seiner Basis (die violetten Zylinder deuten dies an) in der inneren Doppellipidmembran fixiert ist. Zwei Rotorenräder sind dabei beteiligt: Die violetten Zylinder für den Antrieb, die den etagierten Ring der Flagellenbasis (mittelgrün) umgeben und die ebenfalls kranzförmig angeordneten dunkelgrünen, hakenförmigen Proteine, die den Motorenkomplex in der Membran verankern. Der zentrale Schaft ist fest mit dem bewegungsaktiven Rotor (violette Zylinder) verbunden; so wird der zentrale Schaft durch die Motorproteine über ATPasen angetrieben. „Die beiden in der Membran verankerten Ringe (dunkelgrün, violett) bilden Ionenkanäle, durch die Protonen fließen, die Energie für die Drehung erzeugen. Im Flagellenmotor wird so die elektrochemische Energie des transmembranen Gradienten in mechanische Energie umgewandelt. Nach dem gleichen Prinzip funktionieren bakterielle ATP-Synthasen, die ebenfalls einen Ionengradienten zur Erzeugung eines Drehmomentes nutzen.“ – Nach Munk K, ed. (2008) Mikrobiologie. Thieme, S. 46. Schema der Flagellenbasis eines Gramnegativen Bakteriums, abgewandelt für ein Grampositives Bakterium, das nur die beiden unteren in der inneren Doppellipidmembran liegenden Ringe (Motorringe) besitzt.
Eingestellt am 6. April 2024
.

Bacteria, Bakterien:
6 Zum Innehalten
.
Unseres Planeten Leben, vielfältig und artenmächtig,
Ändert sukzessiv in kleinen Schritten sich:
Durch Menschenhand, des Züchters ausgeklügelte Methoden,
Auch durch Druck und Konkurrenz, des Nachbarn Dasein zu bedrängen.
.
Wie veränderlich so manche Art, zeigt uns der bekannte Kohl[1]:
Des Grünkohls[9] angepasste Brüder
Sahen noch vor Hunderten von Jahren Blatt für Blatt sich gleich.
.
Manchen reichen tausend Jahre, oft nur Hunderte davon,
Um der Formen Vielfalt zu kreieren.
.
Mitentscheidend wirkt der Sippen Lebenslänge:
Ein Jahr bei Kohl, Tomaten, Weizen und Karnickeln[16];
Zwei Jahre gut bei Katzen, Hühnern, Hunden, Pferden.
Doch bei winzigen Bakterien ist sie kaum die Hälfte einer Stunde.
.
Der Generationen Zahl entscheidet aber
Wie schnell sich manche Eigenschaften ändern.
Dazu kommt noch der Umwelt wechselvolle Wirkung und
Der neuen oftmals harschen Siedlungsräume Härte.
.
Schnelle Folge, rasch veränderliche Gene,
Helfen nur den Fittesten fürs Überleben,
Doch mit der Umwelt angepassten Fähigkeiten
Können sie dem Druck der Konkurrenten hoffnungsvoll begegnen.
.
Eine Milliarde Jahre und noch mehr,
Zehntausend Milliarden Generationen
Waren den Bakterien gegeben,
Neue Wesenszüge zu entwickeln! –
.
Zeit war wohl genug, den effektiven Antrieb zu bekommen,
Pumpenmoleküle[17] umzufunktionieren und als Rotorblätter zu verwenden,
Denn manches Protein der Geißelbasis
Wirkte früher für Protonen- und Magnesiums Transport.
.
Fußnoten
[1] Kohl: Brassica oleracea (Brassicaceae – Brassicales – Malvanae – Rosidae – Superrosidae – …)
[2] Blumenkohl, Karviol: Brassica oleracea var. botrytis
[3] Kohlrabi: Brassica oleracea var. gongylodes
[4] Wirsing: Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda
[5] Blaukraut, Rotkohl: Brassica oleracea convar. capitata var. rubra
[6] Weißkraut, Weißkohl: Brassica oleracea convar. capitata var. alba
[7] Rosenkohl: Brassica oleracea var. gemmifera
[8] Brokkoli: Brassica oleracea var. italica
[9] Grünkohl: Brassica oleracea var. sabellica
[10] Hauspferd: Equus caballus (Hippomorpha – Mesaxonia – Ungulata – Übrige Laurasiatheria – Laurasiatheria – …)
[11] Haushund: Canis lupus familiaris (Cynoidea – Caniformia – Carnivora s.s. – Carnivora s.l. – Euarchonta – …)
[12] Hauskatze: Felis catus (Felis-Gruppe – Feloidea – Feliformia – Carnivora s.s. – Carnivora s.l. – …)
[13] Haushuhn: Gallus gallus domesticus (Gallini – Phasianinae – Phasianidae – Galliformes – Galloanseres – …)
[14] Saatweizen: Triticum sativum (Triticeae – Poideae – BOP-Verwandtschaft – Poaceae – Poineae – …)
[15] Tomaten: Solanum lycopersicum (Solanaceae – Solanales – Lamianae – Asteridae – Superasteridae – …)
[16] Karnickel, Hauskaninchen: Oryctolagus cuniculus forma domestica (Leporidae – Lagomorpha – Glires – Euarchontoglires – Boreoeutheria – …)
[17] Pumpenmoleküle: Transmembranproteine, die positiv geladene Ionen gegen einen elektrochemischen Gradienten transportieren
Eingestellt am 6. April 2024

Des Kohls vielfältiges Gesicht (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer)
Verschiedene Teile der Kohlwildform (Brassica oleracea, rechts oben hinten) wurden durch Züchtung verändert. Blaukraut, Rotkohl: Blätter dichtest zum Kopf geschichtet und blau/rot durch Anthocyane gefärbt (unten Mitte); Kohlrabi: basale Sprossteile zur Knolle umgebildet (in einer blauen Form links des Blaukrauts, in grüner Form darüber); Rosenkohl: seitliche Triebe der Blattachseln wurden zu dichtgeschichteten kleinen Köpfchen (schräg von rechts unten nach links oben); Blumenkohl, Karviol: eine gestauchte, dicht veräselte, steril gebliebene Sprossachse wird von großen basalen Blättern umgeben (rechts neben Rosenkohl).
Eingestellt am 6. April 2024
.

Bacteria, Bakterien:
7 Der Streit
.
An der Bakterien Motor kam die Kontroverse erst in Fahrt!
Würde nur ein winzigst Teilchen fehlen
Wäre er bewegungslos und ohne Triebfunktion.
.
Der Motor sei deshalb von Anfang an
Von dir als Ganzes konstruiert und auch erschaffen:
Ihr Argument für deine Schöpfungsmacht
Und zugleich Negation von dir gewollter Evolution.
.
Manche der Bakterien verzichten wieder auf Flagellen[3],
Die Motoren jedoch bleiben integriert
Unbeweglich sind sie nun, wozu dann der Motor?
.
Sind sie nun vielleicht Verbindungen zur Außenwelt:
Den neu geöffneten Kanal
Für Schnelltransport und für Kontrolle sinnvoll nutzend?
.
O Gott, dein eigentliches Ziel war sicher nicht
Der endlos Zahl Bakterien Beweglichkeit.
Viel Größ‘res sollte deine Schöpfung noch zu Wege bringen!
Deine Ebenbilder und der Kreaturen Wunsch, dich als Schöpfer zu erkennen.
.
Wer also denkt und glaubt,
Gott würde auf dem Weg zum eigentlichen Ziele
Auf dem Nebenpfad zum Streit uns etwas konstruieren,
Der kennt vielleicht am Ende Gottes Größe nicht.
.
Und doch durchdringt sein Geist
Neutrinogleich all das, was damals schon entstand.
Bloß anders als Neutrinos[8], verweilt er zeitgleich überall,
Um Kraft und Zukunft auch dem Kleinsten schon zu geben.
.
Fußnoten
[1] Designisten („Intelligent Design“): Designisten glauben, Gott hätte einen Grundbauplan erschaffen, zum Beispiel den Typ Vogel, der sich dann weiterdifferenziert und -entwickelt hätte
[2] Nichtreduzierbare Komplexitat: Designisten (und Kreationisten) nehmen gerne für ihre Ansichten äußert komplexe Organe dafür als Beispiel, deren Funktion vollkommen zusammenbräche, würde nur ein entscheidender Baustein fehlen. Sie vergessen dabei jedoch, dass der komplexe Bau nach und nach erst entstanden ist und auch funktionell sich weiterentwickelt hat. Nur wer davon ausgeht, alles wäre schon so seit jeher existent, kann daher von einer nichtreduzierbaren Komplexität sprechen, weil, nicht verwunderlich, die Funktion beeinträchtigt wird oder gänzlich ausfällt, wenn ein entscheidendes Teil fehlt. So wie ein Auto nicht fährt, fehlen z. B. Räder. Der Bakterien Flagellen und das menschliche Auge dienen meist der Argumentation.
[3] Flagellum, Geißel (Bakteriengeißel): Aus vielen globulären Flagellinproteinen zusammengesetzte Hohlröhre
[4] Mureinsacculus: Der Bakterien Murein umgibt die Zelle sackähnlich durch der Zellwand widerstandsfähige, massive Konstruktion
[5] Lipidmembran: Lipide, bestehend aus einem mit drei Hydroxylgruppen [–OH] versehenen Glycerinmolekül, an dem zwei Fettsäuren und ein Cholin unter Wasserabspaltung angeknüpft sind, zeigen einen hydrophilen Kopf (Glycerin und Cholin) und den hydrophoben Fettsäureschwanz. Nach dem Motto Gleich zu Gleich gesellt sich gern, ordnen sich die hydrophilen Köpfe zum einen und die hydrophoben Schwänze zum anderen nebeneinander an und bilden eine geschlossene Schicht. Eine Doppelmembran entsteht dann, wenn sich zwei solcher Schichten, hydrophobe Schwänze zueinander gereckt, aneinanderlegen; Grampositive Bakterien besitzen dabei nur eine innere Membran, Gramnegative noch eine zusätzliche außen um den Mureinsacculus herum; in entsprechender Weise sind Ihre Geißelbasen gebaut; doppelringig bei Grampositiven; vierringig bei Gramnegativen.
[6] Protonen: Bausteine der Atomkerne; die positiv geladenen Protonen sind mit neutralen Neutronen assoziiert; oft auch nur verstanden als das positiv geladene (elektronennackte, einzige Proton) des Wasserstoffatoms
[7] Flagellin: Globuläres Protein, das sich zu vielen selbst zu einem Hohlzylinder anordnet und im westlichen das Flagellum der Prokaryoten (Bakterien und Archäen) bildet
[8] Neutrinos: Gehören zu den Leptonen, sind elektrisch ungeladen und in den Nachweisgrenzen masselos; sie zeigen keine Wechselwirkung mit Atomen
Eingestellt am 6. April 2024
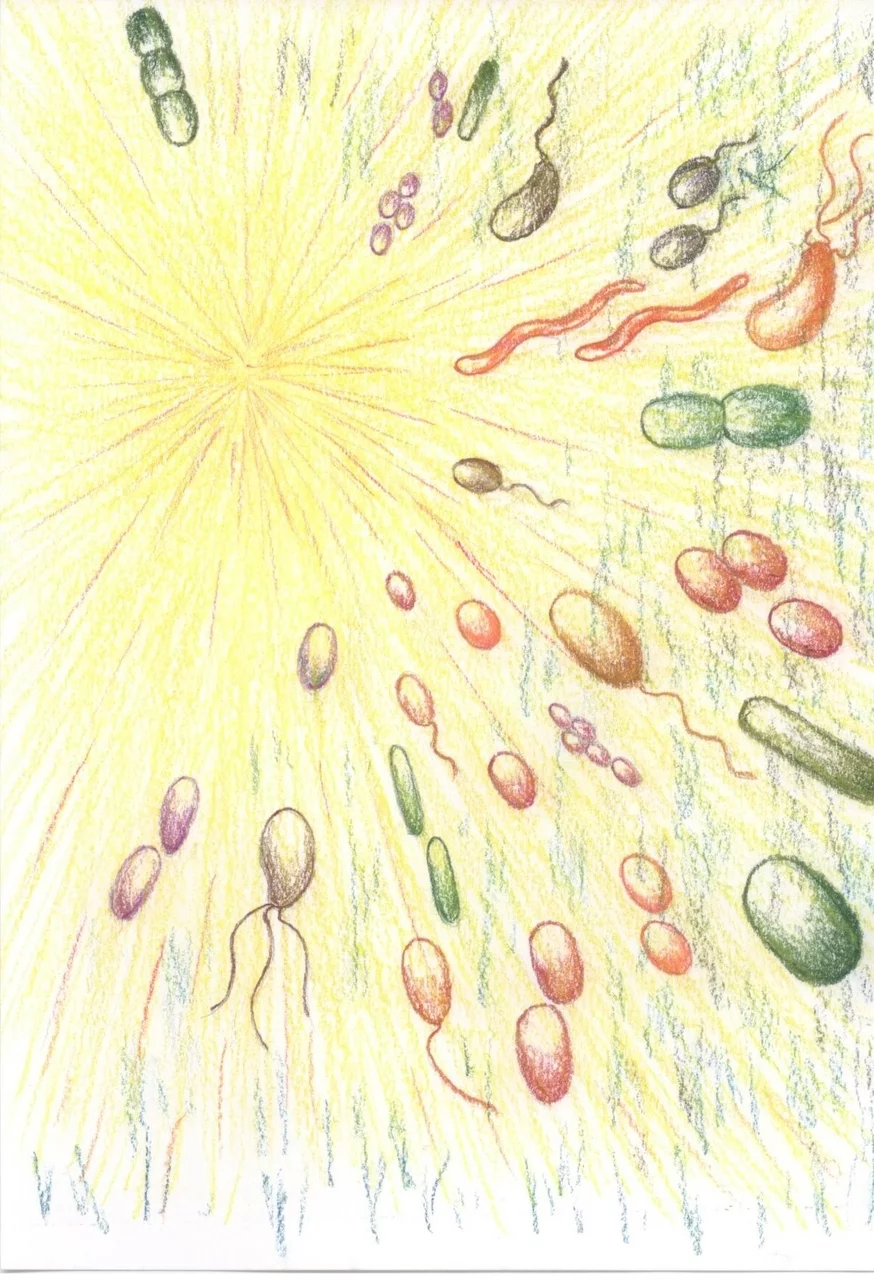
Bakterienexplosion (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer)
Eingestellt am 6. April 2024
.

Ab hier werden die Texte bezüglich Taxanamen (s. Stammbaum und/oder Pfade) alphabetisch von A - L geordnet
Die evolutiven Zusammenhänge lassen sich deshalb nur erkennen und verfolgen, wird auch der zugehörende Stammbaum berücksichtigt.
.

Actinobacteria, Strahlenbakterien i.w.S.:
1 Verschobene Verhältnisse
.
Eng gekoppelt sind des Lebens Zeichen,
Um der Helix Holme – aber nicht zu fest – zu binden:
Doch der Pärchen Anteil bleibt noch lange Zeit ein off‘nes Spiel.
.
War es Zufall, der am Anfang
Ein Remis zwischen den Pärchen förderte?
Actinobacteria jedoch der Nucleobasen[5] gleiches Maß
Zu erhöhtem Anteil an GC[6] voll Eigensinn verschoben,
Trotz allem noch genügend unterschiedliche Tripletts[7]
Aminosäuren[8] boten für ihre irrtumsfreie Wahl.
.
Firmicutes, ihre Schwestergruppe,
Beschritt genau den andern Weg,
Versuchte hingegen mit A und T im Überschuss
Ihr Aminosäuren-Puzzle-Glück.
.
Was war die treibende Kraft
Für diesen Wandel?
War es gar nur Unfall,
Den zu heilen für Betroffene es galt,
Mit Geschick der Ausgleich ihnen dann gelang;
Ihr Leben womöglich einen Vorteil sogar damit errang? –
.
Sie suchten und fanden,
Lebten sich ein in hochdiversen ökologischen Nischen[9].
Schützen ihr Umfeld, grenzen sich ab,
Verwerten Totes, wählen sich andere Arten zum Partner,
Überwinden trickreich schier unüberwindbare Grenzen,
Besiedeln erfolgreich die ganze irdische Welt.
.
Fußnoten
[1] G: Abkürzung für die Nucleobase Guanin (Buchstabencode der DNA und RNA)
[2] C: Abkürzung für die Nucleobase Cytosin (Buchstabencode der DNA und RNA)
[3] A: Abkürzung für die Nucleobase Adenin (Buchstabencode der DNA und RNA)
[4] T: Abkürzung für die Nucleobase Thymin (Buchstabencode der DNA)
[5] Nucleobasen: A, T, C, G (U in RNA)
[6] GC, GC-Verhältnis: Die Häufigkeit von GC im Vergleich zu AT ist ein Charakteristikum verschiedener Organismen
[7] Basentripletts: Immer drei Nucleobasen in Folge bestimmen die Aminosäure, die zum Protein verknüpft werden sollen–
[8] Aminosäuren: Organische Säuren mit einer Amino-[–NH2] Seitengruppe. Biologisch bedeutend sind hauptsächlich jene Aminosäuren, die an dem der Säuregruppe benachbarten Kohlenstoffatom diese Gruppe besitzen
[9] Ökologische Nischen: Meist kleine Gebiete, Habitate, mit relativ einheitlichen Lebensbedingungen
Eingestellt am 6. April 2024
.

Actinorhiza, Aktinorhizen:
1 Eintritt (TP)
.
In feuchten Gefilden Boden und Laubstreu durchziehend,
Treffen Actinomycetenfäden
Zu fortgeschrittenen Zeiten der Evolution
Nicht selten auf im Boden verkrallte Wurzeln.
.
Gelockt von manchen Zellwandsubstanzen,
Legen sie gerne eng sich daran,
Bis der Eintritt zur Zelle einmal gelingt:
Frankia[1], die Glückliche, lebt im Schlaraffenland seit dieser Zeit.
.
Dünne Kanäle bohren verzweigte Fäden
In festgefügte, doch immer noch schmächtige Wurzelzellwand,
Stoßen doch auf Widerstand, auf der Pflanze Doppelmembran[5].
.
Sie stemmt sich dem Faden entgegen!
Zu weich ist freilich ihre Natur, feste Barriere zu sein.
Folgt, sich vergrößernd, nach innen sich stülpend,
Jeglichem Angriff, jedem mächtigen Druck.
.
Verzögert erst reagiert die befallene Zelle,
Führt endlich Synthesen auf Volllast dann hoch,
Wirft wie in Panik kurze Celluloseketten[6] nur
Den vordringenden Frechen entgegen.
.
Zu wenig, die Okkupation noch aufzuhalten!
Fast ganz wird die Zelle von leicht celluloseummantelten Fäden gefüllt,
Lassen dennoch die Schwerstbedrängte am Leben,
Um sich an den Zellinhalten ständig zu laben.
.
Zucker[7] haben für Frankia besonderen Wert,
Denn molekularen[8] Stickstoff nimmt sie selbst aus der Luft,
Reduziert ihn mit Nitrogenaseenzym[9] in kugligen Zellen
Zu speicherbarem Ammoniumion[10].
.
Als Glücksfall erweist sich für Frankia
Die halb nur gelungene Wehr!
Abgekapselt sollte sie unschädlich liegen,
Zieht jedoch nicht wenig Vorteil daraus.
.
Nur so kann es gelingen, sauerstoffarme Sphären
Für ungestört wirkende Nitrogenasen zu bilden,
Um, des molekularen Stickstoffs dreifache Bindung lösend,
An jedes Stickstoffatom vier Wasserstoffe[11] zu binden.
.
Mit Überschuss produziert sie wegen des reichlich fließenden Zuckers.
Legt manches davon in Aminosäuren[12] fest,
Bringt, pH-Werte[13] so intern stabilisierend,
Das Zuviel entsorgend, in die Umgebung hinaus.
.
Dankbar greifen der Wurzel Zellen auf diese Spende zurück,
Produzieren selbst Aminosäuen damit,
Transportieren in Blätter sie, in Äste und Stamm,
Speichern auch selbst ausreichend Stickstoff in Protein[14].
.
Fußnoten
[1] Frankia alni: Scheint die einzige Art der Gattung zu sein, obwohl sie Aktinorhizen an verschiedensten Sträuchern und Bäumen, so unterschiedlicher Verwandtschaften wie Fagales (z. B. Betula), Cucurbitales (z. B. Coriaria) und Rosales (z. B. Hippophae, Dryas) bilden. Es wäre erstaunlich, verbürgen sich nicht wirtsverwandtschaftsspezifische Arten darin.
[2] Cellulasen: Cellulose abbauende Enzyme.
[3] Pectinasen: Pectin abbauende Enzyme
[4] Enzym: Protein, das, an spezielle Moleküle angepasst, die Synthese katalysiert. Meistens werden mehrere Enzyme zu einem Komplex verbunden, um eine räumliche Nähe zwischen den einzelnen, aufeinanderfolgenden Syntheseschritten herzustellen
[5] Plasmalemma: Lipidoppelmembran bei Organismen mit Saftvakuole und fester Zellwand (Plantae, Fungi, bestimmte Chromalveolata)
[6] Cellulosemolekülketten: Kettenförmige Cellulosemoleküle können sich über Wasserstoffbücken und gelegentlich mit anderen Zuckermolekülen quer vernetzen, so dass längere und dickere Ketten entstehen. Normal werden diese Cellosemoleküle zu größeren Einheiten zu Fibrillen (Mikro- und Makrofibrillen) zusammengelagert, um die Zellwand der Pflanzen stabil zu gestalten. Die eindringenden Frankia-Fäden, wie auch in anderen Fällen Fäden von Pilzen, werden allerdings unter dem Einfluss des Eindringlings von der Pflanzenzelle mit nur wenig organsierter Cellulose bedeckt. (Abbildung unter „Actinorhiza, 1 Eintritt“)
[7] Zucker, hier Saccharose, Glucose und Fructose
[8] Molekularer Stickstoff: Stickstoff [N2]: Zwei Stickstoffatome mit Dreifachbindung verknüpft [N≡N].
[9] Nitrogenasen: Die einigen Enzyme, die in der Lage sind, Stickstoff aus der Luft in bioverfügbaren Stickstoff umzuwandeln. Diesen Vorgang bezeichnet man als Stickstofffixierung. Der gesamte Prozess der biologischen Stickstofffixierung ist relativ komplex und erfordert das Zusammenwirken mehrerer Enzyme, von denen die Nitrogenase das Wichtigste ist. Um das Enzym gegen Sauerstoff zu schützen, haben Bakterien verschiedene Anpassungen entwickelt, etwa dicke Schleimkapseln oder besonders dickwandige Zellen. Bakterien, die sauerstoffbildende Photosynthese betreiben, trennen stickstofffixierende Zellen (Heterocysten) räumlich von Sauerstoff freisetzenden Zellen oder sie assimilieren Stickstoff nur nachts, wenn die Lichtreaktion der Photosynthese ruht. Nur Prokaryoten besitzen diese Enzyme.
[10] Ammonium (eigentlich Ammoniumion) [NH4+]: Ammoniak [NH3] mit drei Wasserstoffatomen, wird mit einem weiteren Wasserstoffatom versehen und bekommt dadurch eine positive Ladung
[11] Ammonium (eigentlich Ammoniumion) [NH4+]: Ammoniak [NH3] mit drei Wasserstoffatomen, wird mit einem weiteren Wasserstoffatom versehen und bekommt dadurch eine positive Ladung
[12] Aminosäuren: Organische Säuren mit einer Amino-[–NH2] Seitengruppe. Biologisch bedeutend sind hauptsächlich jene Aminosäuren, die an dem der Säuregruppe benachbarten Kohlenstoffatom diese Gruppe besitzen
[13] pH-Wert: Abkürzung für Potential des Wasserstoffs, ist ein Maß für den sauren oder basischen Charakter einer wässrigen Lösung. Je höher die Konzentration der Wasserstoffionen (H+) in der Lösung ist, desto niedriger ist der pH-Wert, desto saurer ist die Lösung, je höher, desto basischer; er schwankt zwischen 0 und 14. Reines Wasser hat einen pH von 7
[14] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt
Eingestellt am 6. April 2024
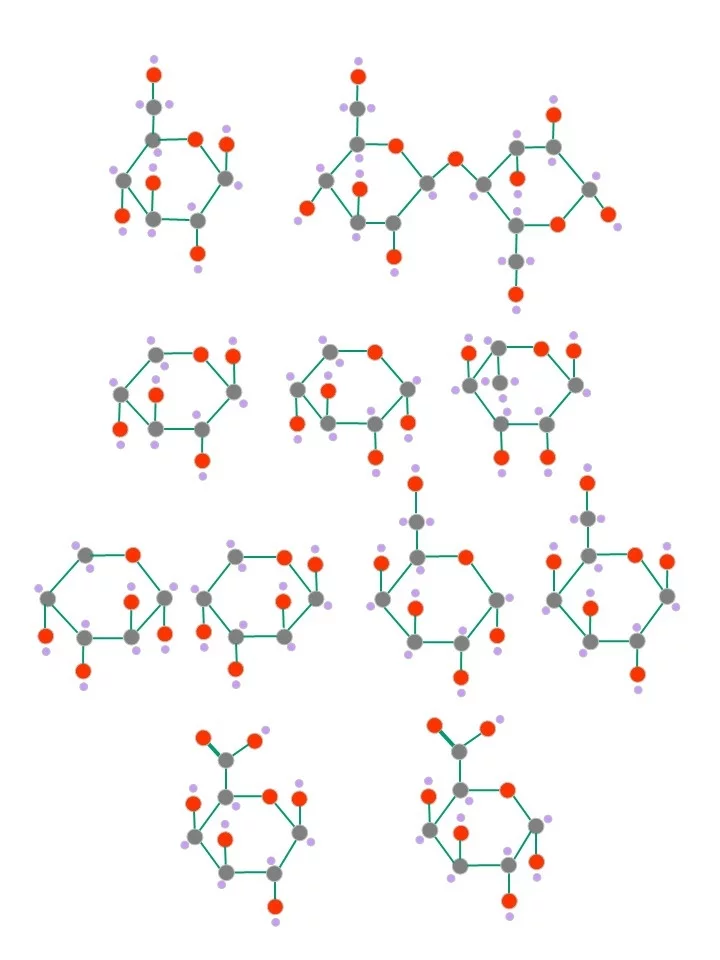
Verschiedene Zucker der pflanzlichen Zellwand (ppt generiert, Reinhard Agerer)
In geraden Ketten verbundene β-Glucose (1. Reihe links) ergibt das langfädige Cellulosemolekül; dabei ist der Zweierzucker Cellobiose (1. Reihe, rechts, 1-4-verknüpfte β-Glucosen) in ständiger Folge miteinander verbunden. Gebündelte Celluosemoleküle werden von verschiedenen Zuckern (jeweils in bestimmen Abfolgen zu kürzeren, meist verzweigten Ketten vereint) zu größeren Einheiten zusammengefasst. Folgende Zucker sind daran in häufiger Weise beteiligt: β-Xylose (2. Reihe, links), α-Xylose (2. Reihe, Mitte), α-Rhamnose (2. Reihe, rechts); α-Arabinose (3. Reihe, links), β-Arabinose (3. Reihe mitte-links), α-Galactose (3. Reihe mitte-rechts), β-Galactose (3. Reihe, rechts); β-Galacturonsäure (4. Reihe, links) und α-Galacturonsäure (4. Reihe, rechts). α- und β- sind nicht vereinfacht erklärbar. Kohlenstoff: grau. – Sauerstoff: rot. – Wasserstoff violett. Einfachbindungen: feiner Strich; Doppelbindungen: breiter Strich.
Eingestellt am 6. April 2024
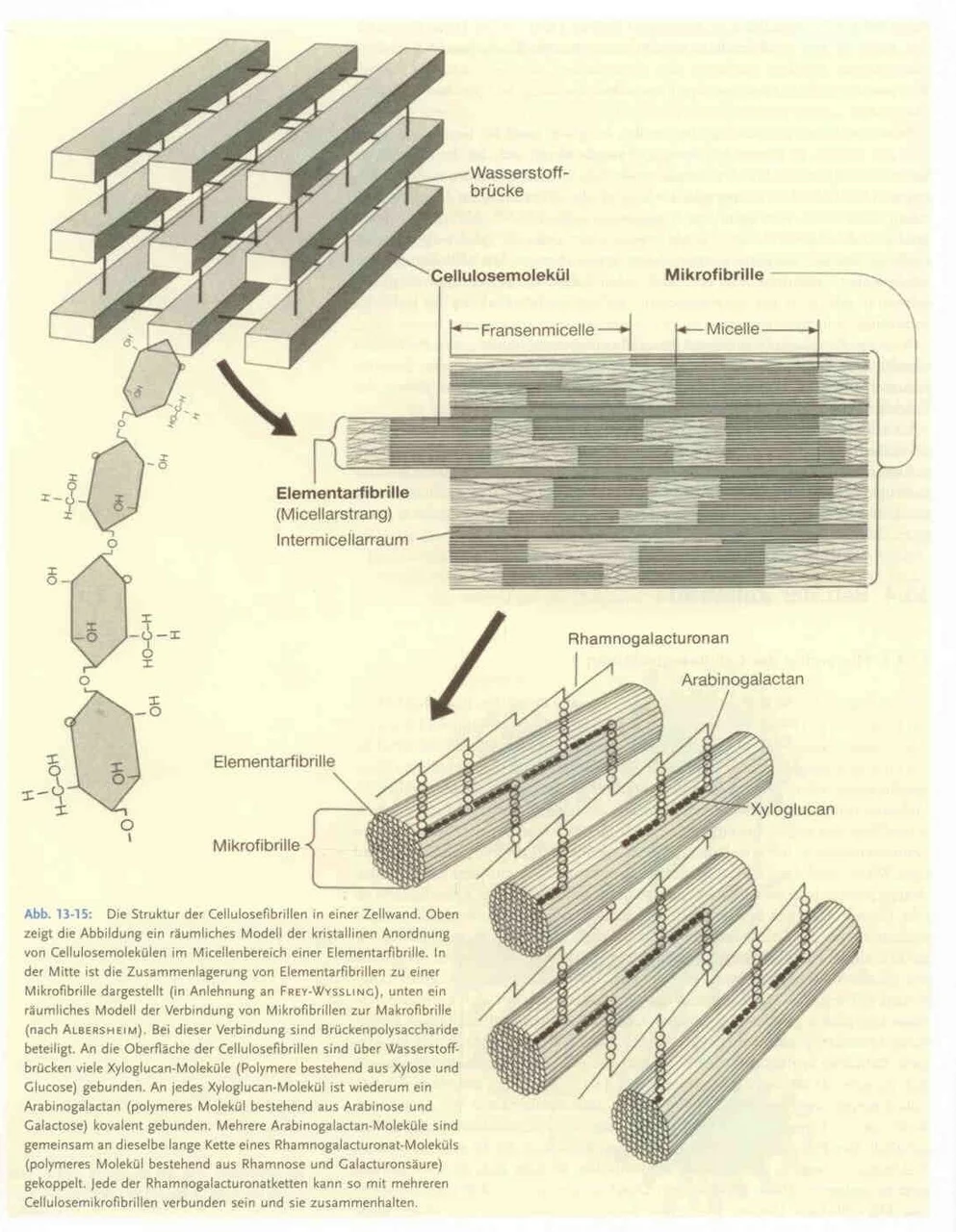
Cellulosebau der Pflanzenzellwand
„Abb. 13-15: Die Struktur der Cellulosefibrillen in einer Zellwand. Oben zeigt die Abbildung ein räumliches Modell der kristallinen Anordnung von Cellulosemolekülen im Micellenbereich einer Elementarfibrille. In der Mitte ist die Zusammenlagerung von Elementarfibrillen zu einer Mikrofibrille dargestellt (in Anlehnung an Frey-Wyssling), unten ein räumliches Modell der Verbindung von Mikrofibrillen zur Makrofibrille (nach Albersheim). Bei dieser Verbindung sind Brückenpolysaccharide beteiligt. An die Oberflächen der Cellulosefibrillen sind über Wasserstoffbrücken viele Xyloglucan-Moleküle (Polymere bestehend aus Xylose und Glucose) gebunden. An jedes Xyloglucan-Molekül ist wiederum ein Arabinogalactan (polymeres Molekül bestehend aus Arabinose und Galactose) kovalent gebunden. Mehrere Arabinogalactan-Moleküle sind gemeinsam an dieselbe lange Kette eines Rhamnogalacturonat-Moleküls (polymeres Molekül bestehend aus Rhamnose und Galacturonsäure) gekoppelt. Jede der Rhamnogalacturonatketten kann so mit mehreren Cellulosemikrofibrillen verbunden sein und sie zusammenhalten.“
Aus: Lüttge U, Kluge M, Thiel G (2010) Botanik. Die umfassende Biologie der Pflanzen. 1. Auflage. Copyright WLEY-VCH GmbH, S. 296. Reproduced with permission.
Eingestellt am 6. April 2024
.

Actinorhiza, Aktinorhizen:
2 Warzenbälle (TP)
.
Wachstumslimitierender Stickstoff ist für beide Partner damit passé:
Frankia[1] dringt tiefer noch in gekaperte Wurzeln,
Berührt teilungswillige Zellen,
Treibt, stickstoffverteilend, ihre Aktivitäten voran,
Veranlasst ein Sprießen und Treiben
Knorriger, länglich dicklicher Wurzeln,
Formt sie, winzig am Anfang,
Nach Jahren zum warzenbedeckten orangenähnlichen Ball.
.
Leitbündel[2], den sich verlängernden Auswüchsen fortwährend folgend,
Verbinden mehrfach der Knolle Peripherie
Mit der Wurzel zentralem Leitelement[3],
Versorgen mit Stickstoff jedes bedürftige Blatt.
.
Apikal sich verlängernd,
Bleiben meristematische Zonen[4] jedoch ohne Befall.
Vesikel[5] werden zuvorderst gebildet,
Sporen[6] erst im rückwärtigen Raum,
Dem Auswuchs entlang.
Am unteren Ende erfolgt,
Den Wurzeln sei es vergönnt,
Der Frankia-Fäden Verdau.
.
Basal zerfällt das Knollengewebe,
Gibt unzählige Sporen aufbrechend frei
Für Hilfe suchende Wurzeln.
Nicht ohne Eigennutz, doch der hat seinen Preis.
.
Fußnoten
[1] Frankia alni: Scheint die einzige Art der Gattung zu sein, obwohl sie Aktinorhizen an verschiedensten Sträuchern und Bäumen, so unterschiedlicher Verwandtschaften wie Fagales (z. B. Betula), Cucurbitales (z. B. Coriaria) und Rosales (z. B. Hippophae, Dryas) bilden. Es wäre erstaunlich, verbürgen sich nicht wirtsverwandtschaftsspezifische Arten darin.
[2] Leitbündel: In Achsengewebe oder in Blättern von Pflanzen verlaufende Bündel von Leitgewebe für Zucker und andere Substanzen einerseits (Phloem) und getrennt davon für Wasser mit Nährsalzen (Xylem)
[3] Leitbündel
[4] Meristematische Zonen, Meristeme: Ständig teilungsaktive apikale Zonen aus undifferenzierten Zellen, die immer neue Zellen für Differenzierung in verschiedene Gewebe liefern
[5]
Vesikel (generell): Kleine, abgegliederte, rundliche Behälter
oder Bläschen mit dünnster oder fehlender Zellwand. – Vesikel
in Aktinorhizen: Bläschenförmig aufgetriebene Zellen von
Frankia in Wurzelzellen; sie liegen nicht frei im Cytoplasma,
sondern sind, zumindest solang die beherbergende Zelle lebt,
noch mit
Wirtszellplasmalemma
umgeben; sicher auch danach noch mit dünnen von der Wirtszelle
geformten Zellwandschichten.
[6] Sporen (Bakterien): Dauerformen, die Bakterien ermöglichen auch unter ungünstigen Bedingungen (Hitze, Kälte, Austrocknung, Hungerzustand) zu überleben
Eingestellt am 6. April 2024

Aktinorhizen von Schwarzerle (Alnus glutinosa)
[Aus Wikipedia: Alder nodules (Frankia alni) on roots of common alder (Alnus glutinosa); https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alder_nodules2.JPG. Autor: Cwmhiraeth; CC-BY-SA-3.0; https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/]
Eingestellt am 6. April 2014
.

Actinorhiza, Aktinorhizen:
3 Nimm, aber gewähre dem Andern (TP)
.
Zum eingespielten Paar sind Actinobakterien und Pflanze geworden.
Jeder nimmt und lässt zum Ausgleich sich nehmen,
Was immer der andere braucht,
Um neue Fitness[1] und Kraft zu gewinnen.
.
Doch auch Grenzen setzen die Partner einander.
Ein Bis-hierher-und-nicht-Weiter schützt das symbiotische[2] Paar;
Denn teilungsaktive Zonen der Pflanze, ergrünende Glieder,
Auch Leitgewebe bleiben tabu.
.
So zieht jeder der beiden den eigenen Vorteil aus der innigen Bindung:
Den oft limitierenden Stickstoff der Baum,
Denn einen Prokaryoten fing er sich ein.
Nur sie reduzieren inerten molekularen Stickstoff[5]
Aus der umgebenden Luft.
.
Flexibilität gewinnt dadurch der Baum,
Besiedelt Gebiete, die andern verwehrt,
Weil nötiger Stickstoff womöglich dort fehlt.
Doch im Gefolge profitieren viele weitere noch davon[6].
.
Denn Stickstoff, gebunden in Fülle, kehrt mit sterbenden Teilen
Als Quelle für andere Pflanzen in den Boden zurück,
Bilden so mit wurzelbewohnenden Frankien
Eine Gemeinschaft zu aller Beteiligten Glück.
.
Fußnoten
[1] Fitness (biologische): Je mehr nachkommenerzeugende Nachkommen entstehen, umso fitter ist ein Organismus
[2] Symbiose, symbio(n)tisch: wechselseitiges Nehmen zu beiderseitigem Vorteil; auch als wechselseitigen Parasitismus verstehbar
[3] Frankia alni: Scheint die einzige Art der Gattung zu sein, obwohl sie Aktinorhizen an verschiedensten Sträuchern und Bäumen, so unterschiedlicher Verwandtschaften wie Fagales (z. B. Betula), Cucurbitales (z. B. Coriaria) und Rosales (z. B. Hippophae, Dryas) bilden. Es wäre erstaunlich, verbürgen sich nicht wirtsverwandtschaftsspezifische Arten darin.
[4] Zucker: hier wohl hauptsächlich Glucose und Fructose
[5] Stickstoff [N2]: Zwei Stickstoffatome mit Dreifachbindung verknüpft [N≡N]
[6] Der von Frankia in den Pflanzen fixierte Luftstickstoff wird anderen Organismen über verwertbare Blätter, Zäpfchen, Äste, Zweige, Wurzeln, Pollen und Früchte (lebend oder tot) verfügbar.
Eingestellt am 6. April 2004
.

Alpha-Proteobacteria:
1 Alpha
.
Kein Ordnen würde für Proteobakterien gelingen
Ohne Basensequenzvergleiche der rDNA[1]
Vermutlich nahestehender Arten,
Denn herkömmliche Merkmale bringen zu wenig Information.
.
Steh‘n kaum bewegter Strecke entlang,
An jedem der Zweige mit einziger Art,
Manchmal benannt, meist unbekannt.
.
Alpha-Proteobakterien bilden den ersten Strauch der Sträucher,
Separiert von den anderen vier,
.
Fußnoten
[1] rDNA, ribosomale DNA: Gene, die für die RNA der Ribosomen codieren
[2] Akroton: Eigenschaft von Verzweigungssystemen von Sträuchern; die Häufigkeit der Verzweigungen nimmt nach oben hin zu
[3] Basiton: Eigenschaft von Verzweigungssystemen von Sträuchern; die Häufigkeit der Verzweigungen nimmt nach oben hin ab, der Verzweigungsschwerpunkt liegt also Richtung Basis des Strauchs
[4] Rickettsia: Obligat intrazelluläre Bakterien in Arthropoden und anderen Tieren; der Mensch ist nur gelegentlich Wirt dieser Bakterien, wozu die Fleckfieber-Rickettsien zählen.
[5] Rhizobium: Rhizobium-Arten bilden eine endosymbiotische stickstofffixierende Assoziation mit Wurzeln von hauptsächlich Hülsenfrüchtlern (Fabaceae – Fabales - ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae – Rosidae – Superrosidae – …)
[6] Agrobacterium: Agrobakterien-Arten sind Bodenbakterien und besitzen von Natur aus die Fähigkeit, Teile ihres Genoms auf Pflanzenzellen zu übertragen; sie können mancherlei Pflanzen besiedeln.
[7] Brucella: Brucellen; Stäbchenförmige Bakterien, die hauptsächlich im Urogenitalsystem von Rindern, Schweinen und Schafen vorkommen; können auf Menschen übertragen werden. Verursacher der Brucellose: Undulierendes Fieber.
[8] Methylobacterium (Alpha-Proteobacteria – Gramnegative – Bacteria): Aerobe Bakterien, rötliche Kolonien bildend, häufig in Biofilmen vertreten; können Methylgruppen verwerten
[9] Nitrobacter: Nitritoxidierer; stäbchenförmige Bakterien, die unter aeroben Bedingungen zur Energiegewinnung Nitritionen [NO2−] zu Nitrationen [NO3−] oxidieren; werden deshalb oft als Nitratbakterien bezeichnet
[10] Rhodospirillum: Spirillenförmige, polar begeißelte, rote, anoxygene, fakultativ phototrophe Bakterien
[11] Bartonella: Bartonellen; In der Regel parasitisch intrazellulär lebende Bakterien. Die Wirtszellen sind meist Endothelzellen oder rote Blutkörperchen; Überträger der meisten Arten sind Insekten. Bei Menschen und anderen Wirbeltieren lösen die verschiedenen Arten ein breites Spektrum von Infektionskrankheiten (Bartonellosen) aus.
Eingestellt am 6. April 2024
.

Bacteroidetes:
1 Gedränge im Dunkeln (HP)
.
Kaum eine Chance besteht
Der Bakterien phylogenetisches Alter zu prüfen.
Zu merkmalsarm erweisen sich nämlich Fossilien,
Ihre Entstehung zeitlich zu ordnen. –
.
Steht das Alter einer Fossilienschicht eindeutig fest
Und lässt sich das lang schon versteinerte Wesen
Als ursprünglicher Baustein einer Verwandtschaft
Am Strauch der Sequenzen erkennen,
Ermittelt der Forscher in schätzender Weise
Ursprungsalter auch anderer Zweige[1].
.
Wann Bacteroidetes-Arten entstanden,
Bleibt, weil für Versteinerung zu wenig robust, vollkommen ungewiss.
Cellulose[2] aber, dieser Spezialisten hauptsächliche Nahrung,
Existiert bereits länger als jedes celluloseverdauendes Tier. –
.
Bohrten als Würmer, kratzten als Schnecken
In biotischen, cellulosehaltigen Filmen,
Nahmen damit Bakterien, sicher auch andere Einzeller auf.
.
– Manche trotzen geschickt der Verdauung,
Schmiegen und heften sich fest an des Darmrohrs hüllenden Schleim.
Schon damit vorzüglich lebend, erweitern sie,
Passierende Faeces[5] ergreifend, noch ihr Nahrungstableau. –
.
Cellulose, mehr als benötigt in kürzere Zucker zerlegt,
Und wandernder Zellen schleimige Matrix
Berühren des Vendobionten zuckerbedürftiges Darmepithel
Fördern erheblich das Wachstum des äsenden Tiers.
.
Festgefügt zwar, doch als Mutterzelle ständig sich teilend,
Verlieren viele der Nachkommen jeglichen Halt,
Wandern, sich nährend, in Massentransporten sich unentwegt teilend,
Langsam und sicher dem Ende des Darmkanals zu. –
.
An Sauerstoffarmut gewöhnt,
Begnügt sich Bacteroides mit niedrigen Konzentrationen im Darmepithel;
Lebt vorzüglich auch anaerob[6],
Wenn der gleitende Brei[7] es umschließt.
.
Ein Leben zwischen zwei Welten fordern Bacteroides[8] ständig heraus:
Auf Cellulose im Freien am Landeplatz,
Oder, beengt, im Dunkel des Darms
Auf cellulosebestückte Partikel in Mengen hoffend, am laufenden Band.
.
In Freiheit entscheidet differenziert sich die Sippe:
Breitet sich aus, besetzt anaerobe, cellulosehaltige Nischen,
Kreiert Spezialisten, etabliert neue Arten,
Fokussiert im Laufe der Zeit meist auf sich tierischen Darm.
.
Fußnoten
[1] Molekulare Uhr: Bezeichnung für eine Methode der Genetik, mit der anhand von DNA-Sequenzierungen der Zeitpunkt der Aufspaltung zweier Arten von einem gemeinsamen Vorfahren abgeschätzt wird. Je mehr Mutationen (Unterschiede in den DNA-Sequenzen) nach einer Aufspaltung entstanden sind, desto länger war vermutlich die Evolutionsdauer seit diesem Zeitpunkt. Schwierig ist es, die Mutationsrate zu bestimmen und damit die Laufgeschwindigkeit der molekularen Uhr zu ermitteln. Zumeist werden Mutationsraten für ganze Organismengruppen gemittelt, um einen Richtwert zu erhalten. Zur Kalibrierung des Alters der Verzweigungen im ermittelten molekularen Stammbaum werden, sofern verfügbar, Fossilien, die den Organismen der Verzweigungsstellen vermutlich entsprechen, verwendet, deren ungefähres Alter bekannt ist. Große Schwankungen für die Zeitangaben der Organismenaufspaltung in zwei eigenständige Verwandtschaften sind daher nicht verwunderlich. Sie werden in den entsprechenden Diagrammen oft als Dutzende Millionen Jahre überspannende Balken angeben.
[2] Cellulose: Unverzweigte Ketten aus Glucose in β-1,4-Verknüpfung; wobei der 6C-Zucker Glucose in Ring-Form geschrieben, das C1 der Aldehydgruppe ist [CH2OHCHOHCHOHCHOHCHOHCHO], davon aus gerechnet ist das vierte C4 ist. In Ringform geschrieben weist die OH-Gruppe des C1 nach oben, wie auch die frei gebliebene CH2OH-Gruppe. Die OH-Gruppen wechseln von 1 bis 4 die Stellung: C1 nach oben, C2 nach unten, C3 noch oben, C4 nach unten, an C5 hängt die nach oben stehende CH2OH-Gruppe. (Zeichnerische Darstellung unter: )
[3] Ediacarium-Zeit: vor ca. 580 – 540 Millionen Jahren
[4] Vendobionten: Bezeichnung für eine hypothetische Organismengruppe riesenwüchsiger Einzeller im Erdzeitalter des Ediacariums und den Großteil der Ediacaria-Fossilfauna ausmachen soll
[5] Faeces: Kot, Kacke
[6] Anaerob: sauerstofffrei; Anaerobier leben nur unter sauerstofffreien Bedingungen
[7] Verdauungsbrei
[8] Bacteroides: Haben als zahlenmäßig führende Mikroorganismen im Colon die Statthalterfunktion inne, d.h. sie sorgen dafür, dass sich keine pathogenen Keime einnisten und ausbreiten können
Eingestellt am 6. April 2024
.

Bacteroidetes:
2 Und heute? (TP)
.
Heiß umkämpft von Hunderten Arten
Sind Wände im Säugetierdarm.
Nicht nur Bacteroides[1] erkannte den Vorteil
Der wohltemperierten, nährstoffbefüllten, ökologischen Nische[2].
.
Thetaio[3], aus der Bacteroides-Sippe,
Belegt bevorzugt im Enddarm leicht saure Bereiche;
Nimmt komplexe Kohlenhydrate der Nahrung,
Zerlegt sie im Überschuss,
Scheidet zerkleinert darmwandpassable kürzere aus,
Ermöglicht so erst Nahrungsaufnahme vollauf.
.
Einen Volltreffer landete Thetaio mit seiner spezifischen Wahl.
Nährstoffumwalkt, kohlendydrat- und stickstoffversorgt,
Teilt er sich ungebremst,
Überbevölkert nur scheinbar den Darm,
Übertrifft mit hundert Milliarden Zellen pro Gramm
Mitkonkurrenten im Faeces[4] weitaus an Zahl.
.
Verdauungsfördernd etabliert er so eine Symbiose,
Nutzt viele Ressourcen, gibt dennoch zurück,
Konvertiert inerte Cellulose in Zucker und Säuren.
Fünfzehn bis zwanzig Prozent
Der vom Körper der Nahrung entzog‘nen Kalorien
Steuert Thetaio Tag für Tag bei.
.
Resorptionsbehindernde Seitenketten entfernend,
Treibt er das Gallensäurerecycling voran,
Zerstört potenzielle Gifte pflanzlicher Nahrung,
Erhöht Sensibilität der Immunabwehr.
.
Konsortial[5] organisiert, lebt Thetaio in Einklang
Mit Scharen bakterieller Mikroben.
Teilen Areale und Räume, nutzen verschied‘ne Substrate,
Ordnen sich ein in die innere Welt.
.
Der Gärkammer Harmonie jedoch nachhaltig störend,
Drängen Viren[6] und fremde Mikroben
In das wohlfunktionierende Ökosystem.
Bringen das Gleichgewicht aus der Balance,
Bewirken zum Nachseh‘n heimischer Populationen
Schnellentleerung des Darms.
.
Im Kampf um Nahrung, Einfluss und Nischen,
Erfanden Bakterien abwehrende, teilungshemmende Stoffe.
Setzen sie notfalls rücksichtslos ein,
Um ihr eigenes Leben zu sichern.
.
Als Antibiotika[7] seit langem bekannt,
Verordnet der Arzt sie spezifisch gegen bakterielle Krankheitserreger
Nimmt dabei mögliche Störung des Darmmikrobioms[8] in Kauf,
Unterstützt danach mit Probiotica[9] seine Restauration.
.
Fußnoten
[1] Bacteroides: gramnegative, obligat anaerobe Bakterien
[2] Ökologische Nischen: Meist kleine Gebiete, Habitate, mit relativ einheitlichen Lebensbedingungen
[3] Bacteroides thetaiotaomicron: Dominiert der meisten Säugetiere Darmmikrobiom. Ermöglicht das Aufnehmen von sonst unverdaulichen Polysacchariden durch deren Hydrolyse, stellt dem Wirt metabolische Fähigkeiten zur Verfügung, die er selbst nicht besitzt; ist auch in der Lage, die Genexpression des Wirts zu manipulieren, die zu beiderseitigem Vorteil, zu einer Symbiose, führt; ist auch fähig, in der postnatalen Entwicklung die Blutkapillarenentwicklung zu stimulieren und so die Nährstoffaufnahmen zu verbessern. Bei Vorgeschädigten Personen, kann er als schwaches opportunistisches Pathogen wirken.
[4] Faeces: Kot, Kacke
[5] Konsortium (Bakterien): Zusammenschluss von Mikroben zur bessren Verwertung von Nahrung; die einen nutzen, was anderen in unmittelbarer Nähe produzieren
[6] Viren: (Viren – Bacteria)
[7] Antibiotikum: Ein natürlich gebildetes, oft chemisch modifiziertes, niedermolekulares Stoffwechselprodukt, von Pilzen oder Bakterien, das schon in geringer Konzentration das Wachstum anderer Mikroorganismen hemmt oder diese gar tötet.
[8] Mikrobiom: Gesamtheit der Mikroorganismen, die in oder auf einem mehrzelligen Wesen leben; dabei kann sich deren Zusammensetzung nach Ort und Zeit unterscheiden
[9] Probiotica: Zubereitungen, die lebensfähige Mikroorganismen enthalten, z. B. Milchsäurebakterien und Hefen
Eingestellt am 6. April 2024
.

Chlamydiae: Chlamydien
1 Elend (AP)
.
Müde reibt sich am Abend Bomba[1] die Augen,
Wischt sich den Schweiß von der Stirn,
Geht langsam zum Rinnsal, nimmt etwas Wasser mit seinen Händen,
Schüttelt recht flüchtig den Schmutz damit ab
Und schöpft, eng die Finger zur flachgründigen Schale geformt,
Einen leidlich erfrischenden Trunk.
.
Sein ganzes Dorf lebt von dem wenigen Wasser,
Wäscht auch Kleider und Tücher darin.
Kaum ein Bewohner nennt ein Handtuch sein Eigen,
Miteinander trocknen sich viele an einem einzigen ab.
Macht nichts. –
Der wehende Wind nimmt die restliche Feuchte schon mit.
.
Auch Bomba verspürt, seit Wochen nun schon,
Ein Kratzen in seinen Augen!
Die Lider schwellen ein wenig ihm an,
Betonen gar den ermatteten Blick.
.
Rauh fühlen die Lider sich an,
Reiben am Auge mit jeglichem Schlag.
Kein Wischen, kein Waschen hindert die Qual.
Am Ende klebt gelblicher Ausfluss fast seine Augen noch zu.
.
Lange danach erst verschwindet der Schleim.
Trocknend zieht sich das Lid nun empor
Und weitet den Blick für das Elend im Dorf. –
Auch Bomba wird bald wie die anderen sein!
.
Die Narben vertrocknen,
Das Lid rollt sich ein.
Kratzend reiben die Wimpern den Augapfel matt,
Nicht lange noch und Bomba ist blind.
.
Fußnote
[1] Bomba: Afrikanischer Junge
Eingestellt am 6. April 2024

Am Schöpfloch (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer)
Eingestellt am 6. April 2024
.

Chlamydiae: Chlamydien
2 Helfer
.
Staub hebt sich auf in der Ferne.
Dichtwirblig am Anfang breitet er dünnwolkig sich immer mehr aus.
Ein kleiner Punkt nur rollt dicht vor ihm her.
Kommt näher, wird größer, bleibt langsam dann steh‘n.
.
Große Lettern, geschrieben auf Türen und Wand,
Verkünden Hoffnung für viele Bewohner:
Christoffel-Blindenmission[1]!
Weißgekleidete Ärzte und Schwestern entsteigen dem staubbedeckten Gefährt.
.
Neugierig, die Augen halb mit den Händen bedeckend,
Schaut Bomba[2] verwundert den Helfern entgegen,
Denn ahnungsvoll hofft er auf Hilfe, auf
Heilung der Augen, auf ein Lindern der Qual.
.
Voll Erfahrung, mit kundigem Blick,
Durchmustern sie der Einwohner Augen,
Notieren Namen und Schwere der Krankheit,
Erstellen Pläne gegen Trachom[3]:
.
Tief in Zellen dringende, antibiotische[4] Salbe
Für leichtere Fälle mit kratzenden Lidern.
Eingerollte bedürfen korrigierender Operation. –
Blinden jedoch hilft nur eine Hornhaut[5]-Transplantation.
Doch wer hat das nötige Geld?
Für jede Spende bedankt sich: Christoffel-Blindenmission.
.
SAFE[6] heißt das hoffnungsvolle Programm,
Trachom binnen zehn Jahren final zu besiegen:
S, steht für Surgery, Operation soll Erblinden verhindern,
A für Antibiotica, um Chlamydien auszuradieren,
F, für Face, rät, das Gesicht sauber zu waschen und
E, Environment, zielt auf der Lebensbedingungen Besserung ab:
Brunnen sollen aus Tiefen sauberes Wasser allen Bewohnern bringen.
.
Fußnoten
[1] Christoffel-Blindenmission, CBM.de: Stubenwald-Allee 5, 64625 Bensheim; Spendenkonto der CBM, Bank für Sozialwirtschaft, IBAN DE46 3702 0500 0000 0020 20, BIC BFSWDE33XXX
[2] Bomba: Afrikanischer Junge
[3] Trachom: Erkrankung der Augen von Chlamydia trachomatis verursacht
[4] Antibioticum: Ein natürlich gebildetes, oft chemisch modifiziertes, niedermolekulares Stoffwechselprodukt, von Pilzen oder Bakterien, das schon in geringer Konzentration das Wachstum anderer Mikroorganismen hemmt oder diese gar tötet.
[5] Hornhaut (Auge): Auch Cornea genannt, ist die glasklare vordere Begrenzung des Auges. Ähnlich wie ein Fenster lässt sie das Licht in das Auge und ist deshalb entscheidend für gutes Sehen
[6] SAFE, Programm der Christoffel-Blindenmission: S (Surgery, Operation), A (Antibiotika), F (Face, Gesicht), E (Environment, Umwelt)
Eingestellt am 6. April 2024
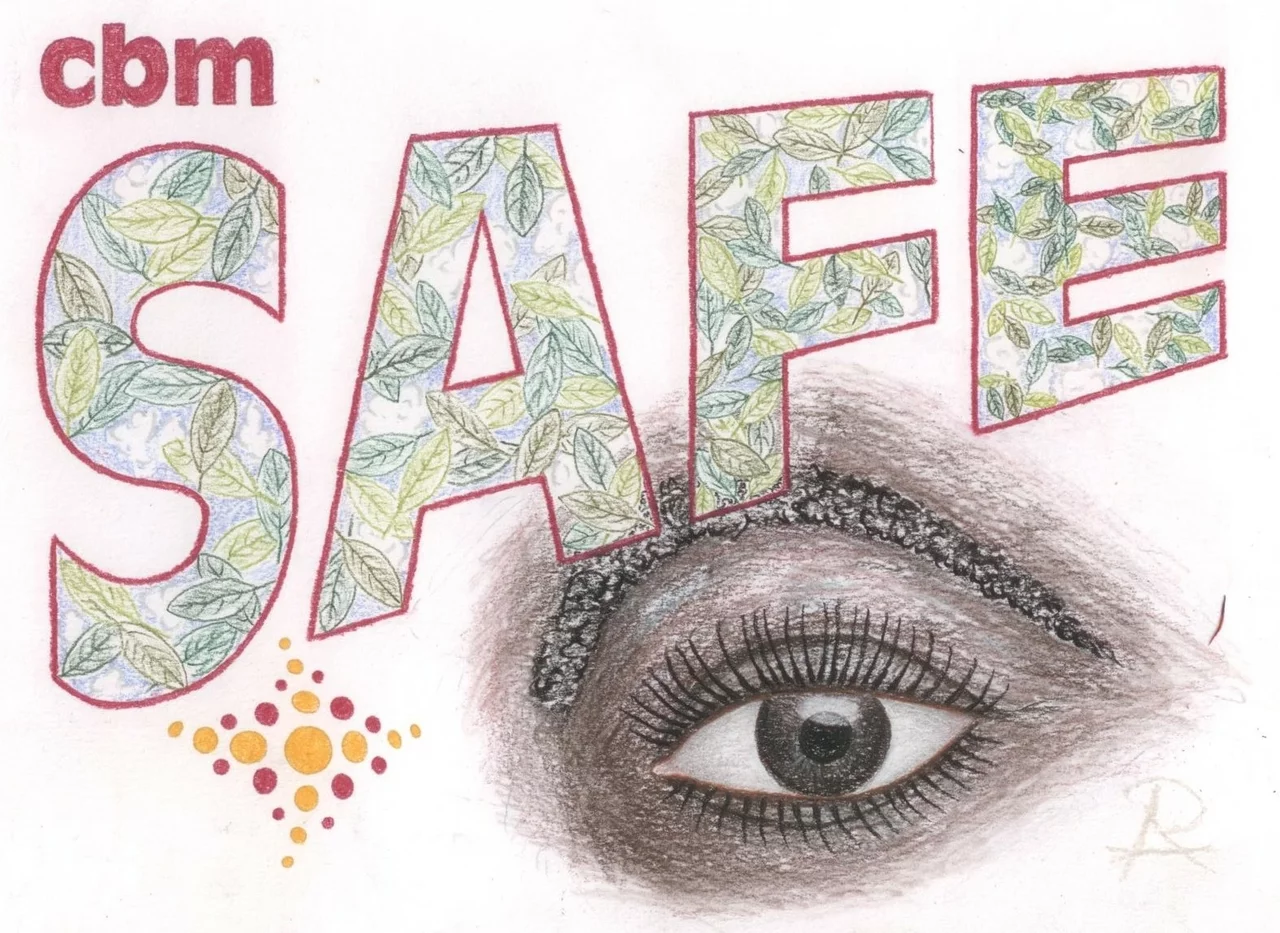
SAFE (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer, 2016)
SAFE, Programm der Christoffel-Blindenmission zur Bekämpfung von Trachom: S (Surgery, Operation), A (Antibiotika), F (Face, Gesicht), E (Environment, Umwelt)
Eingestellt am 6. April 2024
.

Chlamydiae: Chlamydien
3 Chlamydia trachomatis (AP)
.
Mit dicht gepackter DNA
Heftet sich‘s Pathogen
Eng an die Haut,
Erwartet der Zelle Reaktion.
.
Nicht allzulang musste es warten,
Bis eine wischende Hand ihm ins Auge verhilft
Und nun an der oberen Lidbindehaut[1]
Auf seine Unterkunft trifft.
.
Kaum freiwillig, genötigt durch die Attacke,
Stülpt der Zelle Membran sich ein,
Verdaut aber sie nicht.
.
Dies wendet Chlamydia zum Vorteil.
Sich vielfach vergrößernd,
Entpackt sie dicht verknäuelte Chromosomen,
Spannt, sie aktivierend, zum lockeren Netz.
.
Eingehüllt, isoliert vom Cytoplasma[4],
Nimmt Chlamydia der Zelle, was sie nur braucht.
Spaltet, vermehrt, vergrößert sich wieder,
Dehnt die engende Hülle, füllt sie am Ende
Mit DNA-verdichteten Sporen[5] aus.
Zerreißt die kaum mehr lebende Zelle,
Setzt hochinfektiöse Nachkommen frei,
Befällt schon wieder Zellen im Lid.
.
Wie Körnchen wirken der platzenden Zellen Häufchen.
Reihen sich dicht im Lidinnern an,
Reiben scheuernd den Augapfel wund,
Lassen die Bindehaut schmerzen und tränen.
.
Chlamydia legt eine flüchtige Pause gelegentlich ein:
Zusammenziehend vernarben die hügligen Wunden,
Verkleinern des Augenlids innere Fläche,
Bis es zur halben Rolle nach innen sich krümmt
Und der Wimpernsaum wie ein borstiger Kamm
Die eigenen Augen zerkratzt. –
.
Die Alten Ägypter schon litten an dieser blickverstellenden Krankheit.
Sie kommt heute besonders in trocken-heißen Gegenden vor,
Plagt zig-Millionen Menschen,
Sechs Millionen sind davon noch blind. –
.
Nicht nur Augen befallen Trachom-Chlamydien,
Denn Sexualorgane sind ihnen ebenso lieb.
Auch Pneumoniae[6], ihre Verwandte, nistet dort gerne sich ein,
Obwohl sie am liebsten die Lunge befällt.
.
Fußnoten
[1] Bindehaut: Besteht aus mehreren Zellschichten und überzieht die hintere, dem Augapfel zugewandte Fläche der Augenlider und die Vorderseite des Augapfels, nicht aber die Cornea; dieser Schleimhautüberzug wirkt wie ein weiches Wischtuch und verteilt beim Lidschlag die Tränenflüssigkeit auf der Hornhaut des Auges
[2] Chlamydia trachomatis: gramnegatives Bakterium (Chlamydiae – Multiplex – Bacteria); benötigt für das Wachstum ATP, das ihnen durch die Wirtszelle geliefert wird, da sie es nicht selbst synthetisieren kann; bildet keine typischen Sporen, sondern nur robustere sporenähnliche Zellen zum Überdauern, sog. Elementarkörper
[3] Endosom: Vesikel entstanden aus einer Zellmembraneinstülpung
[4] Cytoplasma: Flüssiger Zellinhalt mit darin liegendem Cytoskelett
[5] Sporen (Bakterien): Dauerformen, die Bakterien ermöglichen auch unter ungünstigen Bedingungen (Hitze, Kälte, Austrocknung, Hungerzustand) zu überleben
[6] Chlamydia pneumoniae: gramnegatives Bakterium (Chlamydiae – Multiplex – Bacteria). Weltweit ein häufiger Grund für Lungenentzündungen abwehrgeschwächter Personen; wird typischerweise über die Luft übertragen. Die Chlamydien können vier bis sechs Wochen nach Primärinfektion zu postinfektiösen Arthritiden und Sehnenscheidenentzündungen führen. Man geht von einer 50–70 %igen Durchseuchung der Bevölkerung mit Chlamydia (neuerdings Chlamydophila) pneumoniae aus. Meistens verlaufen Infektionen asymptomatisch und unbemerkt oder verursachen leichte Halsschmerzen, können jedoch auch Ursache einer Bronchitis oder einer Mittelohrentzündung sein.
Eingestellt am 6. April 2024
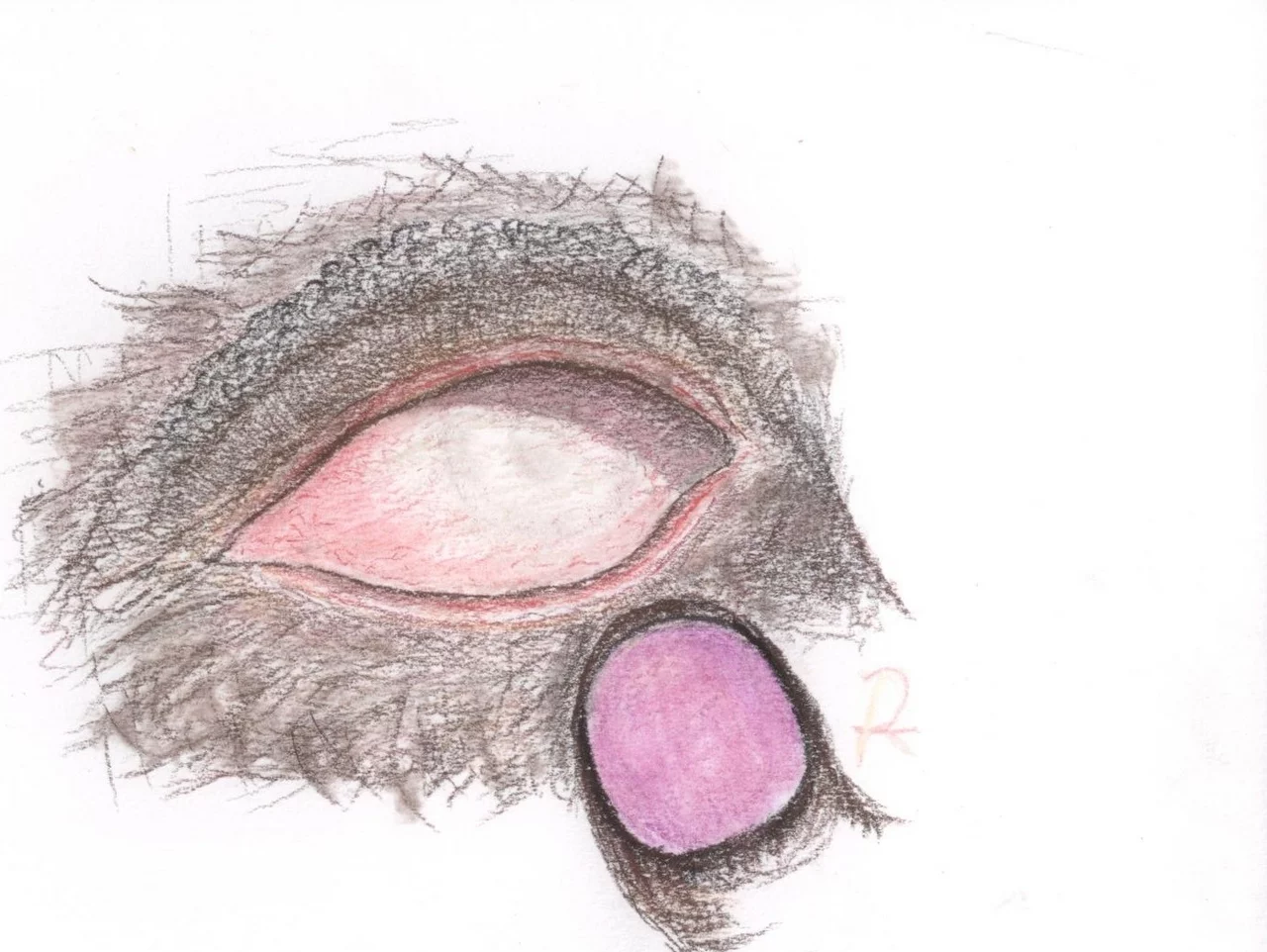
Trachom (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer, 2016)
Eingestellt am 6. April 2024
.

Chlamydiae: Chlamydien
4 Stopp!
.
Wer wagt zu behaupten,
Gott habe die Qual erschaffen
Am Anfang des Lebens auf Erden,
Persönlich, mit Absicht kreiert?
Für uns als Strafe gar,
Als Folge der ersten Menschen verfehlender Tat?
.
Wer wagt es, Gottes Liebe damit zu leugnen?
Der Freiheit der Schöpfung von Anfang an gab,
Als unverzichtbaren Teil seiner gewährten, allumfassenden Liebe,
Auch, wenn Freiheit Tod und Verderben gebiert!
.
Wer wagt es, zynisch zu meinen,
Gott schuf die Mikroben
Für Krankheit und Leiden,
Damit unsere helfende Liebe er prüft?
.
Ungelenkt offenbar
Fanden die quälenden Wesen
Den Weg für ihr eigenes sicheres Leben
In den Körper der Tiere, in der Menschen Leib.
.
O Kreationist[1], denke darüber gut nach,
Ob nicht doch die gottgewollte Evolution
Das Leiden, nicht nur der Menschheit,
Der ganzen Kreatur, viel besser erklärt?
.
Fußnote
[1] Kreationisten: Kreationisten glauben, Gott hätte, wie die Bibel berichtet, die Welt in sechs Tagen so erschaffen, wie heute sie ist und daher könne die Welt nicht älter als fünf- bis sechstausend Jahre sein
Eingestellt am 6. April 2024
.

Clostridia, Clostridien:
1 Falten
.
Missmutig schaut Frau Sauertopf in ihren Spiegel. –
Betrachtet nur kurz das Gesicht,
Wendet sofort wieder ab den traurigen Blick. –
„Wo blieb das Lächeln, das mir vor Jahren doch so gut stand?“
.
„Zwei Falten graben sich, die Nase verlängernd,
Quer durch die Stirn
Und drücken die Brauen herab.
Meine Augenlider schieben sie mit.“
.
„Doch meine Freundin, wie schafft sie es bloß,
Bezaubert noch heute Gesellschaft und Mann.
Glatt wie ein Kinderpopo ist ihre Visage[1].
Ich kann sie schon fast nicht mehr seh‘n!“
.
Sie klagt dem Arzt ihr besonderes Leid.
Er, nicht verlegen, wittert sofort ein Geschäft.
“Ein paar Spritzen“, meint er, „und bald werden sie seh‘n,
All ihre Falten werden vergeh‘n.“
.
Wie ein Zauberwort klingt Botox[2] in ihrem Ohr!
– „Stimmt, davon hab‘ ich bereits gehört!“ –
„Vielleicht hat die Freundin,
Dies auch schon probiert? –
.
Fußnoten
[1] Visage: Gesicht
[2] Botox, Botulinumtoxin: Ein Neurotoxin, wird von verschiedenen Stämmen von Clostridium botulinum, C. butyricum, Clostridum baratii, sowie C. argentinense gebildet und ausgeschieden. Botulinumtoxin ist für Lebewesen, wie auch für Menschen, ein tödliches Gift. Die Verwendung in der kosmetischen Medizin zur vorübergehenden Abschwächung von Falten (Wirkungsdauer 3–6 Monate) ist in Deutschland seit 1993 zugelassen. Es besteht aber das Risiko gravierender Nervenschäden ohne medizinische Notwendigkeit für einen solchen Eingriff.
Eingestellt am 6.April 2024

Clostridia, Clostridien:
2 Herkunft (AP)
.
Ein Bakterium produziert das faltenglättende Medikament,
Exudiert es, zwei Proteine zur Einheit gekoppelt,
In das Medium seiner Kultur.
Gereinigt, in Lösung genommen, erheblich verdünnt,
Sterilisiert, verpackt und verschickt,
Gelangt es in eine Spritze und – in die Stirn.
.
Doch Clostridium botulinum[1] hatte
Etwas anderes vor damit.
Gelänge es selbst in den Körper der Frau
Oder schickte es mit der Nahrung seine Produkte dorthin,
Verschwänden nicht nur die lästigen Falten!
Ein Blick in sein körperbezogenes Leben genügt – und erklärt:
.
In Nahrungsmitteln, ungenügend sterilisiert,
Überleben, weil hitzestabil, Botulinum-Sporen[2],
Keimen, wachsen, aufbereitete Nahrung ungestört lösend,
Tausendzellig heran;
Bringen Verdauungsenzyme nach außen,
.
Die Mahlzeit, unzureichend gekocht,
Enthält dann Botulinum-Bakterien und intaktes Nephrotoxin[5].
Clostridium produziert es ungeniert
Im anaeroben[6] Darminhalt weiter,
Während das Botulinum-Produkt
Unbehindert die Darmwand passiert.
.
Langsam treibt suchend das Gift so dahin,
Trudelnd dreht sich das ungleiche Paar,
Hängt kurz einmal fest, reißt dann wieder sich los,
Bis sein dickeres Ende am richtigen Ankerplatz sitzt.
.
Am Axon[7] der Nerven kommt es zu liegen.
Schon wird es umhüllt auf seinen Befehl
Und wandert, plasmalemmaumhüllt[8],
.
Längst schon zerfiel,
Das saure Milieu im Endosom nutzend,
Das Dipeptid[11] in seine ungleichen Teile.
Kanalförmig bohrt sich das größere Stück,
Dem kleinen den Weg nach außen bereitend,
Durch des Vesikels Membran.
.
Katalytisch[12] Transportproteine zerstörend,
Vergeblich warten nun Muskelfasern auf Acetylcholin[15]
Und bleiben erschlafft.
.
Fußnoten
[1] Clostridium botulinum: Butter-Clostridie
[2] Sporen (Bakterien): Dauerformen, die Bakterien ermöglichen, auch unter ungünstigen Bedingungen (Hitze, Kälte, Austrocknung, Hungerzustand) zu überleben
[3] Nephrophil: nervenfreundlich, an Nerven sich lagernd
[4] Peptide: Kurze Ketten aus (verschiedenen) Aminosäuren.
[5] Nephrotoxin: Nervengift
[6] Anaerob: sauerstofffrei; Anaerobier leben nur unter sauerstofffreien Bedingungen
[7] Axon: Langgezogener, ungegliederter, schlauchartiger, gelegentlich seitlich verzweigter Fortsatz einer Nervenzelle, der elektrische Impulse vom Zellkörper (z. B. Dendrit) wegleitet; auch gegen Ende kann das Axon verzweigt sein. Das Axon, gegebenenfalls seine Seitenzweige, blähen sich am Ende zum präsynaptischen Teil auf, der im anschließenden Axon ein becherförmiges postsynaptisches Gegenstück findet; beide zusammen gelten als Synapse. Axone erreichen Längen von wenigen Millimetern bis zu Metern.
[8] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen mit starrer Zellwand; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt; für Bakterien kein gebräuchlicher Begriff.
[9] Endosom: Mikrobenumschließendes Vesikel entstanden aus einer Zellmembraneinstülpung
[10] Synapsen: Verbindungen zwischen Nervenzellen, bzw. von Axon zu Axon. Dort enden die elektrischen Signale (an der Grenze zwischen prä- und postsynaptischem Teil); die Informationsübertragung erfolgt nun durch Ausschüttung von in Vesikeln gebildeten Neurotransmittern; sie werden vom postsynaptischen Teil aufgenommen, wodurch wieder elektrisches Potential entsteht, das vom Axon rasch weitergeleitet wird.
[11] Dipeptid: Zwei selbständige Peptide sind zu einem Tandem verbunden
[12] Katalyse: Änderung des zeitlichen Ablaufs von chemischen Reaktionen mittels eines Katalysators mit dem Ziel, sie überhaupt in Gang zu bringen oder die Selektivität in eine favorisierte Richtung zu lenken. Der lebenden Zelle dienen Enzyme als Katalysatoren.
[13] Neurotransmitter: Moleküle, die von einer Nervenzelle abgegeben und von einer anderen aufgenommen werden, wodurch Signale im Nervensystem weitergeleitet werden. Als bedeutende Neurotransmitter gelten z. B. Adrenalin, Acetylcholin, Serotonin und Dopamin.
[14] Vesikel (Zellvesikel): Kleine, abgegliederte, rundliche, doppelmembranumhüllte Behälter.
[15] Acetylcholin: kommt im Nervensystem des ganzen Körpers vor und steuert verschiedene Köperfunktionen. Im Gehirn reguliert Acetylcholin überlebenswichtige Funktionen wie Herzschlag und Atmung. Daneben spielt der Botenstoff eine wichtige Rolle für das Lernen und Erinnern.
Eingestellt am 6.April 2024

Clostridia, Clostridien:
3 Entspannt (AP)
.
An neuromuskuläre Synapsen[1] sich setzend,
Peripher an allen bewussten Bewegungen mit,
Nicht nur an Armen und Beinen, auch beim Atmen – und im Gesicht.
.
Als Hemmer, nicht als Helfer,
Erweist sich das heimtückische Gift:
Der Augen Linsen akkomodieren nicht mehr,
Lider erschlaffen, klappen nicht hoch,
Falten verschwinden,
Doch wen interessiert dies noch?
.
Schwindelgefühl, ein schwankender Gang,
Undeutliches Sprechen, jeder Schluck eine Qual,
Atembeschwerden, Angst vor Ersticken.
Kinder fallen in Lethargie. –
.
Lokal beschränkt appliziert,
Wird Botox so manchen Frauen zum Segen,
Doch unerkannt oral genommen,
Wird es zum Fluch!
.
Fußnoten
[1] Neuromuskuläre Synapsen: An Muskelfasern ansitzende Synapsen
[2] Clostridium botulinum: Wurst-Clostridie
[3] Botox, Botulinumtoxin: Ein Neurotoxin, wird von verschiedenen Stämmen von Clostridium botulinum, C. butyricum, Clostridum baratii, sowie C. argentinense gebildet und ausgeschieden. Botulinumtoxin ist für Lebewesen, wie die Menschen, ein tödliches Gift. Die Verwendung in der kosmetischen Medizin zur vorübergehenden Abschwächung von Falten (Wirkungsdauer 3–6 Monate) ist in Deutschland seit 1993 zugelassen. Es besteht aber das Risiko gravierender Nervenschäden ohne medizinische Notwendigkeit für einen solchen Eingriff.
Eingestellt am 6.April 2024

Clostridia, Clostridien:
4 Hinterhältig (AP)
.
Botulinums Bruder Tetani[1],
Gleichfalls den Boden der Erde belebend,
Lauert auf Wunden, sucht,
Rasch sich in offenen Pforten vermehrend,
Frei liegende Nerven
Als Angriffsort für verheerendes Tun.
.
Mit der Peripherie begnügt er sich nicht,
Im Zentrum will er zu Felde zieh’n!
Vermehrt sich anaerob[2]
In Wunden, von Leucocyten[3] verschlossen,
Schickt sein durchtrieb‘nes Toxin[4] als Boten vor sich her,
Erwartet geduldig, was bald schon geschieht.
.
Auch dieses Doppelpeptid[5]
Aus ungleichen Teilen
Nutzt schamlos der Nerven Endocytosesystem[6],
Wandert, ungespalten, vesikelumhüllt,
Gegen den Strom dem Axon[7] entlang,
In der Zelle befehlendes Zentrum[8].
Lässt es, ohne zu zögern, ungeniert liegen,
Mogelt frech sich vorbei,
Sucht sich ein neues Axon,
Setzt, wiederholt Nervenzellen passierend,
Den Weg bis zum Rückenmark ohne Zwischenfall fort,
Bindet final ans Motorneuron.
.
Dem Vesikel durch einen gebohrten Kanal schnell entschlüpft,
Torpediert der proteolytische[9] Teil des Toxins
Der Vesikel Exocytose[10],
Neurotransmitter bleiben zurück;
Lässt Muskeln auf Höchststufe schuften, ganz ohne Halt.
Niemand löst die gewaltige Kraft:
.
Fußnoten
[1] Clostridium tetani: Erreger von Tetanus
[2] Anaerob: sauerstofffrei; Anaerobier leben nur unter sauerstofffreien Bedingungen
[3] Leucocyten: Weiße Blutkörperchen
[4] Tetanospasmin oder einfach Tetanustoxin: Das wichtigste der von Clostridien ausgeschiedenen Toxine. Es hemmt die inhibitorischen Synapsen an den spinalen Motoneuronen sowie die Freisetzung der Neurotransmitter Glycin und GABA. Klinisch zeigt sich dies in einer spastischen Paralyse. (Wikipedia)
[5] Dipeptid: Zwei selbständige Peptide sind zu einem Tandem verbunden
[6] Endocytose: Aufnahme eines Partikels aus der Zellumgebung mit Hilfe eines aus der Zellmembran durch Einstülpung entstandenen Vesikels
[7] Axon: Langgezogener, ungegliederter, schlauchartiger, gelegentlich seitlich verzweigter Fortsatz einer Nervenzelle, der elektrische Impulse vom Zellkörper (z. B. Dendrit) wegleitet; auch gegen Ende kann das Axon verzweigt sein. Das Axon, gegebenenfalls seine Seitenzweige, blähen sich am Ende zum präsynaptischen Teil auf, der im anschließenden Axon ein becherförmiges postsynaptisches Gegenstück findet; beide zusammen gelten als Synapse. Axone erreichen Längen von wenigen Millimetern bis zu Metern.
[8] Dendriten, dendritische Zellen: Zellen mit astartigen Cytoplasmafortsätzen; bei Nervenzellen dienen sie der Aufnahme elektrischer Reize und ihrer Weiterleitung ins Innere der Zelle.
[9] Proteolytisch: Proteine zerlegend
[10] Exocytose: Ausscheiden eines Partikels aus der Zelle mit Hilfe eines sich in die Zellmembran integrierenden Vesikels; der Partikel wird damit durch Ausstülpung ausgeschieden
Eingestellt am 6. April 2024

Clostridia, Clostridien:
5 Verkrampfung (AP)
.
Den Arm zu beugen, den Fuß zu strecken,
Befiehlt automatisch beim Geh‘n das Gehirn;
Feuert Signale
Zum längs sich des Rückens erstreckenden Hauptnervenstrangs.
Bereitwillig folgen die Muskeln des Neurotransmitters[1] Befehl,
Ziehen und schieben die Glieder zum schlendernden Gang.
.
Zunächst nur allmählich, dann ständig verstärkt,
Bleiben Rückbewegungen aus,
Denn, Erschlaffung des streckenden Muskels verhindernd,
Bewirkt das Toxin[2]
Für den beugenden Muskel
Eine schier nicht mehr endende Gegenkraft.
.
Die Glieder verdreh‘n sich,
Bleiben verkrampft und verkrümmt.
Manch einen Wirbel zerbrachen Verkrampfungen schon.
Erlösend steht die Atmung am Ende dann still.
.
Heute verhindert die Impfung alle zehn Jahre
Tetanus‘ grausames Spiel!
Wohl dem, der des Arztes Empfehlungen folgt
Und dem tödlichen Starrkrampf entgeht.
.
Fußnoten
[1] Neurotransmitter: Moleküle, die von einer Nervenzelle abgegeben und von einer anderen aufgenommen werden, wodurch Signale im Nervensystem weitergeleitet werden. Als bedeutende Neurotransmitter gelten z. B. Adrenalin, Acetylcholin, Serotonin und Dopamin, Glycin und GABA.
[2] Tetanospasmin oder einfach Tetanustoxin: Das wichtigste der von Clostridien ausgeschiedenen Toxine. Es hemmt die inhibitorischen Synapsen an den spinalen Motoneuronen sowie die Freisetzung der Neurotransmitter Glycin und GABA. Klinisch zeigt sich dies in einer spastischen Paralyse. (Wikipedia)
Eingestellt am 6. April 2024

Clostridia, Clostridien:
6 Warum nur? (HP)
.
Wie viele andere ihrer Verwandtschaft,
Als anaerobe[3] Brüder im Boden;
Doch nur diese Zwei sinnen auf Tod.
.
Warum produzieren sie fast identisches Toxin,
Das Menschen buchstäblich auf ihre Nerven geht?
Oder ist es vielleicht doch nicht
Nur gegen unser Leben gedacht?
Was mag der Vorteil sein einer solch
Energie und Stickstoff verschlingenden Stoffproduktion?
.
Tiere mit Nerven bewohnen den Boden zuhauf,
Verletzen einander im ständigen Kampf.
Als Räuber ist jeder Beute zugleich.
Für Clostridium gilt dies sicherlich auch.
.
Anaerob lebt sich gut in abgeschotteten Wunden,
Kein Sauerstoff dringt von innen, noch von außen hinein.
In Ruhe sich spaltend, sich potenzierend,
Töten sie, Nerven und Muskeln blockierend, die wehrlos liegende Beute.
.
Kein Blut zirkuliert mehr im Körper umher,
Das zu Clostridium toxischen Sauerstoff brächte:
Kein Halten gibt es für Botulinum und Tetani mehr,
Den Kadaver[4], sich ständig darin vermehrend, dicht zu besiedeln.
.
Vorteile schafft im Kampf ums Überleben diese Strategie,
Die, vertretbaren Aufwand zugrunde gelegt,
Nahrung schier ohne Begrenzung in bester Umgebung
Für ungezählte Nachkommen bringt.
.
Der Preis für Stickstoff in Mengen verbrauchender Mittel,
Kehrt für die beiden zig-fach zurück:
Phosphat und Stickstoff dem leblosen Opfer entnehmend,
Sichern sie Generationen dauerhaften Gewinn.
.
Fußnoten
[1] Clostridium botulinum: Wurst-Clostridie
[2] Clostridium tetani: Erreger von Tetanus
[3] Anaerob: sauerstofffrei; Anaerobier leben nur unter sauerstofffreien Bedingungen
[4] Kadaver: Totes, sich zersetzendes Tier
Eingestellt am 6. April 2004
.

Cyanobacteria, Blaualgen:
1 Blaugrüne Differenzierung
.
Ausdauernde Fotosynthese[1], ständiges Gleiten zum Licht,
Nicht mehr zyklischer Ladungsexpress[4]
Lassen Zellen aufs Fünffache wachsen und mehr.
.
Auch des Lichts Spektrum wird breiter genutzt,
Denn Phycocyanin[5] und sein Zwilling Phycoerythrin,
Leiten als blaue und rote Pigmente
Weitere Lichtwellenlängenbereiche zu Chlorophyllen hin.
.
Als Folge der Fotosynthese, mit Kohlenstoffdioxid[6]
Und Wasser als Spender der Springelektronen, wird Sauerstoff[7] frei.
Er reichert in Luft sich nach und nach an,
Verschmutzt die sauerstoffarme irdische Welt.
.
Versetzt Bionten[8] in arge Bedrängnis,
Werden doch damit manche Stoffe oxidativ[9] auf Dauer zerstört.
So zieh‘n sich viele in sauerstoffarme Gebiete zurück,
Andere passen rasch sich der Umweltänderung an.
.
Fußnoten
[1] Fotosynthetisch (Fotosynthese): Umwandlung von Lichtenergie in Energie organischer Moleküle. Dabei wird letztlich CO2 über komplexe Vorgänge zu energiereicher Glucose aufgebaut. Mit Hilfe von Chlorophyll (Licht!), erzeugtem ATP (zyklischer Elektronentransport) und NADPH2 (azyklischer Elektronentransport) werden von Zellen Zucker synthetisiert
[2] Bakterienchlorophyll: „Bakteriengrün“, bestehend aus Porphyrinringsystem mit angehängter Kohlenstoffkette. Es unterscheidet sich vom „Blattgrün“ durch bestimmte Seitenmoleküle am Porphyrinringsystem (Abbildung unter: „Grundlegendes: 13 Der Clou“)
[3] Chlorophyll a: „Blattgrün“, bestehend aus Porphyrinringsystem mit angehängter Kohlenstoffkette. Es unterscheidet sich vom „Bakteriengrün“ durch bestimmte Seitenmoleküle am Porphyrinringsystem. Innerhalb der Bacteria besitzen nur die Cyanobacteria (Blaualgen) diesen Chlorophylltyp (Abbildung unter: „Grundlegendes: 14 Optimierung“)
[4] Azyklischer Transport von Elektronen: Beim azyklischen Transport von Elektronen wird das Elektron eines Chlorophyllkomplexes nach Abgabe der Energie in Form von ATP nicht mehr zum ursprünglichen Chlorophyllkomplex zurückgeleitet, sondern zu einem zweiten. Dort wird es erneut mit Licht angeregt, um letztlich in einem anderen Reaktionszentrum zu landen. Von da an wird es mit Hilfe von weiteren Enzymen verwendet NADH2 zu bilden. Es gelangt nicht wieder zum Ursprungsort zurück und geht damit den Chlorophyllen endgültig verloren. Der erste Chlorophyllkomplex holt sich das fehlende Elektron von H2S, wobei Schwefel entsteht, bzw. in Laufe der Evolution von Wasser [H2O] unter Bildung von Sauerstoff. Daher ist der Transport der Elektronen nicht mehr zyklisch, sondern azyklisch (Abbildung unter: „Grundlegendes: 14 Optimierung“)
[5] Phycocyanin und Phycoerythrin: In offener Kette vorliegende, über konjugierte Doppelbindungen verknüpfte, Stickstoffheterozyklen, die ihr Lichtabsorptionsmaximum bei 615-640 nm, bzw. 490-580 nm aufweisen und Licht absorbieren können, das von Chlorophyllen sonst nicht erfasst wird. Damit sind die Organismen in der Lage, auch in tieferen Schichten oder im lichteren Schatten Licht zu sammeln. Deshalb gehört Phycocyanin (zusammen mit Phycoerythrin) zu den lichtsammelnden Komplexen der Photosynthese. Phycocyanin und Phycoerythrin sind mit Proteinen zu sog. Phycobiliproteinen verbunden und kommen in unterschiedlichen Anteilen meist gemeinsam vor. Phycocyanin erscheint blau, Phycoereythrin rot. In offener Kette vorliegende, über konjugierte Doppelbindungen verknüpfte, Stickstoffheterozyklen, die ihr Lichtabsorptionsmaximum bei 615-640 nm, bzw. 490-580 nm aufweisen und Licht absorbieren können, das von Chlorophyllen sonst nicht erfasst wird. Damit sind die Organismen in der Lage, auch in tieferen Schichten oder im lichteren Schatten Licht zu sammeln. Deshalb gehört Phycocyanin (zusammen mit Phycoerythrin) zu den lichtsammelnden Komplexen der Photosynthese. Phycocyanin und Phycoerythrin sind mit Proteinen zu sog. Phycobiliproteinen verbunden und kommen in unterschiedlichen Anteilen meist gemeinsam vor. Phycocyanin erscheint blau, Phycoereythrin rot (Abbildung unter: „Grundlegendes: 14 Optimierung“)
[6] Kohlendioxid: gestrecktes Molekül [O=C=O]
[7] Sauerstoff (molekular, O2): Zwei Sauerstoffatome über Doppelbindung verknüpft [O=O]; Sauerstoff besitzt acht Protonen (8O); 8 bis 10 Neutronen hinzu; (8O, Anzahl der Protonen = Ordnungszahl 8)
[8] Bionten: Allgemeine Bezeichnung für Lebewesen
[9] Oxidativ: durch Ozon, O3, ein aus drei Sauerstoffmolekülen bestehendes, instabiles Molekül; beim Zerfall entsteht ein Sauerstoffradikal, das stark oxidierend wirkt und diverse Moleküle angreifen und zerstören kann
Eingestellt am 6. April 2024
.

.
Cyanobacteria, Blaualgen:
2 Blaualgen
.
Umgeben mit kräftiger Scheide
Gelingt es, Zeiten versiegenden Wassers
Erfolgreich zu trotzen.
.
Mitunter bleiben die Zellen lange verbunden,
Bilden große, zellwandverschleimte Blaualgenmatten,
Auch lockere Fäden aus gleichgestalteten Zellen.
Sie gleiten[3] dahin oder setzen sich fest.
.
Nicht jede der Zellen bewegt sich,
Schweben oft nur lange im Wasser.
Regulieren mit Gasen im Innern
Optimal den Abstand zum einfallenden Licht.
.
Manche verzweigen sich, bilden Systeme,
Werden polar[4], an der Spitze sehr dünn,
Begrenzen Zellteilung auf
Zellen der vordersten Front.
.
Zerfallen in Zellen dient der Vermehrung.
Bilden Bruchstücke oft, Hormogonien[5] genannt.
Sporen[6] im Innern zu formen bleibt Rarität,
.
Fußnoten
[1] Murein: Zellwand fast aller Bakterien, in der kettenförmig verbundene Zuckermoleküle, an denen Ammoniumgruppen (–NH2) hängen und diese wieder mit verschiedenen Molekülen verknüpft sind. Diese Ketten sind noch durch kurze Folgen von Aminosäuren verbunden und ergeben so einen sehr stabilen Sack um die Zelle
[2] Glucane: Generelle Bezeichnung für aus Zuckern entstandene Substanzen¸
[3] Blaualgengleiten: Als Schleimrutscherei wurde diese Bewegung schon oftmals bezeichnet, nahm man doch an, an der Vorderseite ausgeschiedener Schleim würde den Faden nach vorne drücken. Doch ist der Mechanismus noch nicht aufgeklärt; ob Mikrofibrillen im Schleim (wohl verbunden mit den Zellen) eine Rolle dabei spielen wird diskutiert; auch die schwingende Bewegung mancher Arten mit freistehenden Fäden ist noch nicht verstanden.
[4] Polare Fäden: Manche Blaualgenfäden laufen nach oben (wenn freistehend) spitz zu, wobei sich die einzelnen Zellen in Länge, Durchmesser unterscheiden. Eine gestaltliche Polarisierung von Fäden ist ein häufiges Phänomen in der Evolution.
[5] Hormogonien: Entstehen durch Absterben und Kollabieren einzelner Zellen eines Blaualgenfadens; das zwischenliegende Stück verselbständigt sich und kann als neues Individuun zu einem neuen Faden auswachsen.
[6] Sporen (Bakterien): Dauerformen, die Bakterien ermöglichen auch unter ungünstigen Bedingungen (Hitze, Kälte, Austrocknung, Hungerzustand) zu überleben; bei Cyanobacteria können sich einzelne Zellen vergrößern, die Zellwand verdicken und mit Reservestoffen anfüllen; oft als Akineten bezeichnet.
[7] Heterocysten (Cyanobacteria): Etwas vergrößerte, leicht bräunliche, inhaltsleer erscheinende Zellen, die mit inneren Beulen an grüne Nachbarzellen grenzen; sie sind Orte der Luftstickstofffixierung in sauerstofffreiem Raum
[8] Stickstofffixieren: Nur Prokaryoten sind in der Lage, inerten molekularen Stickstoff (N2) der Luft in organismenverfügbaren, z. B. in [–NH2] gebundenen Stickstoff, überzuführen.
Eingestellt am 6. April 2024
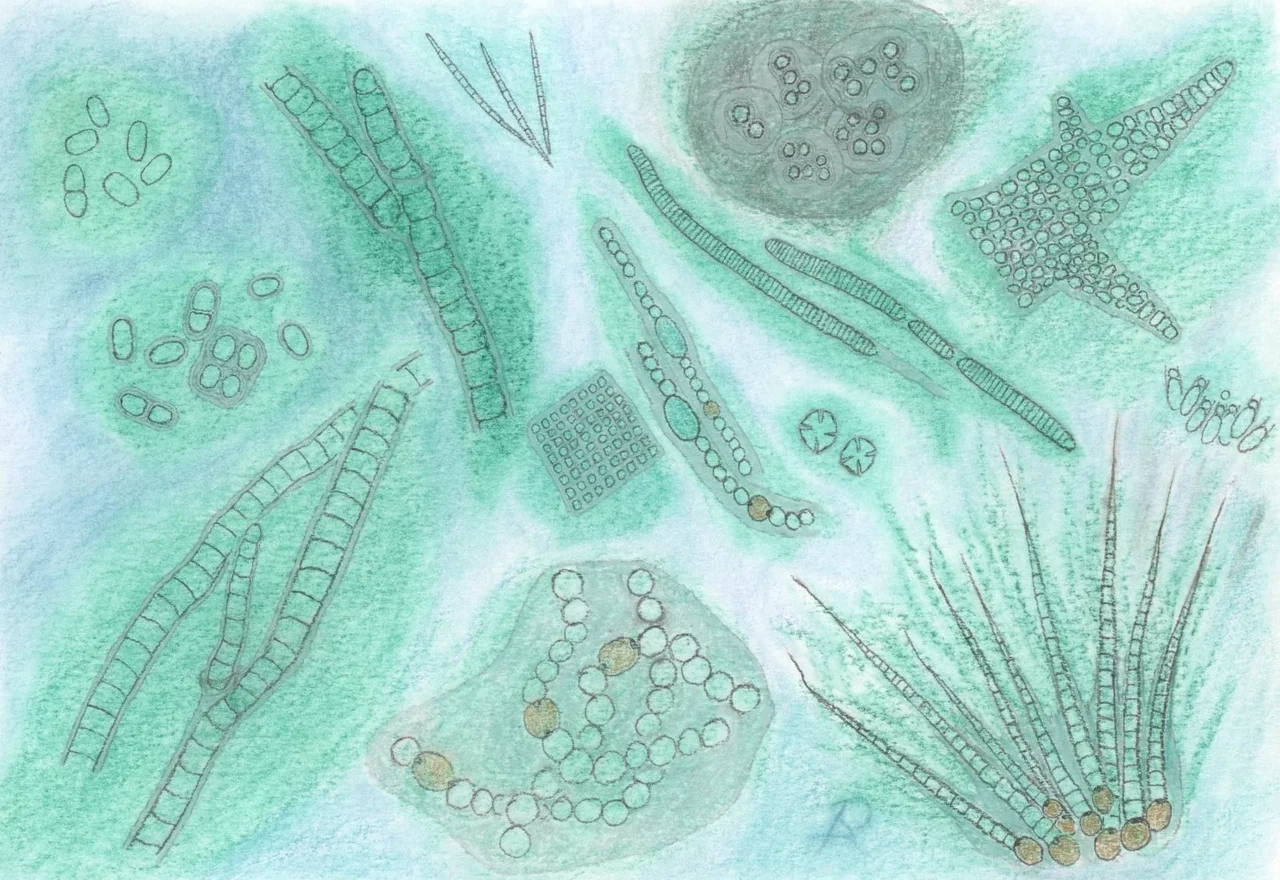
Formenkompositionen in Blaugrün (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer, 2017)
Blaualgen verschiedener Organisationsformen: Coccal als Einzelzellen in Schleim gebettet (links oben); mit dicker Zellwand versehen, die Teilungsstadien noch gut zusammenhält, Gattung Chroococcus (gleich darunter); Fäden, die sich verzweigen, indem sich ein Tochterfaden aus der Hülle des Mutterfadens zwängt und dabei seine eigene bildet, Gattung Scytonema (zwei unterschiedliche Ansichten; rechts sich anschließend); perlschnurartige Fäden in gemeinsamer Schleimhülle mit Heterocysten, Gattung Nostoc (Mitte unten); polar gestaltete Fäden, basal jeweils mit einer Heterocyste, Gattung Rivularia (rechts unten); eine ebene, rechteckige Platte aus Einzelzellen, von gemeinsamer Schleimschicht zusammengehalten, Gattung Merismopedia (Zentrum); Fäden mit Heterocysten und Akineten, Gattung Anabaena (gleich daneben); beidseits zugespitzte kurze Fäden, Gattung Dactylococcopsis (oben, links der Mitte); Kolonie vieler Zellen mit geschichteten Zellwänden, die entsprechend der Teilungsfolge davon noch zusammengehalten werden, Gattung Gloeocapsa (oben, rechts der Mitte); Fäden, die sich in Hormogonien zerteilen, Gattung Oscillatoria (unmittelbar darunter); Zellen mit ins Lumen vorspringenden Wänden, Tetrapedia crux-melitensis (darunter); polar wachsende, vielzellige Blaualge mit echten Verzweigungen, Gattung Stigonema (rechts oben); Blaualgen, aus geöffneter umgebender Schleimschicht, Tochterzellen entlassend, Gattung Chamaesiphon (Mitte rechts). (Nach Streble H, Krauter D (1981) Das Leben im Wassertropfen. Kosmos Naturführer. 5. Auflage)
Eingestellt am 6. April 2024
.

Cyanobacteria, Blaualgen:
3 Warum nicht auf dem Land?
.
Ufernah lagern sich dichte und weite Schichten der Fäden.
Betreiben millionenfach Fotosynthese[1].
Fällt Kalk[4] aus dem calciumhaltigen Wasser.
.
Lagert sich ab zwischen sterbenden Fäden,
Baut Schichten um Schichten zur mächtigen Kuppe.
Sie blieben erhalten als Stromatolithen[5]
Milliarden von Jahren. –
.
In den Hängen der felsigen Berge
Bedecken wasserberieselte, schattige Flächen
Oft pechschwarze Flecken und Striche[6]
.
Verwundert steht oft der Wanderer,
Sinnt über den Grund der Verschmutzung,
Denkt nicht an Milliarden von Jahren,
Seit solche Wesen besteh‘n.
.
Fußnoten
[1] Fotosynthetisch (Fotosynthese): Umwandlung von Lichtenergie in Energie organischer Moleküle. Dabei wird letztlich CO2 über komplexe Vorgänge zu energiereicher Glucose aufgebaut. Mit Hilfe von Chlorophyll (Licht!), erzeugtem ATP (zyklischer Elektronentransport) und NADPH2 (azyklischer Elektronentransport) werden von Zellen Zucker synthetisiert
[2] CO2, Kohlendioxid: ein gestrecktes Molekül [O=C=O]
[3] Respiration: Enzymatisch katalysierte Zellatmung grüner Organismen bei Dunkelheit, bei der Sauerstoff verbraucht und der Umwelt entzogen, dafür [CO2] ihr im Gegenzug zugeführt wird
[4] Kalk: Calciumcarbonat [CaCO3]
[5] Stromatholithen: Durch Mikroorganismen verursachte Sedimentgesteine, die in regelmäßigen, vielzählig aufeinanderfolgenden Schichten aus Kalkstein in uralten Gesteinsformationen aufzufinden sind
[6] Tintenstriche: Auffällige, schwarze oft breitstrichförmige, ach unten zu schmäler werdende Beläge an fast senkrechten Felswänden
[7] Gloeothrix (Cyanobacteria – Bacteria)
[8] Gloeocapsa: Hüllenblaualge (Cyanobacteria – Bacteria); (Abbildung unter „Cyanobacteria, 2 Blaualgen“)
Eingestellt am 6. April 2024
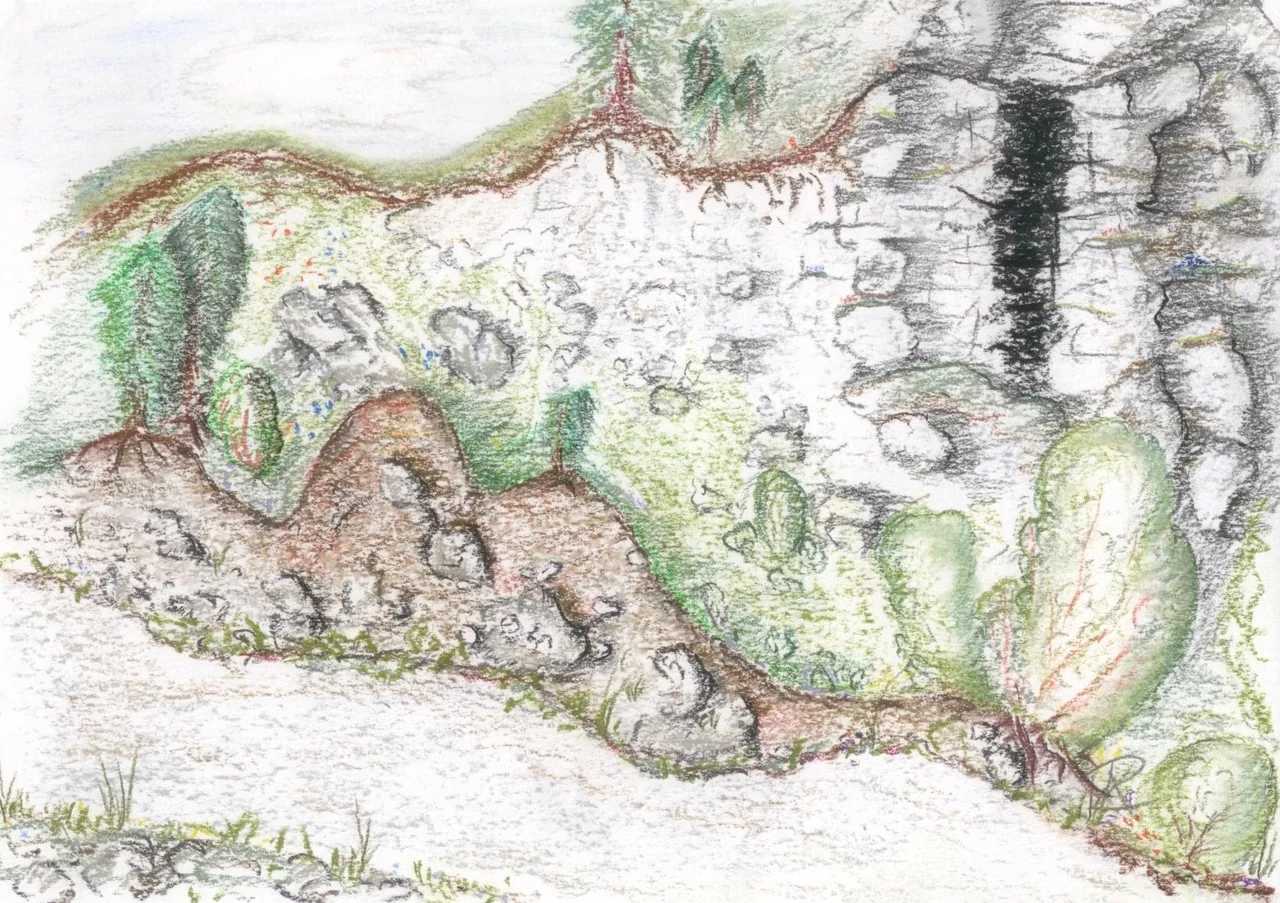
Tintenstrich (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer, 2017)
Eingestellt am 6. April 2024
.

Delta-Proteobacteria:
1 Aggressor (AP)
.
Frei schweben im lauen Wasser dichte Schwaden von Bakterien,
Dies verlockt die Neider, Faulen, Diebe und Bequeme:
Suchen rastlos nach den Pforten, auszunutzen Fremder Müh‘n.
.
Jagen unstet, geißelschwingend in der Herde Zwischenräume;
Schmiegen sich an Fremder äußere Membran,
Finden nicht den Weg jedoch, in Zellen vorzudringen.
Heißersehnte Nährstoffmittelmengen bleiben wohlverwahrt.
.
Plötzlich aber rast ein winziges Geschoss mit wild rotierendem Propeller
Zielgenau auf eine ahnungslose Zelle zu!
Bleibt ermattet liegen vor der Zelle letzter Grenze aus Lipid[5].
.
Fast gewonnen – leider kurz noch vor dem Ziel versagt.
Doch halt! Enzyme[6] des Aggressors dringen leicht durch die Membran,
Zerkleinern große Moleküle mundgerecht in Ministücke,
Wandern dann und ohne Zwang zum matten Bdellovibrio[7].
.
Er streckt sich folglich lang zum Faden,
Raubt der Zelle nach und nach
Alles fast, wessen er bedarf.
Lässt des Wirtes Zellenraum zusammenschrumpfen – bis zum Nichts.
.
Wohlernährt zerbricht er seinen Faden flugs in lauter kleine Kommata.
Schnell noch dann die Geißeln produziert,
Schon verlassen sie, auf neue Beute lauernd,
Schwarmesgleich den scheinbar wohlbeschützten Raum durch Murein. –
.
Auf Kosten eines Andern sein Leben zu gestalten
Wird bald zum vielgefragten modischen Design.
Gefallen lassen – oder wehren – oder gar den Spieß umkehren?
Bleibt die schicksalshafte Frage alles Lebens über Jahrmilliarden hin!
.
Fußnoten
[1] Lipide (Fettes Öl): Ein Triglycerid aus Glycerin (mit drei [–OH]-Gruppen) und drei Fettsäuren, die als Fettsäurereste unter Wasserabspaltung ans Glycerin gebunden und eine Bindungsgruppe –C–O–(C=O)– ergeben
[2] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt
[3] Äußere Lipiddoppelmembran: eine zusätzlich Lipiddoppelmembran, die gramnegative Bakterien umgibt, die Grampositiven fehlt
[4] Murein: Zellwand fast aller Bakterien; an kettenförmig verbundenen Zuckermolekülen, hängen Ammoniumgruppen (–NH2) und diese sind wieder mit verschiedenen Molekülen verknüpft. Diese Ketten werdedn noch durch kurze Folgen von Aminosäuren verbunden und ergeben so einen sehr stabilen Sack um die Zelle (Abbildung unter „Bacteria 1 Steckbrief“)
[5] Innere Lipiddoppelmembran, Plasmamembran: Lipiddoppelmembran, die jedes Organismus‘ Zellinneres umgibt
[6] Enzym: Protein, das, an spezielle Moleküle angepasst, die Synthese katalysiert. Meistens werden mehrere Enzyme zu einem Komplex verbunden, um eine räumliche Nähe zwischen den einzelnen, aufeinanderfolgenden Syntheseschritten herzustellen
[7] Bdellovibrio bacteriovorus: Killerbakterium (Delta-Proteobacteria – Gramnegative – Bacteria)
Eingestellt am 6. April 2024
.

Enterobacteriaceae: Escherichia
1 Aufregung in Bienenbüttel (AP)
.
Halb Deutschland erschreckte blutiger Durchfall und Nierenversagen,
Denn mehr als fünfzig Personen starben daran!
Doch woher kam der Erreger, der als EHEC[1] entlarvt?
Wo war nur das Zentrum der Epidemie?
.
Gemüse, in Norddeutschland Endverbrauchern verkauft,
Stand bald auf der Liste.
Auf Gurken[2] aus Spanien fiel schnell der Verdacht.
Warnung vor dem Verzehr brachten der spanischen Firma fast den Ruin,
Doch Vermutungen nur wurden verkündet,
Verbreiteten sich nach dem Schneeballprinzip.
Fehlanzeige kam dann aber viel zu spät.
Der Irrtum galt lang als hinzunehmender Fakt[3].
.
Sprossen[4], gezogen in Bienenbüttel, kamen am Schluss ins Visier,
Denn viele Erkrankte verspeisten
Getriebene Samen aus dieser Stadt.
Verseucht jedoch waren ein paar nur davon.
.
Alles ging ordnungsgemäß zu im Grünzeuganzuchtbetrieb:
Sprühwasser, Wannen und Werkzeuge zeigten keinen Befund.
Bockshornklee[5], Trigonella-caerulea-Samen, aus Ägypten gesandt,
Trugen EHEC-Bakterien auf der Haut[6] jedoch.
.
Einen Teil der Fälle nur erklärten Bockshornkleesprossen.
Woher EHEC sonst noch kam, blieb ungewiss,
Obwohl den Behörden nicht unbekannt,
Dass Vieh oft Träger dieser Bakterien ist.
.
Fußnoten
[1] EHEC, sprich ehec: Enterohämorrhagische Escherichia coli
[2] Gurken: Cucumis sativus (Cucurbitaceae – Cucurbitales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae – Rosidae - …)
[3] Fakt, Faktum: Tatsache
[4] Sprossen: Samen werden unter feuchten Bedingungen zum Keimen gebracht, wenn groß genug, zusammen mit Samen geerntet und verzehrt
[5] Bockshorn-Klee: Trigonella caerulea (Faboideae – Fabaceae – Fabales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae – …)
[6] Samenschale
Eingestellt am 6. April 2024
.

Enterobacteriaceae: Escherichia
2 Gülle (AP)
.
Stickstoff, durch Ernten entzogen,
Bahnt oft Mangel an Nährstoffen an
Für Feldfrüchte, Kohlköpfe und auch Salat.
Organisch gedüngt, falls Gülle versprüht, bringt kostengünstig Ersatz.
.
Zu harmlosen Artgenossen des Bodens dabei;
Schätzt aber, auch wenn mit Blättern sie in die Höh‘ wird gehoben,
Die neue Umgebung nicht.
.
Veruneinigtes Gießwasser nimmt sie gern als Vehikel,
Magerernährung dort zu entkommen,
Hin zu unerschöpflichen Quellen,
Nachdem der Mensch Colis[3] Träger, erntereif nun, genoss.
.
Säureresistent wie Helicobacter[4],
Passiert unversehrt sie den Magen,
Lässt sich, peristaltisch[5] getrieben, transportieren
Bis an die Darmwand heran.
.
Bringt biologische Waffen in Stellung:
Ergreift, Shiga-Toxin[6] sezernierend, unverzüglich die Initiative!
Setzt, aus fünf gleichen Teilen, einem sechsten, separaten, gebaut,
Das Angriffsmittel zweiphasig ein:
.
Das Fünfergespann verhilft,
Abwehr der Zellen entscheidend zermürbend,
Seinem Giftstück ins Herz des feinabgestimmten Betriebs,
Zum Proteinsynthesemodul.
.
Ergiebig und dauerhaft produzieren EHEC[7]-Bakterien
Ihr ribosomendeaktivierend[8] wirkendes Gift,
Denn schon durch eines einzigen Adenins[9] Spaltung zerstören sie
Der Ribosomen Hilfe im Zuge der Translation[10].
.
Shiga-Toxine überfluten,
Von darmwandumgebenden Blutkapillaren weit verbreitet,
Umfassend den Körper,
Konzentrieren meist sich aber auf der Nieren Epithel[11].
.
Epithelzellen schädigend, verlocken Shiga-Toxine
Behindern so des abfallbeladenen Bluts Filtration,
.
Die Entsorgung belastender Stoffe.
So ruft es manchmal tödlich verlaufendes HUS[14] hervor,
Das hämolytisch-urämische Krankheitssyndrom.
.
Das alternative Bild,
Thrombotisch-thrombozytopenisches Purpura Syndrom[15], TPP,
Fleckt die Haut mit rötlichen Punkten,
Schädigt, recht selten jedoch, auch das Gehirn.
.
Fußnoten
[1] Escherichia coli: (Enterobacteriaceae – Gamma-Proteobacteria – Gramnegative – Bacteria); Gehört zum normalen Mikrobiom des menschlichen Darms; einige Stämme aber können Durchfallkrankheiten verursachen
[2] Stammbezeichnung. Bezeichnung eines Isolats)
[3] Escherichia coli
[4] Helicobacter pylori: Erreger von Magengeschwüren, gelegentlich von Magenkrebs
[5] Peristaltik: Fortschreitende, wellenförmige Bewegung des Darms, um den Nahrungsbrei voranzudrücken
[6] Shiga-, Shigella-Toxine: Cytotoxische, bakterielle Exotoxine, die als Translationshemmer wirken
[7] EHEC (sprich ehek): Enterohämorrhagische Escherichia coli
[8] Ribosom: Organell aus ribosomaler RNA und Proteinen. Es dient zur Translation der mRNA-Informationen in Proteine. Meist sind mehrere Ribosomen über die mRNA kettenartig verbunden, um zugleich mehrere Ablesevorgänge hintereinander ablaufen lassen zu können
[9] rRNA: ribosomale RNA, verknäuelt sich unter Beteiligung von Proteinen zu Ribosomen
[11] Epithel: Ein- oder mehrlagige Zellschichten, die alle inneren und äußeren Körperoberflächen von Echten Tieren (Animalia) bedecken
[12] Fibrine: Nicht in Wasser lösliche Blutproteine; der Fibrinbelag hilft dem Wundverschluss
[13] Thrombocyten: Für Blutgerinnung zuständige, zirkulierende Zellfragmente
[14] HUS, Hämolytisch-urämisches Syndrom: „Hämolytisch“ heißt, rote Blutkörperchen werden abgebaut, „urämisch“, die Nierenverletzung verursacht Ansammlung von Harnstoff im Blut.
[15] TPP, Thrombotisch-thrombozytopenisches Purpura Syndrom: Thrombotisch“ bedeutet, Blutgerinnsel entstehen und „thrombozytopenisch“, die Blutplättchenzahl ist gering, „Purpura“ weist auf purpurfarbene Stellen hin oder auf Blutergüsse der Haut hin.
Eingestellt am 6. April 2024
.

Enterobacteriaceae: Escherichia
3 Unterschoben (AP)
.
Escherichia coli[1], ein Generalist,
Lebt als Verdauungshelfer, als Vitamin K[2] Lieferant
Nicht nur im Darm. Auch im Süßwasser, im Meer und im Boden
Fühlt es sich wohl.
.
Ideal für Phagen[3]:
Wenn spezialisiert auf E. coli,
Finden sie Wirte und Nahrung
Fast überall.
.
Phagen übergaben E. coli Sequenzen des Shiga-Toxins.
Es Integrierte sie ins Ringchromosom,
Und H7, ein spezielles Flagellenprotein[7], codiert es immer schon selbst.
.
Woher nahm wohl der Phage die heimtückische Information?
Vielleicht von Shigella[8], ausstaffiert mit gleichem Toxin,
Oder brachte der Phage beiden die Rezeptur?
Doch fragt sich, woher und warum?
Was könnte für sich damit er tun,
Wenn er sein Leben ausschließlich auf das von E. coli baut?
.
Fußnoten
[1] Escherichia coli: (Enterobacteriaceae – Gamma-Proteobacteria – Gramnegative – Bacteria); gehört zum normalen Mikrobiom des menschlichen Darms; einige Stämme aber können Durchfallkrankheiten verursachen
[2] Vitamin K: Stärkt Knochen und schützt vor Blutungen. Der Körper muss es über die Nahrung aufnehmen, weil er es nicht selbst produzieren kann.
[3] Phagen: Ausschließlich Bakterien (und Archäen) infizierende Viren
[4] O157H7: Stammbezeichnung, Isolatbezeichnung
[5] Lipopolysaccharide: Fett-Zucker-Moleküle
[6] Antigene: Oberflächen (Glyco)Proteine, generell molekulare Strukturen von Pathogenen, die von Immunzellen Befallener als fremd erkannt werden und daraufhin Antikörper dagegen entwickeln
[7] Flagellin: Globuläres Protein, das sich zu vielen selbst zu einem Hohlzylinder anordnet und im westlichen das Flagellum der Prokaryoten (Bakterien und Archäen) bildet
[8] Shigella: Löst Durchfallerkrankungen aus (Enterobacteriaceae – Gamma-Proteobacteria – Gramnegative – Bacteria)
Eingestellt am 6. April 2024
.

Enterobacteriaceae: Escherichia
4 Zerteilt und verteilt (AP)
.
Symptomlos lebt EHEC[1], in Därmen von Rindern,
Verlassen zu Millionen der Zuflucht Ort.
Bleiben jedoch beim gewaltsamen Ende ihres Ernährers,
Im Kadaver ohne Verbreitung zurück.
.
Gehäutet, in der Mitte zerteilt, zerlegt,
Innereien entnommen,
Werden unbeabsichtigt bisweilen EHEC-Bakterien
An diverse Fleischstücke geklebt.
.
Minimale Anzahl von Zellen,
Den menschlichen Magen passierend,
Zehn bis hundert oft nur,
Reichen für folgenschwere Kontamination.
.
Stück für Stück frikassiert,
Als Hamburger oder als Hackbraten serviert,
Erzwingt Braten bei hundertundsechzig Grad,
Denn nur diese Temperatur bringt Erregern den sicheren Tod
.
Fußnote
[1] EHEC (sprich ehek): Enterohämorrhagische Escherichia coli
Eingestellt am 6. April 2024
.

Enterobacteriaceae: Salmonellen
1 Wuschel (AP)
.
Rundherum mit Flagellen[1] besetzt,
Nach hinten zum Bündel gepackt,
Von der sie lang schon getrennt,
Immer auf Suche nach besserer Nahrung
Rastlos dahin.
.
Breiig durchflutet, wellendurchwalkt nach abwärts getrieben,
Erreicht Salmonella kurz vor dem Ausgang
– Mit Hilfe sondierender Zellen des Darms –
Gerade zur rechten Zeit noch festen Halt an der Wand.
.
Den Plan der Zelle, sie einzusacken, sie zu verdauen,
Durchkreuzt, Proteine[4] der Zelle injizierend, Salmonella geschickt.
Nimmt selbst das Heft in die Hand,
Entfaltet raffiniert den eigenen Plan.
.
Längst wirken die Boten genau nach System,
Bestimmen der Zelle Actinbündel[5] Ziele vollkommen neu,
Senden koordiniert sie gegen die Peripherie,
Salmonella in Falten der Außenmembranen[6] zu hüllen.
.
Nicht nach der Zelle Willen,
Nach eig‘nem Gutdünken,
Dringt Salmonella membranumgeben[7] nun vor:
Umschifft so der Abwehr schützende Front.
.
Auch das zweite Bollwerk der Abwehr umgeht sie geschickt,
Denn, einen weiteren Kampfstoff verteilend,
Verhindert sie den Abtransport.
Lässt das Lysosom[8] unverrichteter Dinge vor der Tür.
.
Das letzte Mittel, den Selbstmord[9] der umgebenden Zelle,
Um andere vor ihr zu schützen, verhindert Salmonella ebenso.
Veranlasst Bildung und Austritt von Cytokinen[10],
Lockt so Makrophagen[11] als weitere nichtsahnende Opfer heran.
.
In der Schicht aus Drüsen, glatter Muskulatur, Gefäßen für Lymphe[14] und Blut,
Bewirkt Salmonella starke Entzündungsreaktionen
Mit Bauchkrämpfen, Durchfall und hohem Elektrolytverlust[15].
.
Fußnoten
[1] Flagellum, Geißel (Bakteriengeißel): Aus vielen globulären Flagellinproteinen zusammengesetzte Hohlröhre
[2] Salmonella enterica in verschiedenen Subspezies und Varietäten: Erreger von Salmonellose, Paratyphus und Typhus
[3] Escherichia coli: Gehört zum normalen Mikrobiom des menschlichen Darms; einige Stämme aber können Durchfallkrankheiten verursachen
[4] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt
[5] Actin, Fädiges Actin: Actin ist ein häufiger Bestandteil des Cytoskeletts und kommt besonders in Muskelzellen vor; zu Fäden polymerisiert (F-Actin), dient es der Stabilisierung der äußeren Zellform sowie der Ausbildung von Zellfortsätzen, intrazellulären Verlagerungen und gerichteten intrazellulären Bewegungen.
[6] Äußere Lipiddoppelmembran: eine zusätzlich Lipiddoppelmembran, die gramnegative Bakterien umgibt, die aber Grampositiven fehlt
[7] Endosom: Mikrobenumschließendes Vesikel, entstanden aus einer Zellmembraneinstülpung
[8] Lysosomen: Von einer Membran umschlossene kugelförmige Zellorganellen von Eukaryonten; enthalten hydrolytische Enzyme und Phosphatasen, mit denen sie Fremdstoffe oder körpereigene Stoffe abbauen.
[9] Apoptose: Programmierter Zelltod
[10] Cytokine: Weisen multiple Wirkung auf Wachstum und Entwicklung von Pflanzen auf (finden sich aber auch in anderen Organismen), sind als Phytohormone in jeder Pflanzenzelle vertreten. Das Kinetin, z. B. fördert die Zellteilung.
[11] Makrophagen: Fresszellen; weiße Blutkörperchen, die sich aus Monocyten bildeten
[12] Epithel: Ein- oder mehrlagige Zellschichten, die alle inneren und äußeren Körperoberflächen von Echten Tieren (Animalia) bedecken
[13] Lamina propria: Dünne, subepitheliale Bindegewebsschicht in Hohlorganen, die sich direkt unterhalb der Basalmembran des auskleidenden Epithels befindet.
[14] Lymphgefäße: Gefäße mit letztlich dreischichtigem Wandaufbau und passiven Klappen, die ein Rückfließen der Lymphe verhindern; Muskelzellen können die Flüssigkeit vorwärtsdrücken.
[15] Elektrolyte: Wichtige in Flüssigkeit gelöste Mineralien des Körpers; gehen bei Durchfallerkrankungen oft in erheblichem Maße verloren
Eingestellt am 6. April 2024
.

Enterobacteriaceae: Salmonellen
2 Kontamination (AP)
.
Mit Doppelstrategie
Versucht der Körper sich von Salmonellen zu trennen:
Als Primärmanöver jagt der Darm mit Diarrhoe[1],
Falls ausreichend Nachschub gegeben,
Im wässrig-eruptiven Strome,
Die restlichen Zellen aus dem Colon[2].
.
Makrophagen[3] besiegen,
Auf Salmonellas[4] Überrumpelungscoup bald reagierend,
Doch noch entscheidend der Invasoren Gewalt,
Bis sich der Patient, meist ohne Komplikation, langsam erholt.
.
Freigesetzt, legen Salmonellen sich fest an die Haut,
Erhöhen der Mikroben Diversität[5],
Hoffen auf Bleiberecht,
Mit Chancen auf Propagation.
.
Hygiene wäscht sie komplett vom Ort,
Doch sie lässt des Pathogens Hoffnung besteh‘n,
Sich mit Reserven begnügend,
In die Offensive zu geh‘n.
.
Hände übertragen Salmonellen auf Lebensmittel verschiedener Art,
Sowie auf Futter von Hühnern und Vieh.
So werden Fleisch und Eier oft kontaminiert,
Was zu Neuinfektionen möglicherweise führt.
Werden Nahrungsmittel nicht ausreichend gekocht und erhitzt,
Ist Salmonella Gewinner gewiss.
.
Eier, nicht vollkommen gegarte Hühnerfilets,
Ein salmonellenerkrankter Helfer in der Fabrik,
Verbreiten Salmonellen in Nu,
Wie in USA war es mit Crackern einmal der Fall.
.
Erdnussbutter, salmonellenbeladen,
Einer einzigen Produktion
Verseuchte mehr als siebenhundert Personen,
Bis ein Gesundheitsdienst die Salmonellenquelle letztendlich fand.
.
Wer hat nicht schon enttäuscht,
Weiche Eier erwartend am Frühstücksbüffet,
Ein dotterhartes Stück geköpft?
Salmonellen waren dafür der Grund.
.
Fußnoten
[1] Diarrhoe: Durchfall
[2] Colon: Hauptteil des Dickdarms
[3] Makrophagen: Fresszellen; weiße Blutkörperchen, die sich aus Monocyten bildeten
[4] Salmonella enterica in verschiedenen Subspezies und Varietäten: (Enterobacteriaceae – Gamma-Proteobacteria – Gramnegative – Bacteria); Erreger von Salmonellose, Paratyphus und Typhus
[5] Diversität: Artenvielfalt
Eingestellt am 6. April 2024
.

Epsilon-Proteobacteria:
1 Selbstversuch (AP)
.
„Das können sie jedem erzählen, Marshall[1], mir jedoch nicht,
Dass ihr Bakterium in der Lage wär,
pH-Werte[2] von eins in der Magensäure zu überleben.
Ihr Bakterium stammt sicher von einer Kontamination!“
.
Düpiert ließ der Forscher den Zweifler steh‘n,
Wusste er doch
Um die sorgsame Arbeit,
Die zuverlässige Leistung seines Labors,
Um das mehrfache Prüfen des überraschenden,
Aufsehenerregenden Resultats.
.
Zurück von der Tagung, greift er zum letzten Mittel,
Den Beweis zu erbringen:
Schluckt die Reinkultur des bezweifelten Isolats,
Holt nach einiger Zeit eine Probe mit der Sonde wieder hervor.
.
Gewinnt erneut Reinkulturen, auf schon erprobten Medien,
Unterwirft das Isolat dem pH-Stufentest.
Findet ein Wachstumsoptimum[3] zwischen pH fünf und sechs,
Ein Überleben jedoch bei pH eins,
Denn nach Transfer in weniger saure Medien,
Nimmt es die Teilung sofort wieder auf.
.
Es überlebt die Säure,
Der Beweis ist erbracht!
Doch vermehrt im Magen es sich?
Diese Frage bleibt eine Antwort kurz nur schuld.
.
Fußnoten
[1] Marshall, Berry James (*1951), Mikrobiologe: Entdecker von Helicobacter pylori, als Erreger von Magengeschwüren; 2019 Nobelpreis für Physiologie und Medizin
[2] pH-Wert: Abkürzung für Potential des Wasserstoffs; ist ein Maß für den sauren oder basischen Charakter einer wässrigen Lösung. Je höher die Konzentration der Wasserstoffionen (H+) in der Lösung ist, desto niedriger ist der pH-Wert, desto saurer ist die Lösung, je höher, desto basischer; er schwankt zwischen 0 und 14. Reines Wasser hat einen pH von 7
[3] Wachstumsoptimum: Bedingungen, unter denen Organismen optimales, bestes, Wachstum zeigen, im Gegensatz zum Minimalwachstum, ein „gerade noch“ am unteren Ende der Wachstumsbedingungen und Maximalwachstum, ein „gerade noch“ am oberen Ende
Eingestellt am 6. April 2024
.

Epsilon-Proteobacteria:
2 Wohnlich (AP)
.
Basisch wirkenden Ammoniak[3] in der Umgebung,
Gleicht den Säurestress teilweise aus,
Lebt nahe der Schleimhaut[4] im eignen Milieu. –
.
Oral aufgenommen bewegt sich Helicobacter
Flagellengetrieben[5] zur Schleimhaut des Magens,
Produziert dort, den pH-Wert zu heben, neutralisierendes NH3,
.
Adhäsine[8] absondernd, dockt er an
Freiliegenden Endothelzellen[9]
Und setzt zur Vakuolisierung[10] ein
Cytotoxin[11] seiner Zellen frei.
.
Noch zusätzliche Schäden bewirkend,
Erleichtern sie Pyloris Cytotoxin,
Porenbildend ins Plasmalemma[14] zu dringen;
Löst damit Apoptose[15],
Programmierten Tod der Epithelzellen aus.
.
Ein neues Protein, wehrlosen, noch lebenden Zellen injizierend,
Stimuliert Helicobacter pylori zum eigenen Vorteil
Ungeregeltes Teilen und Wachsen der Zellen
Als wuchernde Nahrung für ihn; veranlasst so ein Geschwür.
Mitunter enthemmt es vollkommen sein Wachstum
Und verursacht gefürchteten Krebs.
.
Die Hälfte, vielleicht zwei Drittel der Menschen,
So schätzt man, beherbergt Pylori
Als potenziellen Faktor für Krankheit und Leid.
Warum Helicobacter meist still sich verhält,
Liegt vielleicht an der Personen Konstitution,
Oder doch an der Heterogenität von Helicobacter,
Denn Sequenzdaten zeigen
Unterschiede bis zu sieben Prozent.
.
Welch eine Genugtuung, die Barry Marshall[16] erfuhr:
Nichts Höheres konnte bei ihm sich für die Entdeckung bedanken
Als das Komitee,
Das den Nobelpreis ihm verlieh.
.
Fußnoten
[1] Urease: Harnstoff spaltendes Enzym
[2] Helicobacter pylori: Erreger von Magengeschwüren, gelegentlich von Magenkrebs
[3] Ammoniak [NH3]: Stickstoffatom mit drei Wasserstoffatomen in flach trigonal-pyramidaler Form angeordnet
[4] Magenschleimhaut: Innere Auskleidung des Magens
[5] Flagellum, Geißel (Bakteriengeißel): Aus vielen globulären Flagellinproteinen zusammengesetzte Hohlröhre
[6] Mucigenasen: Schleimschichten abbauende Enzyme
[7] Kollagenase: Dieses Enzym spaltet Proteine zwischen Prolin und anderen Aminosäuren
[8] Adhäsine: Von Bakterien gebildete Faktoren, die es dem Bakterium ermöglichen, an Strukturen bzw. Zellen des Wirtes anzuhaften; verhindern das Ablösen der Bakterien von besiedelten Oberflächen
[9] Endothel: Als geschlossene Schicht in Blut- und Lymphgefäßen auftretende Zellen
[10] Vakuolisierung: Zellen werden schrittweise mit internen Saftvakuolen versehen
[11] Cytotoxine: Zellgifte
[12] Neutrophile Bakterien: pH-neutrales Medium bevorzugende Bakterien
[13] Mastzellen: Zellen des Immunsystems, die eine Rolle bei der angeborenen Immunantwort spielen. Sie produzieren eine Reihe von biologisch aktiven Substanzen, darunter vor allem Histamin und kommen im ganzen Körper verteilt vor
[14] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen mit starrer Zellwand; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt; für Bakterien kein gebräuchlicher Begriff.
[15] Apoptose: Programmierter Zelltod
[16] Marshall, Berry James (*1951), Mikrobiologe: Entdecker von Helicobacter pylori, als Erreger von Magengeschwüren; 2019 Nobelpreis für Physiologie und Medizin
Eingestellt am 6. April 2024
.

Firmicutes, Festwandige:
1 Gegengewicht (HP)
.
Der Actinobakterien hohes GC[1]
Kontrastiert zu Firmicutes‘ niedrigem Wert.
Grenzen so sich eindeutig ab.
Warum aber fehlen Formen der üblichen Norm?
.
Beim Kampf um dieselben Ressourcen
Genetisch sich kaum unterscheidender Gruppen
Neidete Jeder Jedem das tägliche Leben
Und alle litten an Mangel im eigenen Haus.
.
Extreme gehen daher sich gern aus dem Weg,
Schlagen nicht selten gegensätzliche Richtungen ein.
Nur die Unentschlossenen bleiben zurück.
Gewinnen nur scheinbar Freiheit hinzu.
Wohl nicht zum Vorteil, eher zum Nachteil,
Denn sie verschwanden aus dieser Welt. –
.
Firmicutes sannen auf Innovation,
Legten Sporen[2] zum Überdauern, Vermehren, im Inneren an,
Auch wenn viele davon
Den Vorteil bald wieder verlor‘n.
.
Fußnoten
[1] GC, GC-Verhältnis: Die Häufigkeit von GC im Vergleich zu AT ist ein Charakteristikum verschiedener Organismen
[2] Sporen (Bakterien): Dauerformen, die Bakterien ermöglichen, auch unter ungünstigen Bedingungen (Hitze, Kälte, Austrocknung, Hungerzustand) zu überleben
Eingestellt am 6.April 2024
.

Gamma-Proteobacteria:
1 Bevorzugt (AP)
.
Gamma- und Beta-Proteobakterien halten sich eng aneinander,
Fern von Alpha- und dem Delta-/Epsilon-Paar.
Bleibt jedoch ausgeschlossen in der folgenden Schrift.
Gamma- hingegen drängt sich mit recht Aufregendem vor:
Yersinia, Legionella, Salmonella, Escherichia und Vibrio.
.
Parasiten nur skizzieren die kommenden Verse,
Als unmittelbar uns Menschen betreffend,
Doch Legionen anderer Gammas wirken in jedem Ökosystem:
.
Fußnoten
[1] Nitrifizierer, Ammoniumoxidierer: Oxidieren zur Energiegewinnung [NH4+] zu Nitrit [NO2-]
[2] Neisseria: z. B. Neisseria meningitidis (Meningokokken), Erreger einer Meningitis und Neisseria gonorrhoeae (Gonokokken), Erreger der Geschlechtskrankheit Gonorrhoe, auch Tripper genannt.
[3] Burkholderia: gelegentlich als Endosymbionten in Pilzhyphen gefunden
[4] Pseudomonaden: In der Umwelt allgegenwärtige Bakterien, leben im Boden, in oder auf Pflanzen und Tieren, wichtige Bakterien im Wurzelraum
[5] Beggiatoa: Bildet fadenförmige Kolonien (Filamente, wie bei filamentösen Cyanobakterien) und kann als Kolonie mit ihren weißen Fadenmatten mit bloßem Auge sichtbar sein; die weiße Farbe ist auf den gespeicherten Schwefel zurückzuführen; benutzt [H2S] als Energiequelle
Eingestellt am 6. April 2024
.

Gramnegative
1 Purpurn, doch bald farblos
.
Zu Urzeiten, nach Verlust der dickmächtigen Wand Mureins[1]
Und Schutz mit ihres Lipids[2] äußerer Hülle
Waren Differenzierung und Vielfalt kaum Grenzen gesetzt.
Solche Bionten[3] gelten auch heute als der dünnwandigen Sippen Grund.
.
Durch umhüllende, rote Substanzen.
Durchdringen aufgrund lebensstrategischen Wandels
Auch ultraviolettlichtdurchflutete, von vielen gemiedene Orte.
Erreichen uferbegleitende Schichten organischen Schlicks,
Auch lebensraumfreundlichen, porendurchzogenen, sandigen Grus[6].
Nehmen fernab energieliefernden Lichts organische Nahrung,
Manche verlieren die fotosynthetische Kraft.
.
Diversifizieren sich über die Zeit, trennen sich auf in genetische Linien,
Werden dem griechischen Alphabet nach benannt:
Die wichtigsten nennen sich Alpha- und Beta-Proteobakterien,
Die Gamma-, Delta- und Epsilon-Sippen steh’n ihnen nah. –
.
Alpha-Proteobakterien sind mitunter ein naschend‘ Geschlecht,
Entwenden andern Bionten nahrhaften Zucker,
Nehmen ihn schnell und genüsslich zu sich
Und freu’n sich der kostbaren Beute.
.
Bleiben zunächst noch zufrieden im Boden,
Warten voll Spannung auf süße,
Ununterbrochen fließende Quellen.
.
Doch Mita[9] kann es kaum noch erwarten
An diese Quellen zu kommen,
Legt sich voll Hoffnung an vermeintliche Partner –
Doch diese versteh‘n keinen Spaß.
.
Fußnoten
[1] Murein: Zellwand fast aller Bakterien, in der kettenförmig verbundene Zuckermoleküle, an denen Ammoniumgruppen (–NH2) hängen und diese wieder mit verschiedenen Molekülen verknüpft sind. Diese Ketten sind noch durch kurze Folgen von Aminosäuren verbunden und ergeben so einen sehr stabilen Sack um die Zelle (Abbildung unter „Bacteria 1 Steckbrief“)
[2] Äußere Lipiddoppelmembran: eine zusätzliche Lipiddoppelmembran, die gramnegative Bakterien umgibt, Grampositiven fehlt sie
[3] Bionten: Allgemeine Bezeichnung für Lebewesen
[4] Purpurbakterien: Darunter werden heute alle obligat oder fakultativ phototroph lebenden Proteobakterien zusammengefasst, bilden deshalb keine monophyletische Gruppe sondern enthalten Vertreter aus den Klassen der Alpha-, Beta- und Gamma-Proteobacteria. (Wikipedia)
[5] Bakterienchlorophyll: „Bakteriengrün“, bestehend aus Porphyrinringsystem mit angehängter Kohlenstoffkette. Es unterscheidet sich vom „Blattgrün“ durch bestimmte Seitenmoleküle am Porphyrinringsystem (Abbildung unter: „Grundlegendes: 13 Der Clou“ und unter „Grundlegendes, 14 Optimierung“)
[6] Grus: zerbröckeltes, körniges Gestein
[7] Rhizobium: Rhizobium-Arten bilden eine endosymbiotische stickstofffixierende Assoziation mit Wurzeln von hauptsächlich Hülsenfrüchtlern (Fabaceae – Fabales - ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae – Rosidae – Superrosidae – …)
[8] Agrobacterium: Agrobakterien-Arten sind Bodenbakterien und besitzen von Natur aus die Fähigkeit, Teile ihres Genoms auf Pflanzenzellen zu übertragen; sie können mancherlei Pflanzen besiedeln.
[9] Mita: Kunstname für hypothetischen Vorfahr; endete als Mitochondrium
Eingestellt am 6. April 2024
.

Gramnegative
2 Alleskönner
.
Nichts Organisches ist vor Bakterien sicher!
Fast nichts. Nur vor Lignin[1] müssen sie anscheinend passen.
Um über Kohlenstoffbindungen mehrfach verknüpfte Phenole[2] zu knacken,
Fehlen nicht nur Enzyme, auch die nötige Energie.
.
Ob Zucker in voller Diversität[3],
Alles zerlegen sie, ohne zu zögern für eignen Verbrauch.
.
Proteine[10] in lockerer Form,
Liegen schutzlos vor ihnen.
Manch eine Arbeit braucht aber gehörige Zeit.
.
Auch von Menschen bereitgestellte Substanzen,
Ob Erdöl, an Küsten gespült,
Kämpfen mit ihren Spezialisten sie nieder.
Zur Not akquirieren sie Gene von anderen Arten,
Vermehren sich prompt,
Verschwinden scheinbar wieder, wenn die Arbeit getan.
.
Tote Massen, lebende Wesen,
Sind für Bakterien kein Problem.
Wenn vorteilhaft, wird eine Zusammenarbeit
Zu gegenseitigem Nutzen probiert.
.
Fehlt ihnen Organik,
Senden sie Chlorophyllbesitzer ans Licht
Für Energie- und Zuckergewinn,
Produzieren O2 oder Schwefel dabei.
.
Viele sind zahm, kaum aggressiv,
Leben von abgeschiedenen Schleimen,
Von Exsudaten der Haut,
Wühlen im Abfall, zerlegen noch Reste,
Recyceln fast alles,
Was Baustoff und Energie noch enthält.
.
Ob Seinesgleichen, Tiere, Pflanzen, Pilz oder Mensch,
Ist ihnen vollkommen einerlei.
Manche lieben jedoch ausgesuchte Opfer,
Werden Menschen und Tieren zur Qual.
.
Verschwindend erweist sich der Krankheitserreger Zahl
Im Vergleich zu den Tausenden harmlosen
Für Ökosystemfunktionen essenzielle Vertreter.
Der Mensch aber fühlt sich durch diese nicht wenig bedroht,
Hebt diese, verständlich, besonders hervor,
Richtet sein Augenmerk ausschließlich fast auf sie. –
.
Und wenn du denkst,
Es wäre als Mensch dein Recht,
Verschont von diesen Biestern zu bleiben,
So denk daran,
Kein Leben wär möglich ohne Mikroben.
Und – auch du bist Ergebnis der Evolution.
.
Freilich, nur du hast Wissen und Macht,
Sich des Leids zu erwehren.
Dein Verstand hat es geschafft,
Mittel dagegen zu finden, Wege dagegen zu klären.
.
Wenn du als Gottes Geschöpf dich nun siehst,
Als Ziel des Jahrhundertemilliarden geltenden Plans
Und glaubst, etwas Besseres in der Natur zu sein,
So doch nur durch seine Liebe zu dir.
.
Du zweifelst und glaubst seiner Liebe nicht,
Weil Mikroben und Krankheit dich plagen?
So bedenke deinen eigenen Ursprung
Und die Freiheit, die Gott den Geschöpfen verlieh!
.
Fußnoten
[1] Lignin: Eine äußerst stabile und resistente, aus vielen phenolischen Verbindungen zusammengesetzte, daher braune Raumnetzstruktur; eine Substanz, die nur bei Tracheophyta (Stelenpflanzen i.w.S.) vorkommt.
[2] Phenolische Verbindungen: Moleküle aus einem aromatischen Ring (Ring aus sechs Kohlenstoffatomen, mit konjugierten Doppelbindungen, d.h. abwechselnde Doppel- und Einfachbindungen knüpfen die Kohlenstoffatome aneinander) und daran hängenden Seitengruppen; wovon zumindest eine davon eine [–OH]-Gruppe oder eine modifizierte, z. B. [–OCH3]-Gruppe, ist.
[3] Zucker: Kohlenstoffverbindungen mit einem doppelbindigen Sauerstoff [–C=O], wenn in offener Form dargestellt, oder als Ringform mit einem einfachgebundenen Sauerstoff im Ring, und einer oder mehreren [–OH]-Gruppen; Summenformel meist [Cn(H2O)n]
[4] Pectine: Pflanzliche Polysaccharide, die im Wesentlichen aus α-1,4-glycosidisch verknüpften Galacturonsäuren bestehen
[5] Hemicellulose: Gemische von Polysacchariden in veränderlicher Zusammensetzung, meist aus Pentosen (C5-Zuckern, wie Xylose und Arabinose), die nicht zu höheren Strukturen, wie sie bei Cellulose auftreten, zusammengefasst sind.
[6] Cellulose: Unverzweigte Ketten aus Glucose in β-1,4-Verknüpfung; wobei der 6C-Zucker Glucose in Ring-Form geschrieben, das C1 der Aldehydgruppe ist [CH2OHCHOHCHOHCHOHCHOHCHO], davon aus gerechnet ist der vierte Kohlenstoff das C4 ist. In Ringform geschrieben weist die OH-Gruppe des C1 nach oben, wie auch die frei gebliebene CH2OH-Gruppe. Die OH-Gruppen wechseln von 1 bis 4 die Stellung: C1 nach oben, C2 nach unten, C3 noch oben, C4 nach unten, an C5 hängt die nach oben stehende CH2OH-Gruppe. (Abbildung unter „Actinorhiza, 1 Eintritt“)
[7] Glycogen: Ein hochverzweigtes Polysaccharid aus meist α-1,4 verknüpfter Glucose (mitunter α-1,6 am freien [–CH2OH] des Glucoserings); Speicherprodukt von Tieren, Pilzen und Bakterien; (Abbildung unter „Lactobacillales, 3 Vielfältiger Einsatz“)
[8] Stärke: Gemisch aus Amylose und Amylopectin; Speicherpolysaccharid der Pflanzen
[9] Chitin: Polymer aus N-Acetyl-Glucosamin, entstanden aus 1,4-β-Glucosen, an deren C2 eine [–NHCOCH3]-Gruppe hängt; anders ausgedrückt, an deren C2 eine [–NH2]-Gruppe, eine Aminogruppe, hängt, bei der ein Wasserstoffatom durch ein Acetat [CH3COO–] ersetzt ist. Zellwandpolysaccharid der Fungi (Echte Pilze) und der Arthropoda (Gliederfüßer)
[10] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt
[11] Kollagen: Heterogene Gruppe von Proteinen; der wichtigste Faserbestandteil von Sehnen, Knorpel Blutgefäßen und Zähnen; bildet eine linksgängige Schraube, wobei jeweils drei dieser Schrauben in einer rechtsgängigen Superschraube arrangiert sind, dem eigentlichen Kollagen; diese Trippelschraube wird durch Wasserstoffbrücken zwischen den einzelnen Strängen stabilisiert. Nur bei Animalia (Echten Tieren) vorkommend.
[12] Horn: Substanz, die aus abgestorbenen, mit Keratin gefüllten Zellen besteht
Eingestellt am 6. April 2024
.

Gramnegative
3 Ionenfresser
.
Kein Stickstoffmangel existiert für sie,
Jede Form kommt ihnen recht:
Lieben aber am meisten Ammonium[5],
Zur Not molekularen Stickstoff[6] der Luft.
.
Irgendein Bakterium zeigt sich glücklich damit,
In Aminosäuren[14] gebunden, ist er Favorit.
.
Nehmen Phosphat[15], gebunden, oder in Wasser gelöst,
Oder aus Steinen geholt,
.
Bei Hitze, Kälte, auch unter Druck,
In Schwefelwasserstoffgasen[24], in sauerstoffhaltiger Luft,
In tiefster Finsternis, bei hellscheinendem Licht,
Auf freien Flächen, tief in festem Substrat versenkt:
Kein Ort, der von ihnen nicht bewohnt.
.
Fußnoten
[1] Nitrat: [NO3−]
[2] Nitrit: [NO2−]
[3] Lachgas: [N2O]
[4] Stickstoffmonoxid: NO]
[5] Ammonium (eigentlich Ammoniumion) [NH4+]: Ammoniak [NH3] mit drei Wasserstoffatomen, wird mit einem weiteren Wasserstoffatom versehen und bekommt dadurch eine positive Ladung
[6] Molekularer Stickstoff: N2
[7] Molekularer Schwefel: S2
[8] Oxidieren: Ein Atom oder Ion mit Sauerstoff verbinden; allgemeiner: eines Atoms oder Ions Entzug von Elektronen
[9] Reduzieren: Sauerstoff von einem Atom oder Ion entfernen; allgemeiner: einem Atom oder Ion Elektronen zuführen
[10] Disulfide: Chemische Verbindungen, die zwei aneinander gebundene Schwefelatome enthalten
[11] Sulfide: besitzen ein doppelt negativ geladenes Schwefelion; [S2−]
[12] Sulfate [SO42−]: Eine maximal oxidierte Schwefelverbindung mit vier Atomen Sauerstoff; liegt als zweifach negativ geladenes Ion vor
[13] Sulfite: Verbindungen mit [SO32−] als Anion
[14] Aminosäuren: Organische Säuren mit einer Amino-[–NH2] Seitengruppe. Biologisch bedeutend sind hauptsächlich jene Aminosäuren, die an dem der Säuregruppe benachbarten Kohlenstoffatom diese Gruppe besitzen
[15] Phosphat, [PO43−]: als Ion vorliegend oder an andere Atome oder Moleküle gebundene Phosphorsäure [H3PO4 entspricht O=P(–OH)3]
[16] Eisen: wird meist als Fe2+, kaum als Fe3+ aufgenommen
[17] Bor: Wird als Borsäure [H3BO3] aus Gestein freigesetzt; aufgenommen wird es als [B(OH)3]
[18] Mangan: Gelangt als Mn2+ bei Silikatverwitterung in die Bodenlösung und wird als solches aufgenommen
[19] Calcium: wird als Ca2+ frei und aufgenommen
[20] Natrium: Na+; wird als solches aufgenommen
[21] Kalium: K+; wird als solches aufgenommen
[22] Saures Wasser: pH niedriger als 7 (meist deutlich niedriger)
[23] Alkalisches, basisches Wasser: pH höher als 7 (meist deutlich höher)
[24] Schwefelwasserstoff: [H2S]
Eingestellt am 6. April 2024
.

Gramnegative
4 Millionen
.
Winzig an Größe, arm an Vielfalt der Form,
Manchmal auch undefinierbarer Gestalt –
Zeigen dem Lichtmikroskop sie schnell die Grenzen auf.
Zappelphilipps und schwimmende Punkte,
Verraten als geißelgetriebene Schwimmer sich.
Physiologische Eigenschaften helfen zu differenzieren:
War vormals Taxonomen entscheidend, für ihr System.
.
Vier- oder fünftausend Arten,
Sind der Wissenschaft heute per Namen bekannt;
Wegen fehlender, leicht zu fassender Charakteristika,
Ein Bruchteil nur der wahren Diversität.
.
Sechzehn-S-RNA[14]-Bezirke des Ringchromosoms,
– Bezeichnendes Gen aller Bacteria –
Extrahiert aus Böden, Meeren, Tümpeln und Därmen,
Von Blättern, Wurzeln, Häuten und Haar,
Zeigen mehrtausendfach Differenzen
.
Ein geringer Prozentsatz nur ähnelt Sequenzen bereits bekannter Arten,
Selbst untereinander weichen sie mehr voneinander ab
Als bekannte, von Mikrobiologen[19] gültig beschriebene Arten:
Deuten so auf viele verborgene Spezies hin.
.
Schwer lässt deswegen der Arten Zahl sich schätzen.
Doch drei Prozent als Gesamtsequenzdifferenz,
Für eigenständige Arten gesetzt,
Zeigt ungeahnte Diversität.
.
Kein direkter Nachweis noch ist dafür möglich,
Denn, lebend in hochspezialisierten Nischen[20]
Bezüglich Sauerstoff, Nährsubstrat, Mikrobengemeinschaft und Temperatur,
Widersetzen bislang die meisten sich jeder Kultur.
.
Kaum ein halbes Prozent,
So lässt aus heutigen Daten sich schließen,
Ist der Menschheit bis dato bekannt:
Statt derzeit fünftausend, wohl fast eine Million. –
.
Wüsstest du, wie viele Bakterien dich hegend besiedeln,
– Hunderttausend der Mikrobionten pro Quadratmillimeter Haut,
Zusammengewürfelt aus Tausenden Arten,
Ebenso viele in Mund und Darm.
Neunzig Prozent aller Zellen in und auf deinem Körper gehören Prokaryoten an –
So erkenntest du selbst dich als abwechslungsreiches Ökosystem.
.
Die meisten gehören Gramnegativen, Proteobakterien, an,
– Jene austrocknender Haut
Brauchen besonderen Schutz, sind positiv nach Gram[21] –
Evolvieren ganz im Geheimen:
Unerkannt vom menschlichen Auge,
Bricht sich die Gilde[22] mehrtausendfach Bahn.
.
Fußnoten
[1] Coccen (Bakterien): Rundliche bis ellipsoide Formen
[2] Stäbchenförmig (Bakterien): Abgerundet zylindrisch, deutlich länger als breit
[3] Spirillenförmig: Starr korkenzieherartig gedreht
[4] Aerob: sauerstoffhaltig; Aerobier leben nur unter sauerstoffreichen Bedingungen
[5] Anaerob: sauerstofffrei; Anaerobier leben nur unter sauerstofffreien Bedingungen
[6] Fotoautotroph: Hierbei wird Licht als Energiequelle benutzt. Die Organismen sind zusätzlich in der Lage, ihre energiehaltigen, komplexen Kohlenstoffverbindungen eigenständig aus CO2-Molekülen zu gewinnen. Sie werden damit für ihre Ernährung unabhängig von fremden organischen Substanzen
[7] Lithoautotroph: Zur Kohlenstoffernährung wird Kohlendioxid verwendet, die nötige Energie stammt aus Mineralien von Gesteinen; meist als Chemoautotrophie bezeichnet
[8] Heterotroph: Darunter werden alle Organismen subsumiert, die für ihr Leben auf bereits vorhandene organische Substanzen angewiesen sind
[9] Stickstofffixierer: Bakterien, die in der Lage sind, aus dem inerten, molekularen Luftstickstoff den von Organismen verwendbaren Ammomiumstickstoff zu gewinnen
[10] Denitrifizierer: Unter Denitrifikation versteht man die Umwandlung des im Nitrat [NO3−] gebundenen Stickstoffs zu molekularem Stickstoff [N2] durch Bakterien, die danach als Denitrifizierer bezeichnet werden. Der Vorgang dient den Bakterien zur Energiegewinnung
[11] Parasiten: Organismen die auf Kosten anderer lebender Organismen leben
[12] Saprobe, Saprotrophe: Organismen, die von totem Material anderer Organsimen leben
[13] Symbionten: Organismen, die wechselseitig zu beiderseitigem Vorteil sich nehmen; auch als wechselseitige Parasiten verstehbar
[14] 16S RNA: rRNA, die zusammen mit Proteinen die kleine Untereinheit der Bakterienribosomen bildet; dieses Gen des Chromosoms wird nach seinen Basenfolgen für Verwandtschaftsvergleiche analysiert
[15] G: Abkürzung für die Nucleobase Guanin (Buchstabencode der DNA und RNA); (Abbildung unter „Grundlegendes, 5 Unterseeisch“)
[16] C: Abkürzung für die Nucleobase Cytosin (Buchstabencode der DNA und RNA); (Abbildung unter „Grundlegendes, 5 Unterseeisch“)
[17] T: Abkürzung für die Nucleobase Thymin (Buchstabencode der DNA); (Abbildung unter „Grundlegendes, 5 Unterseeisch“)
[18] A: Abkürzung für die Nucleobase Adenin (Buchstabencode der DNA und RNA)
[19] Mikrobiologen: Biologen, die sich mit Mikroorganismen beschäftigen
[20] Nischen (ökologische): Meist begrenzte Gebiete mit ziemlich einheitlichen Lebensbedingungen; durch spezifische abiotische und biotische Faktoren bestimmt
[21] Gram-Färbung: Eine Methode, Bakterien anzufärben, die der dänische Arzt Hans Christian Gram entwickelt hatte, um Bakterien nach Farbreaktionen einzuteilen. Dabei werden die Bakterien zunächst mit Kristallviolett und Jod angefärbt und anschließend mit Ethanol ausgewaschen und nochmals mit Safranin oder Fuchsin gefärbt. Gram-positive Bakterien sind danach purpur gefärbt, Gram-negative pinkfarben.
[22] Gilde: Eine Gruppe von Arten, die auf ähnliche Weise vergleichbare Ressourcen nutzt und zwar ungeachtet ihres Verwandtschaftsgrades
Eingestellt am 6. April 2924
.

Grampositive
1 Grampositiv – und nun?
.
Waren erste Wesen unseres Planeten.
Viele trugen Chlorophyll[3] als hoffnungsvolle Farbe,
Die Mehrzahl aber legte später ab das Grün.
.
Freiheit durch Beweglichkeit brachte ferne Biotope näher.
Manchen war jedoch der Preis dafür zu hoch,
Verblieben konsequent im nährstoffreichen Raum,
Verzichteten, Energie zu sparen, auf die Ungebundenheit.
.
Ihr dicker Sack aus Murein[4] bewirkt zwar Resistenz bei Druck,
Schützt auch wenig gegen Fremderkennung und der Feinde lytische Enzyme[7]:
Konsequent verdünnen viele ihren Sack, umhüllen sich mit Grenzen setzendem Lipid[8].
.
Gar manche wagten sich zu sehr in nährstoffferne Biotope,
Mussten klug die Zeit der Nöte überbrücken.
Beendet ist zunächst einmal das knapp bemess‘ne Leben,
Doch warten Dauersporen mit Geduld auf neue Lebensqualität.
.
Ein Teil verkleinert sich zur winzigsten Gestalt:
Verzichtet ganz auf eine Wand.
Verstärkt die Zellmembran[9] jedoch
Mit fremder Lebewesen schützendem Sterol[10].
.
Nicht lange brauchten viele der Bionten[11], eine Endgestalt zu finden,
Um Hunderte Millionen Jahre sich am Leben zu erhalten.
Ungezählte freilich blieben sehr flexibel über lange Zeit,
Begrenzen heute aber ihren Wandel.
.
Fußnoten
[1] Gram-Färbung: Eine Methode, Bakterien anzufärben, die der dänische Arzt Hans Christian Gram entwickelt hatte, um Bakterien nach Farbreaktionen einzuteilen. Dabei werden die Bakterien zunächst mit Kristallviolett und Jod angefärbt und anschließend mit Ethanol ausgewaschen und nochmals mit Safranin oder Fuchsin gefärbt. Gram-positive Bakterien sind danach purpur gefärbt, Gram-negative pinkfarben.
[2] Stäbchenförmig: abgerundet zylindrisch, deutlich länger als breit
[3] Bakterienchlorophyll: „Bakteriengrün“, bestehend aus Porphyrinringsystem mit angehängter Kohlenstoffkette. Es unterscheidet sich vom „Blattgrün“ durch bestimmte Seitenmoleküle am Porphyrinringsystem (Abbildung unter: „Grundlegendes: 13 Der Clou“)
[4] Murein: Zellwand fast aller Bakterien, in der kettenförmig verbundene Zuckermoleküle, an denen Ammoniumgruppen (–NH2) hängen und diese wieder mit verschiedenen Molekülen verknüpft sind. Diese Ketten sind noch durch kurze Folgen von Aminosäuren verbunden und ergeben so einen sehr stabilen Sack um die Zelle
[5] Zucker: Kohlenstoffverbindungen mit einem doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] und einer oder mehreren [–OH]-Gruppen; Summenformel meist [Cn(H2O)n]
[6] Aminosäuren: Organische Säuren mit einer Amino-[–NH2] Seitengruppe. Biologisch bedeutend sind hauptsächlich jene Aminosäuren, die an dem der Säuregruppe benachbarten Kohlenstoffatom diese Gruppe besitzen
[7] Enzym: Protein, das, an spezielle Moleküle angepasst, die Synthese katalysiert. Meistens werden mehrere Enzyme zu einem Komplex verbunden, um eine räumliche Nähe zwischen den einzelnen, aufeinanderfolgenden Syntheseschritten herzustellen
[8] Äußere Lipiddoppelmembran: eine zusätzlich Lipiddoppelmembran, die gramnegative Bakterien umgibt, die Grampositiven fehlt
[9] Innere Lipiddoppelmembran: Lipiddoppelmembran, die jedes Organismus‘ Zellinneres umgibt; im Gegensatz zur zellumgebenden Lipiddoppelmembran Gramnegativer Bakterien, die Grampositiven fehlt
[10] Sterole: Eine Gruppe biochemisch wichtiger Naturstoffe aus der Gruppe der Steroide. Das bekannteste Sterol ist Cholesterin (auch Cholesterol genannt)
[11] Bionten: Allgemeine Bezeichnung für Lebewesen
Eingestellt am 6. April 2024
.

Lactobacillales, Milchsäurebakterien:
1 Salzig
.
Schicht um Schicht mit Salz[1] leicht bestreut,
Füllt festgestampft feingehobeltes Weißkraut[2] das hölzerne Fass.
Sparsam am Anfang gegeben, dem Ende zu etwas mehr,
Lenkt Salz des Weißkohls Gärung[3], Säure und den bakteriellen Besatz.
Stampfen treibt Luft aus dichtliegenden feingeschnittenen Blättern,
Schafft favorisierte Umgebung, hält Konkurrenten nahezu fern.
.
Aus dem Feld brachte der Kopf die Bakterien[4] mit.
Altgediente entschlüpfen den Ritzen des Holzes,
Mischen sich zwischen blattexsudatsverwöhnte Zuckervergärer[5],
Bringen die Schichten zum perlenden Leben.
.
Kohlendioxid[6] strebt durch enge Schichten empor,
Wühlte alles von unten her auf,
Hielten nicht Bretter, mit Steinen beschwert,
Drückend Bakterien und Fasern zurück.
Nur salziger Presssaft gehobelter Blätter
Übersteigt als Lake[7] die oberste Schicht.
.
Süßer Saft leckt aus den Blättern
Hungrig nach zuckrigem Nährstoff und Energie.
.
CO2 der Glucose als unnütz entfernend,
Nehmen Ethanol[15] nach Spaltung als Abfall in Kauf,
Setzen alles, Energie zu gewinnen, auf Glycerinaldehydphosphat[16].
.
Doch netto bleibt nur ein ATP:
Denn eines geht auf für Lactat[20];
Ein weiteres verbrauchte Glucose am Anfang bereits,
Auch NADH+H+ verschwindet, ATPs wegen, am Ende dabei;
So verschwenderisch sind sie mit Energie.
Ethanol und Lactat enthalten jedoch viel noch davon
Und Glucose gibt es genug.
.
Acetobakterien[21], dem Freiland entstammend,
Verarbeiten geringfügig vorhandenen, unwillkommenen Sauerstoff
Mit Ethanol zu Essigsäure[22] und CO2:
Verhindern so das Wachsen von Pilzen, auch von Bakterien schädlicher Art.
.
Ethanol verestert[23] nicht nur Lactat,
Auch andere Säuren
Nimmt er zur Sauerkrautaromaveredlung her.
Gibt eine besondere Note damit
Jedem gärenden Fass.
.
Fußnoten
[1] Kochsalz: [NaCl], Natriumchlorid
[2] Weißkohl, Weißkraut: Brassica oleracea convar. capitata var. alba (Brassicaceae – Brassicales – Malvanae – Rosidae – Superrosidae …)
[3] Gärung: Mikrobieller Abbau organischer Stoffe zur Energiegewinnung ohne Einbeziehung von Sauerstoff
[4] Lactobacillus reuteri: Sauerkrautbakterien, auch in anderen durch Salzzugabe konservierten Pflanzen- und Milchprodukten (Lactobacillales – Firmicutes – Grampositive – Bacteria)
[5] Vergären Zucker als energielieferndes Substrat
[6] Kohlendioxid, CO2: gestrecktes Molekül [O=C=O]
[7] Lake: Wässrige Kochsalzlösung
[8] Saccharose, Rohrzucker, Rübenzucker: Disaccharid aus α-Glucose und β-Fructose in 1,2-Verknüpfung
[9] Glucose: Ringförmiger Zucker mit sechs [C]-Atomen [C6H12O6]; der Ring besteht aus fünf [C]-Atomen und einem Sauerstoffatom; das restliche [C]-Atom hängt als [–CH2OH]-Gruppe an einem dem Sauerstoff benachbarten [C]-Atom; vier [–OH]-Gruppen stehen an [C]-Atomen des Rings, wobei [–CH2OH] und die dem Sauerstoff benachbarte [–OH]-Gruppe in gleiche Richtung stehen, alle anderen wechseln sich richtungsmäßig ab; (Abbildung unter „Grundlegendes, 12 Energiespender“)
[10] Fructose: Meist ringförmiger Zucker mit sechs [C]-Atomen [C6H12O6]; der Ring besteht aus vier [C]-Atomen und einem mittigen Sauerstoffatom; die restlichen [C]-Atome hängen als [–CH2OH]-Gruppen an den Sauerstoff benachbarten [C]-Atomen; drei [–OH]-Gruppen binden an [C]-Atomen des Rings
[11] Leuconostoc (Lactobacillales): In der Umwelt weitverbreitete, aerotolerante Bakterien; spielen in verschiedenen industriellen und Lebensmittelfermentationen eine wichtige Rolle; vergären Glucose und Fructose zu Milchsäure.
[12] Pediococcus (Lactobacillales): Aerotolerant, bilden ausschließlich Lactat und dabei kein Kohlendioxid
[13] Milchsäuregärer: Bakterien die im Zuge der Gärung Milchsäure produzieren
[14] Xylose: Ein Zucker mit fünf Kohlentoffatomen; [CH2OH(CHOH)3CHO]; (Abbildung unter „Actinorhiza, 1 Eintritt“)
[15] Ethanol, Ethylalkohol: der Alkohol schlechthin, [CH3CH2OH]
[16] Glycerinaldehydphosphat: Dreifachalkohol, eine terminale [–OH]-Gruppe, ist durch einen Phosphatrest ersetzt [–PH2O4]; (Abbildung unter „Grundlegendes, 15 Zuckerlabyrinth“)
[17] NADH2 (=NADH + H+): Nicotinamid-Adenin-Di-Nucleotid mit zusätzlichem Wasserstoff und einem damit gekoppelten Proton (H+). Anstelle eines dritten Phosphats, wie am ATP, wird hier das zweite Phosphat mit einer Ribose verknüpft, die als Seitenkette ein Nikotinamid trägt. Dieses NADH + H+ kann zum einen verwendet werden, den Wasserstoff auf andere Moleküle zu übertragen, um sie zu reduzieren; damit werden diese energiereicher. Zum anderen kann es aber auch dazu dienen, meist drei ATPs aufzubauen (ein drittes Phosphat wird dabei an ADP angehängt); es selbst ändert sich zum NAD, das wiederum zum NADH + H+ regeneriert werden kann; (Abbildung unter „Grundlegendes, 12 Energiespender“)
[18] ATP: Adenosin-Tri-Phosphat; bestehend aus Ribose und Adenin; Ribose trägt an seiner nicht in den Zuckerring einbezogenen Kohlenstoffgruppe drei hintereinander liegende Phosphatgruppen. Diese lineare Anordnung der Phosphate hat zur Folge, dass das dritte, äußerste Phosphat, mit seiner ihm dadurch innewohnenden Energie, diese leicht unter Abspaltung auf andere Moleküle übertragen kann; (Abbildung unter „Grundlegendes, 11 Zukunftshoffnung“)
[19] Pyruvat, Brenztraubensäureion: [CH3COCOO- + H+]; durch sog. Glycolyse aus Glucose gewonnen, verliert unter ATP-Gewinn ein CO2, übrig bleibt ein Acetyl (=Essigsäurerest) mit zwei Kohlenstoffatomen und Formiat, das anschließend ohne Energiegewinn in CO2 und H2 zerfällt. Das Acetyl könnte aber auch von anderen Organismen alternativ unter weiterem Energiegewinn zu Wasser und CO2 abgebaut werden; (Abbildung unter „Grundlegendes, 12 Energiespender“)
[20] Lactat: Salz der Milchsäure, Milchsäureion [CH3CHOHCOO–+ H+]
[21] Acetobakterien, Essigsäurebakterien: Zeichnen sich dadurch aus, dass sie aus Zuckern und Alkoholen durch eine unvollständige Oxidation Ketone und Säuren bilden, die vorübergehend oder ausgeschieden werden. Besonders wichtig ist die Umwandlung von Ethanol in Essigsäure. Obligat aerob, gramnegativ, stäbchenförmig (Alpha-Proteobacteria)
[22] Essigsäure: CH3COOH; sie ist häufig in Lösung dissoziiert; d. h. sie liegt in Ionenform vor [H+ + CH3COO–] (Abbildung unter „Grundlegendes, 1 Das Experiment“ und unter „Grundlegendes, 12 Energiespender“)
[23] Ester: Organische Verbindungen aus einem Alkohol mit einer Säure: Art der Verknüpfung [–C–C(=O)–O–C–]
Eingestellt am 6. April 2024
.

Lactobacillales, Milchsäurebakterien:
2 Mit langer Tradition
.
Die Alten Chinesen, Römer und Griechen lernten,
Milchsauren Kohl als haltbares Nahrungsmittel zu schätzen.
Schon Philosophen der Griechen empfahlen,
Als Pharmacon[1] ihn zu verspeisen.
.
Fässer voll Sauerkohl nahmen Seefahrer mit aufs Schiff,
Um nicht nur Gemüse, auch sich selbst, zu erhalten,
Denn ohne pflanzliche Nahrung wurden sie schlapp nach einiger Zeit,
Verloren den Auftrieb, verfielen Depression und Tod.
.
Skorbut[2], schon immer gefürchtet auf See,
Im Winter an Land,
Verhinderte, heilte, des Sauerkrauts Vitamin C[3],
Lange bevor jemand den wichtigen Co-Faktor[4] fand.
.
Vitamin C, entscheidend beteiligt
Am Aufbau von Knochen, Knorpeln, Sehnen und Zähnen,
Zu stabilisieren des Kollagens[8] Faserstruktur.
.
Nötiger Umbau, permanenter Ersatz überalterter Teile
Des tierischen Körpers strukturgebenden Hauptproteins,
Verlangt ständigen Einsatz des Hilfsmoleküls.
Hundert Milligramm pro Tag ist des Körpers Bedarf.
.
Fußnoten
[1] Pharmacon (gr.): Heilmittel
[2] Skorbut: Vitamin-C-Mangelkrankheit, die oft von Zahnfleischbluten und Muskelschwund begleitet wird
[3] Vitamin C, Ascorbinsäure: Beteiligt an vielen Stoffwechselreaktionen, unter anderem am Aufbau von Bindegewebe, Knochen, Knorpeln und Zahnfleisch. Es gilt als Antioxidans und schützt so vor Zellschäden.
[4] Cofaktoren: Niedermolekulare Substanzen (kleinere Moleküle), die zum Ablauf einer biochemischen Reaktion (in der Zelle) beitragen
[5] Prolin: Aminosäure mit Fünferring, neben vier Kohlenstoffatomen im Ring ist noch ein Stickstoffatom eingebunden
[6] Lysin: Aminosäure; (Abbildung unter „Grundlegendes, 8 Kaskaden“)
[7] Hydrolisierung, Hydrolyse: Spaltung eines Moleküls durch Einwirkung von Wasser in zwei selbständige
[8] Kollagen: Heterogene Gruppe von Proteinen; der wichtigste Faserbestandteil von Sehnen, Knorpel, Blutgefäßen und Zähnen; bildet eine linksgängige Schraube, wobei jeweils drei dieser Schrauben in einer rechtsgängigen Superschraube arrangiert sind, dem eigentlichen Kollagen; diese Trippelschraube wird durch Wasserstoffbrücken zwischen den einzelnen Strängen stabilisiert; nur bei Animalia (Echte Tieren) vorkommend.
Eingestellt am 6. April 2024
.

Lactobacillales, Milchsäurebakterien:
3 Vielfältiger Einsatz
.
Streptococcen[3] auch noch zum Teil,
Verarbeiten Kuhmilch zu Joghurt und Käse,
Beeinflussen je nach Art den Geschmack.
.
Auch Rohwurstreifung begleiten Bakterien.
Säuern Salami und Beißer nach und nach an,
Schützen so vor verderblicher Macht.
.
Probiotischer Joghurt, mit Lactobacillus acidophilus[6] produziert,
Gilt Vielen als wohltuend und darmsanierend,
Wenn medikamentöse Behandlung
Des Darmmikrobioms[7] Gleichgewicht stört.
.
Ostasiatische Delikatessen wie Kimchi[8],
Kunstvoll geschichtet, mit Töpfen vergraben,
Verdanken Aromen bakteriellen Milchsäuregaben.
.
Auch Kühe lieben das saure Gebräu,
Schön durchfeuchtet, nicht trocken wie Heu,
Ethanol[13] ist es nicht, was sie schätzen daran.
.
Homofermentativ[14] zerteilen, zum Beispiel Streptococcen,
Verjagen nicht CO2 aus dem Häckselsalat,
Ethanol aber kommt ihnen nicht in den Sinn.
.
Fußnoten
[1] Lactobacillus: Lactobacillaceae (Lactobacillales – Firmicutes – Grampositive – Bacteria); meist stäbchenförmige Bakterien. Erzeugen durch Gärung Milchsäure
[2] Lactococcus: Steptococcaceae (Lactobacillales – Firmicutes – Grampositive – Bacteria); kugelförmige Bakterien. Erzeugen durch Gärung Milchsäure
[3] Streptococcus thermophilus: Streptococcaceae (Lactobacillales – Firmicutes – Grampositive – Bacteria); kugelförmige Bakterien. Kommt in Sauermilchprodukten, wie Joghurt vor.
[4] Glycogen: Ein hochverzweigtes Polysaccharid aus meist α-1,4 verknüpfter Glucose (mitunter α-1,6 am freien [–CH2OH] des Glucoserings); Speicherprodukt von Tieren, Pilzen und Bakterien.
[5] Glucosidasen: Eine Gruppe von Enzymen, die von Zweifach- und Mehrfachzuckern den Einfachzucker Glucose abspaltet
[6] Lactobacillus acidophilus: Lactobacillaceae (Lactobacillales – Firmicutes – Grampositive – Bacteria); meist stäbchenförmige Bakterien. Erzeugen durch Gärung Milchsäure; häufig in Joghurt.
[7] Darmmikrobiom: Gesamtheit der im Darm lebenden Mikroorganismen
[8] Kimchi: Durch Milchsäuregärung zubereitetes Gemüse japanischer und koreanischer Küche
[9] Sojasoße: Japanische und chinesische Würzsoße aus Soja hergestellt durch Fermentierung mit Hilfe von Schimmelpilzen der Gattung Aspergillus, Hefen und Milchsäurebakterien.
[10] Sushi: Japanisches Gericht aus erkaltetem, angesäuertem Reis mit diversen Zutaten
[11] Silage: Durch Milchsäuregärung konserviertes Futtermittel (Wiesenschnitt, Mais, u.a.) für Nutztiere
[12] Barren: Wannenartiges Gefäß aus der Nutzsäugetiere Futter fressen
[13] Ethanol, Ethylalkohol: der Alkohol schlechthin, [CH3CH2OH]
[14] Homofermentativ: nur ein Gärungsprodukt ergebend
[15] Glucose, Traubenzucker: Ringförmiger Zucker mit sechs [C]-Atomen [C6H12O6]; der Ring besteht aus fünf [C]-Atomen und einem Sauerstoffatom; das restliche [C]-Atom hängt als [–CH2OH]-Gruppe an einem dem Sauerstoff benachbarten [C]-Atom; vier [–OH]-Gruppen stehen an [C]-Atomen des Rings, wobei [–CH2OH] und die dem Sauerstoff benachbarte [–OH]-Gruppe in gleicher Richtung stehen, alle anderen wechseln sich richtungsmäßig ab; (Abbildung unter „Grundlegendes, 12 Energiespender“)
[16] Lactat: Salz der Milchsäure, Milchsäureion [CH3CHOHCOO-+ H+]
[17] ATP: Adenosin-Tri-Phosphat; bestehend aus Ribose und Adenin; Ribose trägt an seiner nicht in den Zuckerring einbezogenen Kohlenstoffgruppe drei hintereinander liegende Phosphatgruppen. Diese lineare Anordnung der Phosphate hat zur Folge, dass das dritte, äußerste Phosphat, mit seiner ihm dadurch innewohnenden Energie, diese leicht unter Abspaltung auf andere Moleküle übertragen kann; (Abbildung unter „Grundlegendes, 11 Zukunftshoffnung“)
Eingestellt am 6. April 2024
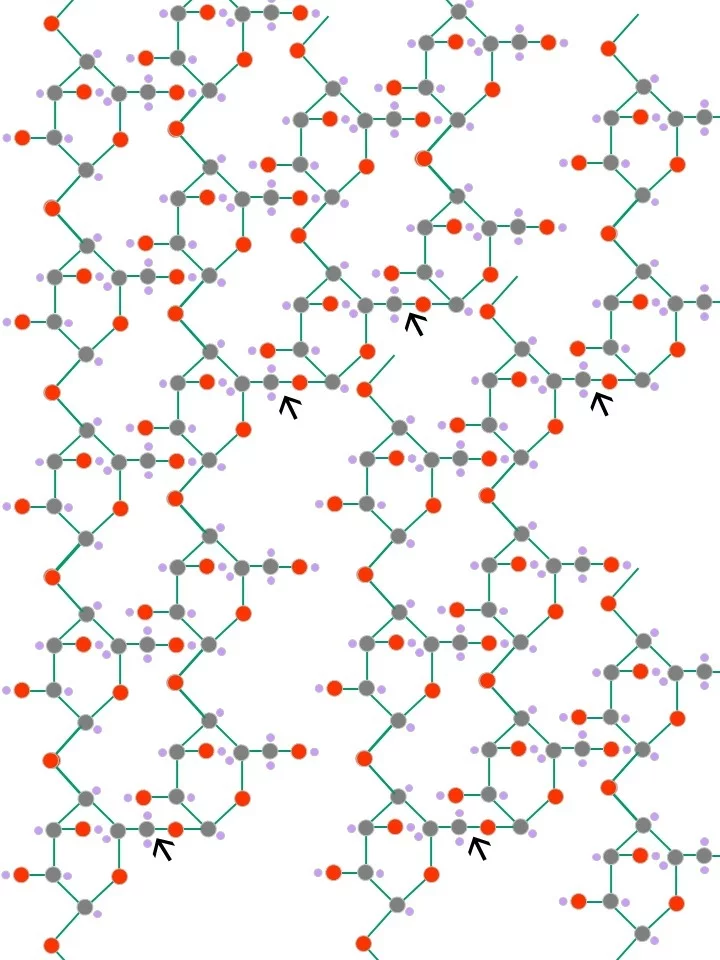
Glycogen (ppt generiert, Reinhard Agerer)
Ein hochverzweigtes Polysaccharid aus meist α-1,4 verknüpfter Glucose (mitunter α-1,6 am freien [–CH2OH] des Glucoserings, siehe Pfeil).
Kohlenstoff: grau; Sauerstoff: rot; Wasserstoff: violett. Das Glycogen erscheint hier in einer Ebene, dabei ist es nur zeichnerisch in eine solche gepresst. Weil aber die Glucoseringe nicht eben sind, sondern an jedem C-Atom geknickt (das C steht jeweils in der Mitte einer dreiseitigen Pyramide mit Dreieckgrundfläche), ergibt sich ein räumlich verzweigtes Molekül.
Eingestellt am 6. April 2024
.

Legionellaceae: Legionellen
1 Gerettet (TP)
.
Wohligwarm liegt die Laubstreu am Boden,
Durchzogen, durchwirkt von Leben allerlei Art,
.
Sie selbst bewirken die Wärme,
Durch Arbeit fällt sie unentwegt an,
Strahlt aus in die Nähe, erleichtert erheblich Arbeit und Werke
Auch die konkurrierender Nachbarn.
.
Amoeba dehnt sich behaglich,
Streckt ihre Füßchen voran;
Tastend umfließt sie mancherlei Zellen,
Ohne dass Argwohn sie weckt.
.
Zum Nachseh‘n vieler Umfloss‘ner,
Denn sie werden verdaut.
Zum Glück für Nella[7] jedoch,
Denn sie hatte einen Defekt:
Sie war schon lange dafür nicht mehr autark.
.
Nach diesen Aminosäuren verlangte sie,
Als Amoeba, vakuolenumschlossen, Nella ins Innere nahm,
Nicht ihr zu Hilfe,
Verdauen war ihr Programm.
.
Doch Nella wusste sich wirksam zu wehren,
Störte Signale für angriffslustige Lysosomen[12]
Und so der Verdauung entkam.
.
Nella war’s recht, erhielt Threonin und Cystein,
Auch alles Übrige lag so wunderbar nah.
Sollten andere darben,
Sie verließ ihr Vier-Sterne-Quartier nicht mehr.
.
Fußnoten
[1] Archäen: Bilden zusammen mit Bakterien die sog. Prokaryo(n)ten, die noch keinen echten Zellkern und keine komplex gebauten Chromosomen besitzen. Sie unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Deshalb wurden die Archäen in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts als eigene Organismen-Domäne der Domäne der Bakterien gegenübergestellt
[2] Amöben, Wechseltierchen: Verändern ständig ihre Form, weil zellwandlos, stülpen Fortsätze des Protoplasten aus, umfließen Nahrung, um Nahrungsvakuolen (Endosomen) zu bilden, ihren Fang zu verdauen. Amöben kommen in verschiedenen Organismenreichen vor; repräsentieren also keine Verwandtschaft, sondern nur eine Lebensstrategie; ein Organismenreich (Amoebozoa) umfasst jedoch nur Amöben.
[3] Echte Pilze: Fungi
[4] Aminosäuren: Organische Säuren mit einer Amino-[–NH2] Seitengruppe. Biologisch bedeutend sind hauptsächlich jene Aminosäuren, die an dem der Säuregruppe benachbarten Kohlenstoffatom diese Gruppe besitzen
[5] Zucker: Kohlenstoffverbindungen mit einem doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] am Ende der Kette, wenn in offener Form dargestellt, oder als Ringform mit einem einfachgebundenen Sauerstoff im Ring, und einer oder mehreren [–OH]-Gruppen; Summenformel meist [Cn(H2O)n]
[6] Phosphat, [PO43−]: Als Ion vorliegend, oder als an andere Atome oder Moleküle gebundene Phosphorsäure [H3PO4 entspricht O=P(–OH)3]
[7] Nella: Name für einen hypothetischen Vorfahren von Legionellen
[8] Threonin: Aminosäure; (Abbildung unter „Grundlegendes, 1 Das Experiment“ und „Grundlegendes, 8 Kaskaden“)
[9] Cystein: Schwefelhaltige Aminosäure; (Abbildung unter „Grundlegendes, 8 Kaskaden“ und unter „Grundlegendes, 10 Kein Leben ohne Energie“)
[10] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt
[11] Endosom: Mikrobenumschließendes Vesikel, entstanden aus einer Zellmembraneinstülpung
[12] Lysosomen: Von einer Membran umschlossene kugelförmige Zellorganellen von Eukaryoten; enthalten hydrolytische Enzyme und Phosphatasen, mit denen sie Fremdstoffe oder körpereigene Stoffe abbauen.
Eingestellt am 6. April 2024
.

Legionellaceae: Legionellen
2 Das Symptom
.
Wind wirbelt Blätter und Ästchen hoch in die Luft.
Amoeba kommt willenlos mit,
Begegnet zerstäubendem Regen auf gefährlicher Bahn.
Wasserumhüllt jagt sie sturmergeben über Höhen und Wipfel dahin.
.
Windzerzaust kämpfen sich Hiker[1] durch peitschenden Regen,
Atmen tief keuchend vernebelte Schwaden,
Erreichen, gegen den Sturm sich lehnend,
Endlich ihr Ziel. –
.
Erschöpft und fiebrig erwacht am Morgen Johannes.
Hüstelnd liegt der ausdauernde Wanderer,
Durchstandene Anstrengung tief ins Gesicht ihm geschrieben,
In Kissen und Decken sich wühlend, noch lange im Bett.
.
Betastend, klopfend und horchend,
Stellt ärztliche Kunst beginnende Lungenentzündung fest;
Verschreibt ein Antibiotikum[2] und stärkende Mittel.
Der Patient aber erholt sich mehr schlecht als recht. –
.
Fußnoten
[1] Hiker: Wanderer
[2] Antibiotikum: Ein natürlich gebildetes, oft chemisch modifiziertes, niedermolekulares Stoffwechselprodukt, von Pilzen oder Bakterien, das schon in geringer Konzentration das Wachstum anderer Mikroorganismen hemmt oder diese gar tötet.
Eingestellt am 6. April 2024
.

Legionellaceae: Legionellen
3 Versammlung (AP)
.
Im Jahre Sechsundsiebzig des letzten Jahrhunderts,
Amerikas altgediente Legionäre[1] trafen sich zu ihrem Kongress,
Erkrankten einhundertsechzig der teilnehmenden Gäste,
Neunundzwanzig erlitten nach wenigen Wochen den Tod.
.
Schwerste Lungenentzündung warf die Betroffenen hin!
Doch kein bekannter Erreger ließ sich entlarven,
Nur ein unbekanntes Bakterium entdeckten Behördenlabore,
Nannten es, den Legionären zu Ehre, Legionella pneumophila[2].
.
Rätselhaft blieben noch lange
Ursprung und Herkunft der Krankheitserreger,
Bis Sequenzanalysenvergleiche
Den ursprünglichen Träger erkannten:
Acanthamoeba[3] ernährt und beherbergt
Diese fatalen Mikroben.
.
Getränke und Speisen waren legionellenfrei,
Doch das Wasser erwies sich kontaminiert:
Im kochenden blieb nichts infektiös,
In warmem überlebten sie prächtig,
Kaltes zeigte sich keimfrei;
Doch viele Legionellen entstammten dem Warmwasserhahn.
.
Wie kommen des Wassers Mikroben tief in die Lunge,
Um dort dann tödlich zu nisten?
Spritzer und Dampf in der Dusche
Vernebeln beständig Legionellen,
Dringen, mit feinsten Feuchtigkeitsfilmen umhüllt,
Inhaliert in mancher Lunge Alveolenbaum[4].
.
Acanthamoeba mit ihren Herbergsnehmern
Gelangte offenbar unerkannt in Warmwasserleitungssysteme,
Erfreute sich, wie schon im Boden, der hohen Temperatur,
Gab aber, durch Hunger geschwächt,
Sich den Inwohnern als letztes Mahl
Für deren Vermehrung hin.
.
Fußnoten
[1] American Legion: Veteranenorganisation der USA
[2] Legionella pneumophila: Auslöser der Legionärskrankheit und des Pontiac-Fiebers (Legionellaceae – Gamma-Proteobacteria – Gramnegative – Bacteria); stäbchenförmiges, aerobes, meist monopolar begeißeltes Bakterium.
[3] Acanthamoeba: Stachelamöbe (Acanthamoebidae – Discosea – Amoebozoa)
[4] Alveolenbaum: Der Lunge Alveolen sind wie an reichverzweigten Bäumen angeordnet
Eingestellt am 6. April 2006
.

Legionellaceae: Legionellen
4 Gegenmaßnahmen
.
Wenn frühzeitig erkannt,
Doch auf des Krankheitserregers Quelle
Zielt der entscheidende Kampf.
.
Als Nutznießer des Warmwasserduschens
Breiten seit Jahren Legionellen sich aus,
Verseuchen, da sie hitzetolerant,
Leitungssysteme, gelegentlich Warmwassertanks.
Bei gut fünfzig Grad Celsius fühlen Legionellen noch sich wohl,
Darüber hinaus sterben sie ab.
.
Temperaturen für einige Zeit
Auf siebzig Grad zu erhöhen,
Erweist sich als Mittel der Wahl,
Den Erregern das Handwerk zu legen.
.
Doch Nachschub liefern sie schnell,
Sinken Temperaturen längere Zeit wieder ab.
Ein jährliches Prüfen in großen Verteilern
Ist deshalb gesetzliche Pflicht.
.
Ein Grenzwert,
Hundert Legionellen in hundert Millilitern,
Verpflichtet Eigentümer zum Handeln,
Dem Tod aus der Dusche zu wehren.
.
Einfach wärs für Amerikas Legionäre gewesen,
Den Warmwasserhahn ein paar Minuten zu öffnen.
Mit Warmwasser wären Legionellen verschwunden
Denn heißes Wasser überleben sie nicht.
.
Und kommst du
Zum Leben und Duschen in lang nicht benutzte Küchen und Bäder,
Dreh den Heißwassserhahn ein paar Minuten auf,
Sonst ergeht es dir wie jenen altgedienten Soldaten. –
.
Und fragst du dich, wie kommen die Biester ins Warmwassersystem,
So bedenke, Trinkwasser, aus dem Boden genommen, ist nicht steril.
Genügend Organismen, winzig, jeden Filter passierend,
Leben in Kalkbelägen zusammen recht gut
Zur Freude von Legionellen, die damit sich mästen,
Wird es für sie wohlig warm im System:
Bilden Biofilme[3], schützen sich in Gemeinschaft,
Nutzen, wie viele Bakterien, Quorum Sensing[4] dafür.
.
Fußnoten
[1] Antibioticum: Ein natürlich gebildetes, oft chemisch modifiziertes, niedermolekulares Stoffwechselprodukt, von Pilzen oder Bakterien, das schon in geringer Konzentration das Wachstum anderer Mikroorganismen hemmt oder diese gar tötet.
[2] Legionella pneumophila: Auslöser der Legionärskrankheit und des Pontiac-Fiebers; stäbchenförmiges, aerobes, meist monopolar begeißeltes Bakterium.
[3] Biofilme: Dünne, meist geschlossene Schichten aus verschiedenen Mikroorganismen
[4] Quorum Sensing: Fähigkeit von Einzellern, die Zelldichte der Population über chemische Kommunikation zu ermitteln, dadurch werden Prozesse, wie die Biofilmbildung oder die Sekretion von Pathogenitätsfaktoren gesteuert, wobei bestimmte Signalmoleküle dafür verwendet werden. Diese Signale werden auch genutzt, die Genexpression in Gemeinschaft zu steuern. Solche Bakterien besitzen sowohl die Möglichkeit, diese Signalstoffe zu bilden als auch zu empfangen und ihre Konzentration zu bestimmen; können damit optimal angepasste Gemeinschaften bilden. Dieses Phänomen ist nicht auf Bakterien beschränkt.
Eingestellt am 6. April
.

Listeria, Listerien:
1 List(er)ig (AP)
.
Gefahr in Verzug, spürt Listeria!
Zielstrebig nähern sich Lysosomen[1]
Ihrer hüllenden Endosomenmembran[2];
Mit ihr zu verschmelzen,
Ihrem Leben ein Ende zu setzen,
Das ist der Plan.
.
Rechtzeitig zerlegt sie mit Hilfe Hämolysins[3]
Den zuvor noch schützenden Mantel,
Schlüpft unerkannt zwischen Häschern hindurch,
Rettet sich in ungefährliche Zonen.
.
Unbehelligt lebt sie nun, frei im Cytoplasma[4] liegend,
Immer bestrebt, zahlreiche Nachkommen in die winzige Welt zu setzen,
Bis der Lebensraum viel zu eng
Und jeder von ihnen nach Neulanden strebt.
.
Wie lange wohl mussten die Vorfahren bangen,
Nach dem Verlassen der Zelle erkannt und zerrieben zu werden,
Bevor eine Neubesiedlung gelang?
Bald schon spannten sie listig den Wirt vor den Karr‘n.
.
Am hinteren Ende, raffiniert konstruiert,
Präsentiert Listeria Anknüpfungsorte für Wirtszell-Actin[5],
Das, zu Bündeln vereint, sich ständig verlängernd,
Listeria rasch an die Zellgrenze bringt.
.
Stülpt das Plasmalemma[6] nach außen,
Drückt es, die Nachbarzelle invaginierend,
Von zwei Membranen folglich umhüllt,
Tief in die Flanke der Zelle hinein.
.
Rasch dem Vesikel entschlüpft,
Wird auch diese Zelle kolonisiert,
Bis Listeria monocytogenes[7] mit Hilfe des Wirts
Weite Gewebebereiche durchdringt.
.
Dichte Befälle im Darm rufen Gastroenteritis[8] hervor.
Doch meist bleibt die Infektion ohne Symptom,
Nur immungeschwächte Personen, Kinder und Schwangere
Leiden nicht wenig davon.
.
Wird die Plazenta[9] besiedelt,
Laufen Hoffnungsvolle[10] Gefahr,
Ihr Kind zu verlieren,
Doch Ernährungsempfehlungen beugen dem vor.
.
Fußnoten
[1] Lysosomen: Von einer Membran umschlossene kugelförmige Zellorganellen von Eukaryonten; enthalten hydrolytische Enzyme und Phosphatasen, mit denen sie Fremdstoffe oder körpereigene Stoffe abbauen.
[2] Endosom: Mikrobenumschließendes Vesikel entstanden aus einer Zellmembraneinstülpung
[3] Hämolysine: Dienen Bakterien in erster Linie dazu, Nahrungsstoffe von Wirtszellen aufzuschließen. So ist zum Beispiel Eisen ein wichtiger Wachstumsfaktor vieler pathogener Erreger.
[4] Cytoplasma: Flüssiger Zellinhalt mit darin liegendem Cytoskelett
[5] Actin, Fädiges Actin: Actin ist ein häufiger Bestandteil des Cytoskeletts und kommt besonders in Muskelzellen vor; zu Fäden polymerisiert (F-Actin), dient es der Stabilisierung der äußeren Zellform sowie der Ausbildung von Zellfortsätzen, intrazellulären Verlagerungen und gerichteten intrazellulären Bewegungen.
[6] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen mit starrer Zellwand; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt; für Bakterien kein gebräuchlicher Begriff.
[7] Listeria monocystogenes: stäbchenförmiges, fakultativ-anaerobes und aufgrund von Flagellen bewegliches Bakterium (polare oder peritriche Begeißelung). Es ist in der Regel pathogen und verursacht eine Reihe von Erkrankungen beim Menschen und bei Tieren, die als Listeriose bezeichnet werden. Der häufigste Infektionsweg ist die Aufnahme über verunreinigte Lebensmittel. (Wikipedia)
[8] Gasteroenteritis: Schleimhautentzündung des Magen-Darm-Traktes
[9] Plazenta: Sich während der Schwangerschaft entwickelndes Gewebe an der Gebärmutterwand, das zum embryonalen Organismus gehört, von diesem gebildet wird und von Blutgefäßen der Mutter und des Embryos durchzogen ist, darüber steht der Embryo, bzw. Fötus, mittelbar mit dem Blutkreislauf der Mutter in Verbindung, erhält Nährstoffe und Sauerstoff und gibt Abfallprodukte ab. (Wikipedia)
[10] Schwangere, „In der Hoffnung“
Eingestellt am 6. April 2024
.

Listeria, Listerien:
2 Auf Umwegen (AP)
.
Listeria monocytogenes[1] findet im Boden,
Wie viele Konsorten,
Verdauungstrakte genug, unbesorgt die Zeit zu beleben,
Bräuchte nicht in Menschen zu zieh‘n.
.
Wind bringt sie mit Staub aus dem Dunkeln,
Lagert sie ab an Gräsern, Blüten und Frucht.
Wartet vergeblich dort auf Rückkehr in die kühlere Welt,
Kommt aus Versehen in der Kühe Verdauungssystem.
.
Ohne zu zögern, besiedelt sie Zotten[2] des vielfach gewundenen Darms,
Breitet sich aus in Muskeln und Milch,
Schwimmt zum Kälbchen munter hinüber.
Viele verlassen beim Koten den Darm.
.
Ihr oberirdischer Kreislauf ist schier nicht zu bremsen.
Wirkt symptomlos im Wirt,
Landet gekühlt in Theken, in Schränken und Gläsern,
Lebt langsam, doch recht gut.
.
Bienen[3] sammeln sie fleißig mit Nektar,
Bringen sie mit ins wabenbehangene Haus,
Verdichten den Nektar zu Honig:
Listerien inmitten des zuckrigen Mahls.
.
Nehmen gerne Kühlung in Kauf,
Ergreifen, was sonst die Konkurrenz hätt‘ genommen,
Verbreiten sich trotz aller Kühlung zum Nachteil der Hungrigen
Unbedrängt in Fleisch, Wurstwaren und Milch.
.
Ihre Plasmamembranen[4], getrimmt mit ungesättigten Fettsäuren,
Bleiben flexibel für mannigfache Passagen,
Und mit manchem Frostschutzprotein.
.
Wehe, Temperaturen werden erhöht!
Dann lecken fluide geword’ne Membranen,
Vermischen Substanzen, bringen zusammen, was sonst ist getrennt,
Bis die Zelle am Ende zerbirst.
.
Rohmilchprodukte, ungenügend erhitzte Milch,
Rohe Würste, zu wenig gebratenes Fleisch,
Ungewaschener, güllegedüngter Salat oder Kohl
Und Honig gefährden kleinere Kinder und jede geschwächte Person.
.
Fußnoten
[1] Listeria mónocystógenes: stäbchenförmiges, fakultativ-anaerobes und aufgrund von Flagellen bewegliches Bakterium (polare oder peritriche Begeißelung). Es ist in der Regel pathogen und verursacht eine Reihe von Erkrankungen bei Menschen und bei Tieren, die als Listeriose bezeichnet werden. Der häufigste Infektionsweg ist die Aufnahme über verunreinigte Lebensmittel. (Wikipedia)
[2] Darmzotten: Kleinste finger- bis blattförmige Ausstülpungen der Darmschleimhaut; stellen Fortsätze der Lamina propria dar, die von einer dünnen Schleimhautschicht bedeckt sind und ins Darmlumen ragen
[3] Honigbienen, Apis mellifera (Apini – Apidae – Apocrita …– Eukarya – Animalia)
[4] Plasmamembran, Zellmembran: (Lipiddoppelmembran) von Organismen mit starrer Zellwand; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt
[5] Kälteschutzmittel, Frostschutzmittel: Senkt den Gefrierpunkt einer Flüssigkeit
[6] Trehalose: Disaccharid (Zweifachzucker), das aus zwei je α-1-verknüpfen Glucosen besteht: Glc α (1–1) α Gluc
Eingestellt am 6. April 2024
.
