4.2.1 Medusozoa Texte A-D

Medusozoa, Medusentiere:
1 Was separat sie stellt
.
Umgewandelt, nicht neukonstruiert,
Erweist sich der Abzug der Kapselgeschosse[1].
Geißeln[2] verlieren die frühere Ordnung aus neun Zwillings- plus zwei Einzeltubuli:
Eine größere Zahl füllt die Flagellen nun aus.
.
Kein Dynein[3] hält die Geißel beweglich,
Denn steif muss sie sein.
Energie kostet Ordnung,
So spart konsequent die Zelle sie ein.
.
Das zweite Centriol[4] ging schon verloren,
Die Wurzel der Geißel[5] dazu.
Konzentrische Kränze aus Mikrovilli[6],
Umgeben die Basis des nun steifen, reizbaren Cnidocils[7].
.
Vorfahren aller Medusenpolypen
Zur linearen Struktur, vererben es Teilung um Teilung
An die kommende Generation.
.
Recht ähnlich ist der Polypen Gestalt jener der Blumentiere[10],
Falls dennoch vorhanden, erkennen wir lediglich vier.
.
Auch diese Polypen wollen sich durch Knospung ungeschlechtlich vermehren.
Nicht selten zerteilt der Polyp sich in dünnere Scheiben,
Lösen sich ab und bleiben oft lang in der Schwebe.
.
Nehmen, Mesogloea[19] mächtig verdickend, Schirmgestalt an,
Fischen, fallschirmgleich sinkend,
Nach Plankton[20] und zeitgenössischen Tieren.
.
Fußnoten
[1] Cniden: Nesselkapseln
[2] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.
[3] Dynein: Ein zur Gruppe der Motorproteine gehörendes Molekül in eukaryotischen Zellen, das dem Transport von Vesikeln und anderen Transport- und Bewegungsvorgängen dient. Das Dynein-Protein besteht aus einer Kopfregion, die an Mikrotubuli bindet, sowie einem Schwanzteil, der mit anderen Proteinen interagieren kann. Dyneinkomplexe binden ein zu transportierendes Molekül an sich und „laufen“ dann entlang eines Mikrotubulus. Der Transport erfolgt gerichtet, da Dynein auf dem Mikrotubulus nur in Richtung des sogenannten minus-Endes wandern kann. Dyneine transportieren also ihre Fracht von der Peripherie in Richtung Mikrotubuliorganisationscentren, MTOCs.
[4] Centriol: Zylinderförmige Struktur im Doppelpack nahe der Kernhülle, die sich in vielen lebenden Zellen befindet. Centriolen haben eine Größe von etwa 170 × 500 Nanometern; sind an der Bildung des Mikrotubuliorganisationszentrums beteiligt, das die Mikrotubulispindel für die Chromosomen-, bzw. Kernteilung bildet. Centriolen kommen in den meisten tierischen Zellen vor, sowie in Pflanzen, nicht jedoch bei Rhodophyta, Rotalgen und Magnoliatae, Bedecktsamer; auch nicht bei Unbegeißelten Chitinpilzen. Charakteristisch ist ihr spezieller Bau aus 9 x 3 Mikrotubuli.
[5] Geißelwurzel: Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.
[6] Mikrovillí: Fingerförmige, meist unverzweigte, dichte Ausstülpungen der Zellmembran, um der Zelle Oberfläche zu vergrößern; erhalten ihre Stabilität durch Aktinfilamente, nicht durch Mikrotubuli oder gar ein Axionem
[7] Cnidocil: Abzug der Nesselkapselgeschosse, der bei Berührung den Schuss auslöst; aus einer modifizieren Geißel entstanden
[8] Mitochondrien: Gelten als Kraftwerke der Zellen, da sie Energie für die zellulären Prozesse liefern; es lassen sich Außen- und Innenmembran unterscheiden, wobei die innere Membran auf einen zellwandlos gewordenen Endosymbionten (ein Alpha-Proteobacterium) zurückgeht, während die äußere Membran der Plasmamembran der Zelle entspricht; prokaryotische Chromosomen weisen ebenfalls auf einen aufgenommenen prokaryotischen Endosymbionten als Ursprung der Mitochondrien hin.
[9] Ringchromosom: In Mitochondrien ist das Chromosom in den überwiegenden Sippen ringförmig; bei einigen Verwandtschaften liegt das Chromosom jedoch linear vor
[10] Blumentiere: Anthozoa (Cnidaria – Animalia – Opisthokonta – Eukarya)
[11] Schlundrohr, Pharynx: Zieht sich von der Mund-After-Öffnung bis zum Magenraum
[12] Gastralraum: Großraum nahe des Osculums, des Mund-Afters, in den alle zuführenden engeren, dann weiteren, wasserführenden Kanäle oder Taschen münden
[13] Entoderm: Inneres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation nach innen gestülpte Zellschicht der Blastula
[14] Gastraltaschen: Taschenartige Strukturen, die durch Mesenterien abgetrennt sind
[15] Hydrocaulus, Scapus: schmaler Teil (Stamm) eines Polypen
[16] Stolonen (Polypen): Basale hohle Ausläufer, die benachbarte Polypen miteinander verbinden
[17] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[18] Mundfeld, Mundscheibe: Bereich zwischen Mund und Tentakeln
[19] Mesogloea: Gallertartiges Gewebe bei Ctenophora (Rippenquallen) und Cnidaria (Nesseltieren), den Hohltieren, das den Zwischenraum zwischen der Gastrodermisschicht und der Epidermisschicht außen füllt. Sie ist zunächst zellfrei, bei den meisten Gruppen wandern jedoch verschiedene Zellen in die Schicht ein. Es handelt sich dabei aber nicht um ein drittes Keimblatt, nicht um ein Mesoderm.
[20] Plankton: Gesamtheit der im Wasser freischwebenden oder mit geringer Eigenbeweglichkeit schwimmende, kleinere Organismen, deren Ortswechsel hauptsächlich durch Wasserströmungen vermittelt wird
Eingestellt am 23. November 2023
.

Medusozoa, Medusentiere:
2 Der Ephyra Werden (HP)
.
Erhöhen den Auftrieb der wabbelig schwebenden Masse.
Ringmuskulatur um den Mund des Polypen[3],
Nunmehr den Randsaum der Qualle[4] umgürtend,
Zieht sich zusammen, ruckartig
Schwimmt die Meduse[5] empor.
.
Ein vierlippiger Mundsaum, kielartig nach unten verlängert,
Stabilisiert der Meduse Richtung im Wasser,
Kurzkolbige Knöpfe zwischen den Lappen des Randsaums
Vermelden die Lage im Raum.
.
Rhopalien[6] nennt der Biologie sie heute,
Organe des Gleichgewichtssinns.
Eine Höhlung, entodermal[7] ausgekleidet,
Umgibt Calciumsulphatkristalle[10].
Sie wirken als Statolith[11].
.
Sie allein wären ohne Bedeutung,
Lägen sie nicht an empfindlichen Cilien[12] benachbarter Zellen.
Denn kommt die Meduse leicht aus der Waage, melden sie schnell
Wie schräg ihre Lage und reizen damit verbund‘ne Nervenzellenden.
.
Aktivieren nahe gelegene Muskeln sich zu kontrahieren,
So gleitet optimiert Yphedra dahin.
.
Recht ausgefeilt zeigt sich das Melde-Reaktionssystem.
Doch Vieltausende Generationen Yphedren
Erprobten, selektierten, optimierten ungezählte Typen davon,
Sind trotzdem noch lang nicht am ferngelegenen Ziel.
.
Sauerstoffmangel in tieferen Zonen des Meeres
Kostet Legionen das Leben.
Wohin orientieren, wenn nicht zum Licht,
Um Algen[17] und Sauerstofffülle zu spüren?
.
Gene für Lichtrezeption[18] liegen schon lange parat.
Auch Bakterien[19] und Algen profitieren seit Urzeiten schon
Zum Start einer Signalkettenfunktion[23].
.
Zu dicht steh‘n Zellen der äußeren Schicht,
Um Rhodopsinmolekülen ausreichend lichtorientierten Raum zu gewähren,
Den Fluss der Photonen zu bündeln,
Lichteffekte bestmöglich zur Wirkung zu bringen.
.
Doch eine Membran steht frei in den Raum!
Der Flagellen[24] schützende Hülle lässt sich dehnen, vergrößern und buchten,
Bis Mikrovilli[25] den Tubulischaft dichtbürstig umsäumen,
Damit einen Platz an der Sonne Pigmenten zu bieten.
.
Yphedra schwebt nun stabil in lichtdurchfluteteten Zonen
Inmitten nahrhafter Algen und weiterem Plankton[26].
Vermehrt die Tentakel, differenziert sich im Innern,
Entwickelt, vergrößert, Gonaden[27], genießt komfortabel das Leben.
.
Gastrulae[28] setzen sich nieder,
Den Urmund[29] nach oben gereckt,
Beginnen als Polypen nun wieder
Die erste Generation.
Nach ungezählten Versuchen ist Yphedra Ephyra[30] geworden,
Übernimmt die sexuelle Reproduktion.
.
Die bis heute noch lebenden Scyphozoa
Gehören vielleicht zu den ursprünglichsten Meduso-Polypen.
Die Cubozoa indes erscheinen hochevolviert,
Hydrozoa dagegen recht modifiziert.
Eine Sonderstellung, dazwischen irgendwo,
Nehmen Staurozoa sicherlich ein.
.
Fußnoten
[1] Name für einen hypothetischen Vorfahren der Medusen (Quallen)
[2] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[3] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.
[4] Quallen: Schirm- oder glockenförmige Nesseltiere
[5] Medusen, Quallen: Ein freischiwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere
[6] Rhopalium: Rand- oder Sinneskörper von Scophozoa (Schirmquallen) und Cubozoa (Würfelquallen), die am Rand des Schirms dieser Nesseltiere zu finden sind. Sie haben die Form kleiner mit Entoderm ausgekleideter Tentakel oder Keulen, die der Oberseite des Schirms der Meduse entspringen durch einen Decklappen geschützt werden; sie gelten als Rückbildungen von Tentakeln. Als Sinneszellen sind Statocysten (Gleichgewichtsorgane) und Ocellen an den entodermalen Zellen der Keulenspitze ausgebildet.
[7] Entoderm: Inneres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation nach innen gebrachte Zellschicht der Blastula
[8] Mesogloea: Gallertartiges Gewebe bei Ctenophora (Rippenquallen) und Cnidaria (Nesseltieren), den Hohltieren, das den Zwischenraum zwischen der Gastrodermisschicht und der Epidermisschicht außen füllt. Sie ist zunächst zellfrei, bei den meisten Gruppen wandern jedoch verschiedene Zellen in die Schicht ein. Es handelt sich dabei aber nicht um ein drittes Keimblatt, nicht um ein Mesoderm.
[9] Ektoderm: Äußeres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation außen verbliebene Zellschicht der Blastula
[10] Calciumsulfat: [CaSO4]
[11] Statolithen: Mikroskopisch kleine Körnchen aus kristallinem Calciumcarbonat [CaCO3], Calciumsulfat [CaSO4] oder Calciummagnesiumphosphat [Ca3Mg3(PO4)4], die die Wahrnehmung von Schwerkraft (und Beschleunigung) ermöglichen
[12] Cilie, Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle
Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.
[13] Synapsen: Verbindungen zwischen Nervenzellen, bzw. von Axon zu Axon. Dort enden die elektrischen Signale (an der Grenze zwischen prä- und postsynaptischem Teil); die Informationsübertragung erfolgt nun durch Ausschüttung von in Vesikeln gebildeten Neurotransmittern; sie werden vom postsynaptischen Teil aufgenommen, wodurch wieder elektrisches Potential entsteht, das vom Axon rasch weitergeleitet wird
[14] Neurotransmitter: Moleküle, die von einer Nervenzelle abgegeben und von einer anderen aufgenommen werden, wodurch Signale im Nervensystem weitergeleitet werden. Als bedeutende Neurotransmitter gelten z. B. Adrenalin, Acetylcholin, Serotonin, Dopamin, Glycin und GABA.
[15] RFamide: Neuropeptide mit der Aminosäurefolge Arg-Phe-NH2 am C-terminalen Ende
[16] Serotonin: Gewebehormon und Neurotransmitter; im menschlichen Organismus besitzt Serotonin vielfältige Wirkungen insbesondere auf das Herz-Kreislauf-System, den Magen-Darm-Trakt und das Nervensystem. Gegenspieler Dopamins.
[17] Algen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für überwiegend im Wasser lebende Thallophyten
[18] Lichtrezeption, Lichtwahrnehmung: Absorption von elektromagnetischer Strahlung, i.e.S. von Licht des Ultraviolett- bis nahen Infrarot-Bereichs durch Pigmente, entweder zur Energiegewinnung (vor allem bei Pflanzen) oder zur Lichtwahrnehmung und Steuerung des Verhaltens bei Tieren
[19] Bakterien: Bilden zusammen mit Archäen die sog. Prokaryo(n)ten, die noch keinen echten Zellkern und keine komplex gebauten Chromosomen besitzen. Sie unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Deshalb wurden die Archäen in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts als eigene Organismen-Domäne der Domäne der Bakterien gegenübergestellt
[20] Rhodopsin: Rhodopsin besteht aus einem Proteinanteil und dem kovalent gebundenen Chromophor 11-cis-Retinal. Eines der Sehpigmente von Wirbeltier- und Insektenaugen und auch von Photorezeptoren einiger anderer Wirbelloser. Rhodopsine kommen auch in Bakterien, Archäen, einigen einzelligen Algen und sogar in wenigen Viren vor.
[21] Lipidmembran (Bacteria, Eukarya): Lipide, bestehend aus einem mit drei Hydroxylgruppen [–OH] versehenen Glycerinmolekül, an dem zwei Fettsäuren und ein Cholin unter Wasserabspaltung angeknüpft sind, zeigen einen hydrophilen Kopf (Glycerin und Cholin) und den hydrophoben Fettsäureschwanz; nach dem Motto Gleich zu Gleich gesellt sich gern, ordnen sich die hydrophilen Köpfe zum einen und die hydrophoben Schwänze zum anderen nebeneinander an und bilden eine geschlossene Schicht; eine Doppelmembran entsteht dann, wenn sich zwei solcher Schichten, hydrophobe Schwänze zueinander gereckt, aneinanderlegen
[22] Photonen: Lichtquanten, oder Lichtteilchen, aus denen Lichtstrahlung besteht
[23] Signalkettenreaktion: Signale werden in mehreren Reaktionsschritten weitergegeben; dabei sind die Kettenreaktionen physikalische oder chemische Umwandlungen, die aus gleichartigen, einander bedingenden Reaktionen bestehen. Dabei ist ein Produkt einer Einzelreaktion Ausgangsprodukt für eine Folgereaktion.
[24] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel)
[25] Mikrovillí: Fingerförmige, meist unverzweigte, dichte Ausstülpungen der Zellmembran, um der Zelle Oberfläche zu vergrößern; erhalten ihre Stabilität durch Aktinfilamente, nicht durch Mikrotubuli oder gar ein Axionem
[26] Plankton: Gesamtheit der im Wasser freischwebenden oder mit geringer Eigenbeweglichkeit schwimmende, kleinere Organismen, deren Ortswechsel hauptsächlich durch Wasserströmungen vermittelt wird
[27] Gonaden: Geschlechtszellen bildende Organe
[28] Gastrula: Im Verlauf der Ontogenese der Eumetazoa stülpt sich die Blastula zur Gastrula ein, bildet dadurch ein zweizellschichtiges Stadium
[29] Urmund: Öffnung der Gastrula, die nach Einstülpung der Blastula im Zuge der Gastrulation entstanden ist
[30] Ephyra: Larvenform bei Medusozoa; Scheibe mit kurzen, zweilappigen, flügelartigen Anhängen
Eingestellt am 23. November 2024
.

Ab hier werden die Texte bezüglich Taxanamen der Medusozoa (s. Stammbaum und/oder Pfade) alphabetisch geordnet.
Die evolutiven Zusammenhänge lassen sich deshalb aber nur erkennen und verfolgen, wird auch der zugehörende Stammbaum berücksichtigt.

Actinulida, Larvenhydren:
1 Nichts ist unmöglich
.
Eine Actinulalarve[1] verirrte womöglich
Sich ins Sandlückensystem,
Ließ Tentakel[2] zwischen Sandkörnern frei im Wasser flottieren,
Heftete mit deren Ursprungszentrum sich an ein Korn,
Bewimperte sich rundum, Tentakel so unterstützend;
Nutzte, den Gegenpol öffnend, ihn als Manubrium[3],
Ließ Gonaden[4] daran entstehen,
Hofft auf naheliegende Partner, die ähnlich gestimmt:
Lebt so als jung geblieb‘nes Larvenstadium
Recht gut in seinem Versteck.
.
Fußnoten
[1] Actinulalarve: Larvenform verschiedener Leptolina (Hydrozoa) mit ellipsoidem, voranschwimmendem Ende, das später die Anheftungsstelle des Polypen wird und mit Tentakelkanz am hinteren Ende, das sich zum Mundfeld entwickeln wird.
[2] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[3] Manubrium: Lange Röhre als Fortsetzung des Magens und Träger der Mund-After-Öffnung
[4] Gonaden: Geschlechtszellen bildende Organe
Eingestellt am 23. November 2024
.

Autor: LasseØ
Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
.

Anthoathecata, Unbehüllte Blütenhydren:
1 Einheit in Vielfalt
.
Unbekannt ist gleichfalls eine Gonotheca[5];
Bilden oft hochgewölbte Medusen[8], keine ausgesprochen flachen;
Am Manubrium[9] hängen ihre Gonaden;
Ocellen[10] fehlen zumeist.
.
Fußnoten
[1] Periderm: Chitinöse Hülle von Polypen
[2] Hydrocaulus, Scapus (Polypen): schmaler Teil (Stamm) eines Polypen
[3] Hydrothek: Periderm eines Hydranten
[4] Hydrant: Erweiterter Kopfteil eines Hydropolypen
[5] Gonothek: Periderm eines reproduzierenden, reduzierten Polypen
[6] Gonophor: Träger von Geschlechtszellen
[7] Stolonen: Basale hohle Ausläufer, die benachbarte Polypen miteinander verbinden
[8] Medusen, Quallen: Ein freischwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere
[9] Manubrium: Lange Röhre als Fortsetzung des Magens und Träger der Mund-After-Öffnung
[10][10] Ocellen: Kleine einfache Augen von Invertebraten mit basalen lichtempfindlichen Zellen
Eingestellt am 23. November 2024
.

Aplanulata, Planulalose:
1 Die Besonderheiten
.
Embryonen entwickeln sich entweder in Jungpolypen direkt,
Oder bilden zunächst ein recht ähnliches Stadium,
Umgeben sich mitunter mit Periderm[3], aus dem ein Jungpolyp schlüpft.
.
Stenothelen[4] sind ihre Waffen,
Nehmen noch weitere aber hinzu.
Viele Arten ordnen Tentakel[5] in zwei Kreisen
Mit etwas Abstand an.
.
Fußnoten
[1] Synapomorphie, synapomorphe Merkmale: Synapomorphien sind Merkmale, die ein Schwestergruppen-Verhältnis zwischen zwei Sippen begründen; es sind die Autapomorphien der gemeinsamen Stammart
[2] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria
[3] Periderm: Chitinöse Hülle von Polypen
[4] Stenothelen: Nesselkapseln mit stilett- oder skalpellartigen, leicht gekrümmten, messerscharfen, oft in zwei Etagen angeordneten Strukturen an der etwas verbreiterten Basis des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs
[5] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
Eingestellt am 23. November 2024
.

Aplanulata, Planulalose:
2 Gewöhnlicher Röhrenpolyp
.
Zur kleinfingerlangen, strohfarbenen Röhre, wachsen zunächst Jungpolypen.
Mit chitin- und proteinhaltigem Periderm[1]
Trägt bereits einen roten Hydranten[4] von Köpfchengestalt,
Basal umrundet mit einem Kranz aus ungefähr zwanzig weißen Tentakeln[5],
Wodurch das niedere Köpfchen dort fast schüsselförmig erscheint,
Mittig mit krugartig erhobener Form gekrönt, die nochmals,
.
Stehen mehrere der Köpfchenhydranten beisammen,
Erscheint die Gemeinschaft wie ein Blütenfeld,
Das plötzlich verschwindet, fährt etwas heftig darüber:
Denn plötzlich zog sich jede der Blüten in den Röhrenstengel zurück.
Knickt Sturm sie im Wasser, schwimmen alleine sie weiter;
Doch wachsen Blüten aus diesen Röhren dann nach.
.
Zwischen beiden Tentakelkränzen
Entspringen nahe des Kruges Grund
In dichtem Reigen Sporensäcke[8] mit
Cryptomedusoidem[9] Bau.
.
Nicht in der Gonade entwickeln sich Larven[10]
Verweilen vielmehr in des Sporensacks ehemaliger Subumbrellarhöhle[13],
Entwickeln darin zur Actinulalarve[14] sich; erst sie verlässt den schützenden Raum.
.
Treibt mittig, im Schutzraum bereits, den unteren Kranz von Tentakeln,
Ein langer Konus, der zum Krug wandeln sich wird, setzt sie am hinteren Ende fort.
Wenn befreit, beginnen Tentakel des zweiten Kranzes zu strahlen,
Damit verbunden bricht des Hydranten Mund-Öffnung[15] durch;
Stolonen aus dem vorderen Ende treibend,
Setzt sich der Jungpolyp fest,
Verlängert den Hydrocaulus zur englaufenden Röhre,
Umgibt zum Schutz ihn mit widerstandsfähigem Periderm,
Woraus Seitenzweige mit Hydrocauli und Hydranten sich bilden,
Unterwasser zum Blütenmeer sich versammeln[16], ist ausreichend Zeit ihnen gegönnt. –
.
Im nördlichen Atlantik, auch in Nordsee und Mittelmeer, ist Ectopleura larynx verbreitet,
Lebt, wohl haben sie Schiffe verschleppt,
Heute auch an Nordamerikas, Australiens und Neuseelands Küsten
Auf Substraten wie Steinblöcken, Felsen, Wracks und Geröll;
Bevorzugt Wasser bis einhundert Meter Tiefe,
Nimmt auch starke Strömung und stürmisches Wasser nicht krumm.
.
Fußnoten
[1] Periderm: Chitinöse Hülle von Polypen
[2] Stolonen: Basale hohle Ausläufer, die benachbarte Polypen miteinander verbinden
[3] Hydrocaulus, Scapus (Polypen): schmaler Teil (Stamm) eines Polypen
[4] Hydrant: Erweiterter Kopfteil eines Hydropolypen
[5] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[6] Mund-After-Öffnung: Körperöffnung, die zugleich als Mund und After verwendet wird
[7] Gewöhnlicher Röhrenpolyp: Ectopleura larynx (Tubulariidae; nicht behandelt – Aplanulata – Anthoathecata – Leptolina – Hydrozoa – …)
[8] Sporensäcke: Stark abgewandelte Medusoide (Cryptomedusoid, Heteromedusoid, Styloid) als Träger von Gameten
[9] Cryptomedusoid (Hydrozoa, Cnidaria): Am Hydropolypen festsitzendes, als ein zweites reduktiv stärker abgewandeltes medusenähnliches Stadium
[10] Larven: Jugendstadien von Tieren, die sich grundsätzlich vom Erscheinungsbild Erwachsener unterscheiden und erst nach einer Metamorphose Adultgestalt annehmen
[11] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Reife, haploide Keimzellen; Gameten, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind
[12] Eizellen: Unbewegliche, nährstoffreiche, weibliche, haploide Keimzellen
[13] Subumbrellarhöhle: Höhle der Quallenunterseite, gebildet von Subumbrella und Velum
[14] Actinulalarve: Larvenform verschiedener Leptolina (Hydrozoa) mit ellipsoidem, voranschwimmendem Ende, das später die Anheftungsstelle des Polypen wird und mit Tentakelkanz am hinteren Ende, das sich zum Mundfeld entwickeln wird.
[15] Mund-After-Öffnung
[16] Polypenstock: Aussehen einer Kolonie, doch sind die einzelnen Individuen über ein gemeinsames Gewebe verbunden, unterscheiden sich darin von Kolonien, die durch dichte Siedlung einzelner Individuen gekennzeichnet sind
Eingestellt am 23. November 2024
.
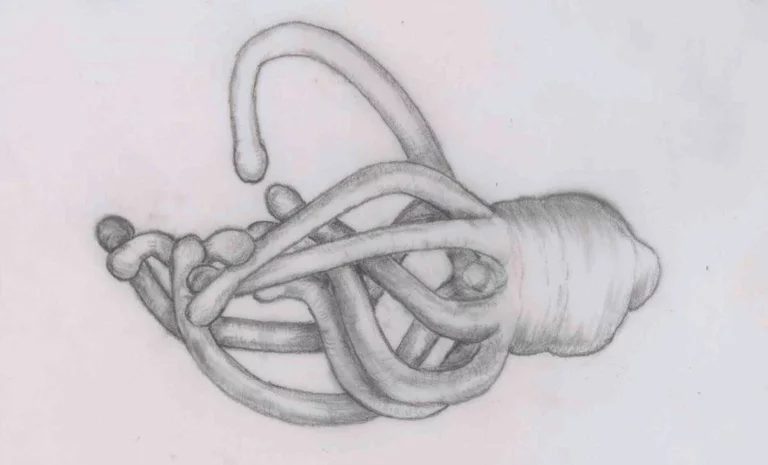
Actinula-Larve (Bleistift; Reinhard Agerer)
Actinula-Larve von Tubularia sp., Aplanulata: rechts der aborale Pol mit dem sich die Larve festsetzt.
Nach Westheide & Rieger (2013), S. 127, Abb. 198
Eingestellt am 23. November 2024
.

Oben: Gewöhlicher Röhrenpolyp, Ectopleura larynx
Autor: Ecomare/Sytske Dijksen
Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert
Unten: Safranfarbener Röhrenpolyp, Ectopleura crocea
Autor: Seascapeza
Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
.

Aplanulata, Planulalose:
3 Margelopsis haeckelii
.
Eine Vermehrungsvielfalt besonderer Art zeigt Haeckels Margelopsis:
Entwickeln Polypen aus unbefruchteten Eiern[5],
Durch die, im Meerwasser pelagisch[6] lebend, der Medusen Populationen werden knospend verstärkt.
.
Im Hochsommer aber entstehen größere Dauereier,
Deren Entwicklung parthenogenetisch auf Sterroblastulae[7] zielt,
Die, sich festsetzend, falls peridermumgeben[8], als Dauerstadien wirken,
Woraus Polypen, die wieder pelagisch leben, entsteh’n.
Ungeschlechtliche Fortpflanzung scheint hier die Regel,
Kommt nicht doch, was unbekannt, zwischendurch Sex gelegentlich vor.
.
Vielleicht gingen Männchen durch genetischen Unfall dem Lebenskreislauf einmal verloren,
Falls nicht doch zwischendurch eine Meduse als Männchen wirkt.
Scheinen offensichtlich nicht an genetischer Monotonie zu leiden,
Denn im Kreislauf dreimal asexuell sich zu vermehren, gibt Hoffnung auf Diversität durch positiv wirkende Mutation[9].
.
Fußnoten
[1] Medusen, Quallen: Ein freischwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere
[2] Asexuell (Vermehrung): Nur aufgrund von Mitosen gebildet
[3] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.
[4] Parthenogenetisch: Eine Fortpflanzungsstrategie, bei der sich ein weiblicher (selten männlicher) Gamet ohne Befruchtung zum Adult entwickelt
[5] Eizellen: Unbewegliche, nährstoffreiche, weibliche, haploide Keimzellen
[6] Pelagisch: schwimmend, schwebend
[7] Sterroblastula: Ein frühes ontogenetisches Stadium der Animalia, das einer dicht gepackten, vielzelligen Morula, also einem großen kugligen Zellhaufen entspricht
[8] Periderm: Chitinöse Hülle von Polypen
[9] Mutation: Spontan auftretende, dauerhafte Veränderung des Erbguts
Eingestellt am 23. November 2024
.

Calycophorae, Glockenträger:
1 Fehlender Halt
.
Weil sie ein bis zwei große Schwimmglocken[1] besitzen,
Fehlt ihnen, brauchen ihn wohl auch nicht, ein Pneumatophor[2];
Setzen gleichartige Zoide[3] in Gruppen zusammen; werden zu
Selbständigen, gametentragenden Einheiten, lösen sie sich vom Siphonophor[4].
.
Medusenähnlich[5] gestalten sie Schwimmglocken,
Schon wegen der Größe, doch auch wegen der Mesogloea[6] Dicke und Form.
.
Fußnoten
[1] Schwimmglocken, Nectophoren: Glockenartig umgewandelte, mit der Exumbrella am Zentralpolypen ansitzende, im Subumbrellarraum undifferenzierte, kontraktionsfähige Medusoide, die einen Polypenstock vorantreiben können
[2] Pneumatophor: Luft-, Gasträger; Luftkissen
[3] Zoide: Polypenähnliche Formen der Staatsquallen, mit unterschiedlichen Aufgaben.
[4] Siphonophor: Zentraler Polyp, Stammpolyp der Staatsquellen, an dem modifizierte Polypen und Medusoiden hängen
[5] Medusen, Quallen: Ein freischwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere
[6] Mesogloea: Gallertartiges Gewebe bei Ctenophora (Rippenquallen) und Cnidaria (Nesseltieren), den Hohltieren, das den Zwischenraum zwischen der Gastrodermisschicht und der Epidermisschicht außen füllt. Sie ist zunächst zellfrei, bei den meisten Gruppen wandern jedoch verschiedene Zellen in die Schicht ein. Es handelt sich dabei aber nicht um ein drittes Keimblatt, nicht um ein Mesoderm.
Eingestellt am 23. November 2024
.

Abylidae, Calycophorae
Zentrum: Rosacea cymbiformis, Polypenstock. – Oben links: Rosacea cymbiformis, Gruppe infertiler, männlicher Medusen. – Rechts: Bassia bassensis, Polypenstock. – Oben Mitte: Bassia bassensis, obere Schwimmglocke von oben. – Unten rechts: Bassia bassensis, obere Schwimmglocke Innenseite. – Unten Mitte: Bassia bassensis, untere Schwimmglocke on unten. – Oben rechts: Bassia bassensis, Gruppe infertiler und eine männliche Meduse. – Unten links: Bassia bassensis, weibliche Meduse.
Autor: Ernst Haeckel
Lizenz: public domain; unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
.

Capitata, Kopftentakler:
1 Kurz gefasst
.
Kurzgefasst, grenzen doch nur wenige
Morphologische Merkmale sie als eigenständige Unterordnung ab:
Keulenförmig meist die Polypen[1],
Mit oft köpfentragenden Tentakeln[2] daran;
Legen jedoch auf Planulalarven[5] noch Wert.
.
Fußnoten
[1] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.
[2] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[3] Stenothelen: Nesselkapseln mit stilett- oder skalpellartigen, leicht gekrümmten, messerscharfen, oft in zwei Etagen angeordneten Strukturen an der etwas verbreiterten Basis des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs
[4] Anthoathecata: Unbehüllte Blütenhydren (Leptolina – Hydrozoa – Medusozoa – Cnidaria – Animalia –…)
[5] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria
Eingestellt am 23. November 2024
.

Capitata Kopftentakler:
2 Einzelhänger (HP,TP)
.
Schier endlose Überschläge des wendigen Turners
Erstaunen, ja faszinieren
Das spannungsvoll wartende Publikum:
Weit greift er aus, findet Arm für Arm seinen Halt,
Hebt und verbiegt elastisch den Körper,
Setzt fest seinen Fuß am anderen Ort,
Löst seine Arme aufs Neue und
Wieder beginnt das artistische Spiel.
.
Nur zeitlupenartig mutet das Schauspiel Zuschauer an.
Was Wunder, in Wasser nur findet die Vorführung statt;
Es dämpft die Bewegung, bewirkt sanfte Landung,
Verhilft den suchenden Armen zum nächstfolgenden Tanz.
.
Vielarmig klebt sich der Künstler auch an glatteste Flächen;
Der breitsohlige Fuß – sein einziger nur –
Stabilisiert ihn beim aufrechten Stand
Am neu gewählten Aufenthaltsort.
.
Winzig klein ist er, oft grün noch dazu.
Selbst in teichwasserbefüllten Aquariengläsern
Recken und strecken sich Männchen und Weibchen,
Angeln mit langen tentakelförmigen Armen[1].
.
Hydra[2] heißt heute der staunenerregende Akrobat;
Hydris nennen wir einfachheitshalber den Ahnen dieser biegsamen Figur.
Wie begann womöglich sein Dasein?
Wie lebt sich an diesem für nesselnde Tiere[3] so seltsamen Ort? –
.
Staatsquallen[4] sind ihre fernen Verwandten,
Doch Hydris beschritt bedeutend einfachere Wege.
Segelt nicht frei hinaus in die Welt;
Verschmäht enge Verbindung mit Tochterpolypen.
.
Nimmt das Leben selbst in die Hand,
Trägt Eizellen[7] wohlgeschützt in der Wand,
Überlässt Spermienpflege[8] dem Mann.
.
Fest umschlossen warten Oocyten[9] auf schwärmende Spermatozoide,
Verbleiben befruchtet am Körper der Mutter.
Wappnen geschickt sich für lebenswidrige Zeit.
.
Keine Planulalarve[12] entstammt der Zygote,
Ein junger Polyp[13] entschlüpft vielmehr,
Wächst zur endgültigen Größe und sprosst –
Clonal[14] sich vermehrend – junge Polypen aus seiner Seite hervor.
.
Worin liegt der Vorteil, den Hydris[15] klug für sich nutzte?
Wofür legte sie ab eigenbewegliche Larven[16], befreite Medusen?
Wozu hält sie Eizellen fest in der Tasche,
Hüllt Zygoten mit zerzaustem Schutzmantel ein?
Warum wandert kopfüber kopfunter sie, den Halt nie verlierend,
Nur schrittchenweise zu neuem Revier? –
.
Am Meeresrand ist Hydris das Polypengedränge zu dicht,
Der tödlichen Feinde Nähe, viel zu groß die Gefahr.
So zieht sie hinein in die Mündung der Flüsse,
Stemmt sich der Strömung mit Armen und Beinen[17] entgegen.
.
Wer sich beim Klettern zuverlässigen Halt stets bewahrt,
Auch während des Griffwechsels an steiler Wand,
Sorgt heftig rüttelnder Strömung vor, auch tödlichen Stürzen,
Erreicht wohlbehalten auch ein fernliegendes Ziel.
.
Über viele Generationen hinweg währende Fehlversuche nahm Hydris in Kauf,
Bis letzte Versuche den Körper tief genug beugten,
Den Untergrund Arme fest ergriffen,
Zugleich der Fuß sicheren Stand nicht verlor.
.
Einmal erfunden, klonierte Hydris millionenfach dieses Patent.
Selbst Teile von ihr, von Wellen zerschlissen,
Wachsen zu neuen, regenerierten Polypen heran,
Die verblüffende Lösung für immer zu sichern.
.
So rettet sich Hydris in stilleres Wasser,
Gewährt geschlechtszellbestückten Medusen aber weiterhin Freiheit,
Verliert jedoch später jegliche Qualle[18], jeden durch Sex entstandenen Nachwuchs
Durch heftige Strömung zum Meer.
.
Auch Verwandte verzichteten früh auf Planulas schon.
Umhüllten Zygoten entschlüpften Minipolypen,
Setzten sich fest am Ort der Geburt.
Nur Hydris‘ Polypen gehen auf Wanderschaft.
.
Wie viele Generationen es brauchte,
Medusen in Medusoide umzugestalten,
In einfache Sporensäcke[19] zu wandeln,
Eizellen direkt in die Wand des Polyps dann zu integrieren,
Zygoten für längere Zeit bei sich zu behalten,
Nicht zu verlieren, ist nicht bekannt.
.
Doch, jeder der Schritte brachte Hydris dem großen Erfolg ein Stück näher,
Bis lange vor unserer Zeit Hydris Hydra gebar,
Die wandzerklüftete Dauerzygote[20], ufernah fest sich verankernd,
Für Jungpolypen strömungsberuhigten Zufluchtsort fand. –
.
Der grünen Hydra, der Viridis[21], waren die Fänge manchmal zu knapp,
Angelte, Nahrung trickreich ergänzend,
Chlorellen[22] aus dem fließenden Wasser,
Verdaute sie nicht – nahm in Zellen sie auf[23].
.
So bringen auch wenig belebte Bäche Viridissima[24] kaum noch Probleme.
Bleiben die Angeln[25] mitunter auch leer,
Wendet sich Hydra, zielstrebig wandernd,
Auf weichsohligem Fuß und Armen dem lichten Halbschatten zu.
.
Flüsse, Bäche, damit verbundene Seen, wählt Hydra zur künftigen Heimat,
Doch Pfützen, Weiher und Teiche sind oft zu weit für Hydren entfernt.
Sie warten auf Wind, auf stürmisches Wetter:
Mit Wasser vermischte Zygoten treiben dann über Land;
Warten vielleicht auf moderne Vehikel
Für Transport als blinde Passagiere dorthin.
.
Fußnoten
[1] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[2] Hydra spp. (Capitata – Anthoathecata – Leptolina – Hydrozoa – Medusozoa –…)
[3] Cnidaria: Nesseltiere (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)
[4] Staatsquallen: Siphonophorae (Leptolina – Hydrozoa – Medusozoa - Cnidaria – Animalia –…)
[5] Medusen, Quallen: Ein freischwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere
[6] Medusoide: An Polypen festsitzende, reduktiv abgewandelte Medusen
[7] Eizellen: Unbewegliche, nährstoffreiche, weibliche, haploide Keimzellen
[8] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Reife, haploide Keimzellen; Gameten, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind
[9] Oocyte: Eizelle
[10] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand
[11] Periderm: Chitinöse Hülle von Polypen
[12] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria
[13] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.
[14] Clonale Vermehrung: Asexuelle Vermehrung (rein mitotisch bedingte Vermehrung, daher Individuen genetisch identisch)
[15] Name für hypothetischen Vorfahren
[16] Larven: Jugendstadien von Tieren, die sich grundsätzlich vom Erscheinungsbild Erwachsener unterscheiden und erst nach einer Metamorphose Adultgestalt annehmen
[17] Tentakel
[18] Quallen: Schirm- oder glockenförmige Nesseltiere
[19] Sporensäcke (Hydrozoa, Cnidaria): Stark abgewandelte Medusoide (Cryptomedusoid, Heteromedusoid, Styloid) als Träger von Gameten
[20] Dauerzygote: Zygote, die der Überdauerung dient, meist gekennzeichnet durch dicke, widerstandsfähige, oft auch dunkle Wand
[21] Grüne Hydra: Hydra viridissima (Capitata – Anthoathecata – Leptolina – Hydrozoa – Medusozoa –…)
[22] Chlorella (Chlorococcales – Chlorophyceae – Chlorophyta – Plantae – Eukarya)
[23] Endosymbiont: Aufgenommener, womöglich etwas abgewandelter Organismus, der zu seinem und zum Vorteil des Herberggebers in der fremden Zelle lebt
[24] Hydra viridissima
[25] Tentakel
Eingestellt am 23. November 2024
.

Grüne Hydra, Hydra viridissima
Autor: Frank Fox
Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license; unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
.

Capitata, Kopfentakler:
3 Unechte Feuerkorallen
.
Drei Hauptmerkmale offenbaren Trivial- und wissenschaftliche Namen:
‚Feuer‘, weil brennende Schmerzen entsteh’n, trifft das Cnidom[1] menschliche Haut,
.
Sich festsetzende Planulalarven[6]
Entwickeln zunächst ein dreidimensionales Stolonengeflecht[7]
Dünnster Röhren, die, Kalk absondernd,
Unterlagen mit kaum millimeterdicker Schicht überzieh’n.
.
Manche Arten bedecken mit Krusten, worauf sich die Planula setzte;
Andere wachsen, reich sich verzweigend, wie Strauchkorallen weg vom Substrat,
Formen allmählich einige Dezimeter hohe Polypenstöcke[8];
Zweidimensional bleibt eine letzte Gruppe, zieht kalkige Platten als Mauern empor.
.
Ektoderm[9] bedeckt oben-außen die Kalksysteme;
Wo es auf winzige, eng stehenden Poren trifft,
Besteht Verbindung zum mikroskopisch kleinen Polypen[10],
Der mit Gastroderm[11] seiner Stolonen Verbindung hält.
.
Trimorph[12] erweisen sich Milliporas Polypen:
Fresspolypen[13], kurz und gedrungen, mit den andern verglichen recht groß,
Stehen vier bis sieben kurze, keulige oder kopfige Fangarme[14]
Rund um den beuteempfangenden Mund[15];
Darauf allein sind Milliporen allerdings nicht angewiesen,
Hüten sie Zooxanthellen[16] doch in Zellen des Ektoderms.
.
Wehrpolypen[17], kleiner und schlanker als die Ernährer,
Sitzen um sie zu fünft, oft bis zu siebt,
Tragen unregelmäßig angeordnete, gleichgeformte Tentakel,
Verzichten, der Spezialisierung wegen, auf ihren Mund.
.
Blastostyle[22] steh’n in des Kalkskeletts Kammern,
Ausgestattet noch mit Radial- und Ringkanälen,
Fangarme[25] und Sinnesorgane fehlen jedoch.
Irgendwie wollen sie dennoch sich wehren:
Bestücken mit Nesselzellen dafür den Schirm.
.
Eine Planulalarve, daraus entstanden,
Setzt sich an Gegenständen irgendwann fest.
.
Pazifiks, Atlantiks und Indischen Ozeans
Leben Unechte Feuerkorallen
Auf Korallenstöcken nahe dem Licht,
Geh‘n wegen symbiontischer Zooxanthellen
Nicht tiefer als vierzig Meter hinab.
.
Fußnoten
[1] Cnidom: Gesamtheit der Nesselzellen(typen)
[2] Kalk: Calciumcarbonat [CaCO3]
[3] Steinkorallen: Scleractinia (Hexacorallia – Anthozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta –…)
[4] Aragonit: [Calciumcarbonat, CaCO3]; Mineral der wasserfreien Carbonate ohne fremde Anionen; kristallisiert im orthorhomischen Kristallsystem mit der chemischen Zusammensetzung Ca[CO3]; löst sich leichter in Säuren als Calcit; https://www.chemie.de/lexikon/Calcit.html; nähere Erklärung dort
[5] Unechte Feuerkorallen: Millepora spp. (Milleporidae; nicht behandelt – Capitata – Anthoathecata – Leptolina – Hydrozoa –…)
[6] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria
[7] Stolonen: Basale hohle Ausläufer, die benachbarte Polypen miteinander verbinden
[8] Polypenstock: Aussehen einer Kolonie, doch sind die einzelnen Individuen über ein gemeinsames Gewebe verbunden, unterscheiden sich darin von Kolonien, die durch dichte Siedlung einzelner Individuen gekennzeichnet sind
[9] Ektoderm: Äußeres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation außen verbliebene Zellschicht der Blastula
[10] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.
[11] Gastrodermis, Gastroderm: Epithel des Verdauungstraktes
[12] Trimorph: In drei verschiedenen Formen
[13] Fresspolypen, Nährpolypen: Typische, mit Fangtentakel versehene, sich mit Beute versorgende Polypen
[14] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[15] Mund-After-Öffnung: Körperöffnung, die zugleich als Mund und After verwendet wird
[16] Zooxanthellen: Endosymbionten in einer Reihe von Lebewesen. Bei den Zooxanthellen handelt es sich meistens um Dinoflagellaten; aber auch um Chrysomonden, Cryptomonaden, Chlorococcales oder Diatomeen kommen vor
[17] Wehrpolypen: Polypen mit einziger Aufgabe Prädatoren zu schädigen oder zumindest abzuschrecken
[18] Nesselzellen, Cnidocyten: Zellen in der Epidermis der Cnidaria, zum Beutefang und zur Abwehr dienend; bei Reizung wird ein Nesselschlauch ausgeschleudert, der häufig ein hochwirksames Gift in das Opfer injiziert
[19] Tentakel
[20] Stenothelen: Nesselkapseln mit stilett- oder skalpellartigen, leicht gekrümmten, messerscharfen, oft in zwei Etagen angeordneten Strukturen an der etwas verbreiterten Basis des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs
[21] Mastigophoren, Rhabdoiden: Nesselkapseln mit rundum etagiert angeordneten Mastigonemen in der unteren Hälfte des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs
[22] Blastostyl: Polypen ohne Mund-After-Öffnung, und ohne Tentakel, deren Aufgabe es ist, Medusen zu bilden
[23] Velum: Bildung der Subumbrella; besteht lediglich aus einer Ektodermfalte unter Beteiligung der Mesogloea
[24] Medusen, Quallen: Ein freischwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere
[25] Tentakel
[26] Manubrium: Lange Röhre als Fortsetzung des Magens und Träger der Mund-After-Öffnung
[27] Gonaden: Geschlechtszellen bildende Organe
[28] Oocyten, Eizellen: Unbewegliche, nährstoffreiche, weibliche, haploide Keimzellen
[29] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Reife, haploide Keimzellen; Gameten, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind
[30] Tropen, tropisch: Klimazone zwischen Äquator und Wendekreisen
[31] Subtropen, subtropisch: Klimazone zwischen Wendekreisen und gemäßigtem Klima
Eingestellt am 23. November 2024
.
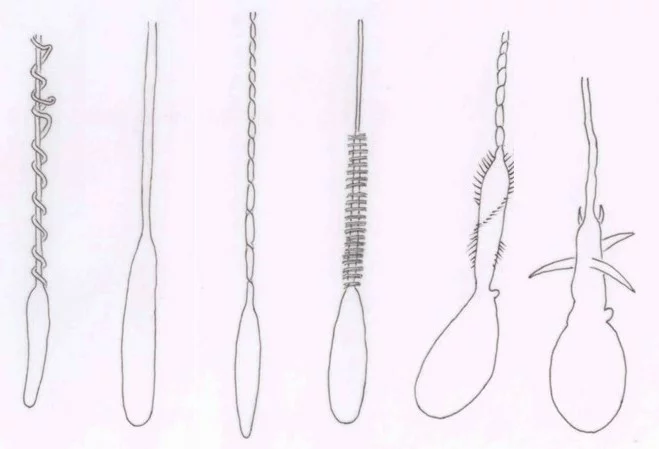
Cniden-Typen: Auswahl (Tusche; Reinhard Agerer)
Von links nach rechts:
Spirocyste, Klebkapsel: Der nach Explosion umgestülpte Schlauch ragt als gerades Stück aus der Cnide, dem, spiralig nach rückwärts wickelnd, sich sein erheblich längerer Teil anschließt und mit klebriger Masse umgeben ist; in der unentladenen Cnide, liegt der Schlauch schraubig um den geraden Teil
Haploneme Isorhize: Der nach Explosion umgestülpte Schlauch ragt als gerades Stück aus der Cnide; in der unentladenen Cnide liegt der Schlauch schraubig
Haploneme Anisorhize: Der nach Explosion umgestülpte Schlauch ragt enggeschraubt Stück aus der Cnide, in Seitenansicht ist die Schraubung kaum mehr erkennbar; in der unentladenen Cnide liegt der Schlauch schraubig
Rhaboide, Mastigophore: Nesselkapseln mit rundum etagiert angeordneten Mastigonemen in der unteren Hälfte des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs; in der unentladenen Cnide, liegt der Schlauch schraubig um den geraden Teil
Eurythele: Nesselkapselschlauch mit zwei unterschiedlichen Bereichen, wenn explodiert: Basal mit kurzem, geradem Anteil, an dem weit spiralig ein Haarkranz emporläuft, an den sich ein engschraubiger Schlauch anschließt, dessen Schraubung in diesem Zustand in Seitenansicht kaum mehr erkennbar ist; in der unentladenen Cnide, liegt der basal gegabelte Schlauch als Rolle
Stenothele: Nesselkapseln mit stilett- oder skalpellartigen, leicht gekrümmten, messerscharfen, oft in zwei Etagen angeordneten Strukturen an der etwas verbreiterten Basis des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs; in der unentladenen Cnide, liegt der basal ungegabelte Schlauch als Rolle
Zeichnung aus Westheide & Rieger, Seite 124, Abb. 193 (Auswahl)
Eingestellt am 23. November 2024
.

Capitata, Kopftentakler:
4 Flotille (HP)
.
Blaue Flossen überragen die schimmernde Fläche des Meeres.
Ein Windhauch bläst sie breitseits voran,
Näher und näher der wasserumspielten sandigen Küste –
Nicht Flossen, Segel treiben die Flotte an Land!
.
Neugierig bückt sich der Jogger
Nimmt achtsam das liegende Segel zur Hand:
Weichglitschige Fäden und Stümpfe
Quellen zwischen den Fingern hervor.
Überrascht lässt er Unfassbares fallen,
Trocknet und wischt die bitzelnde Hand.
.
Woher kommen die Scharen seltsamer Quallen?
Ihr Blau wie das Meer, die bizarre Gestalt,
Das Treiben auf offener See?
Wo war ihr Anfang, wer kennt die verschlungenen Wege, dieses exotischen Wesens? –
.
Wiederholt sucht Levella[1] vergeblich
Sich einen günstigen Platz zu ergattern;
Verengt die Mulde des Fußes[4], noch winzigste Stellen fassen.
.
Schon die Planula[5] mühte sich ohne Erfolg,
Gestaltete schwebend sich zum Polypen gleich um.
.
Kopfüber, kopfunter treibt glücklos Levella im Wasser,
Durchzieht, ununterbrochen fischend, Salzwasserfluten und –
Beim Durchkämmen der obersten Schicht nach Algen[6],
Befüllt eine Sauerstoffperle ihren zur Höhlung vertieften Fuß.
.
Glückt es, die Perle dort zu erhalten,
Besonders, des Fußes Form den Nachkommen zu geben,
So hingen Levellas Polypen für immer
Kopfüber hinein in das Meer.
.
Algen in Hülle und Fülle umgeben Levellas Tentakeln[7],
Denn Licht ist das Leben der Algen und lebend spenden sie Nahrung den andern.
Durch Innovation entdeckte Levella neu eine Nische,
Lebt lange konkurrenzlos der Zukunft entgegen.
.
Künftige Nachkommen steigern den Halt an der Ozeanfläche.
Umstellen die Perle mit luftundurchlässigen Lagen Periderms[8],
Verzweigen röhrig den Gasraum, formen ihn zur rundlichen Platte,
Nur überragt vom luftwärts verlängerten Fuß.
.
Auch er ist durchzogen vom Röhrensystem;
Unterstützt mit luftiger Leichtheit den Auftrieb des Floßes;
Stemmt sich zwar Winden und Wellen entgegen,
Doch treibt das Luftkissen unaufhaltsam dahin.
.
Fischend fährt das Boot zwischen Algen und kleinem Getier.
Die Angeln[9] biegen sich, andauernd pendelnd,
Zurück zum schlürfenden Hydropolypenmund[10],
Mästen Levella, drängen zur Knospung im gleitenden Floß.
.
Tentakelgleich sprießen tief in das Wasser,
Schmal schlauchförmig neue Polypen hinein,
Neben dem mächtig erweiterten Mund des ersten Polypen;
Umgeben unterseits in Kreisen das Zentrum des Boots.
.
Dactylozoide[11] der äußeren Kreise,
Dicht mit Tentakeln besetzt,
Führen von nun an Beute zum weit geöffneten Mund,
Verteidigen zugleich wehrhaft das driftende Schiff.
.
Nährpolypen[12], hin zum Zentrum orientiert,
Entsprießen, dem Schutzraum entschlüpfend, Minimedusen[13],
Sorgen, sexuell sich vermehrend,
Für Wahrung der neu gefund’nen Gestalt.
.
Nicht immerfort driftet Levella im dichten Algengetümmel,
Gleitet auch oft in nährstoffarmen Gewässern dahin.
Verbreitert sich der Mast des Bootes auch nur ein wenig,
So jagten die Floße schneller über ausgedehnte Weiten dahin.
.
Beidseits entwachsen Levellas luftigem Fuß
Stolonen, mit Luftkammern und mit Gastrodermis[14] durchzogen,
Formen ein Segel als flächige Wand:
Levella wandelt sich so zur blauen Velella[15], zur segelnden Qualle im Meer.
.
Levella ging dem Meere verloren,
Nur Velellas blauschimmernde Segel
Begleiten meilenweit
Jedes atlantiküberquerende Schiff.
.
Schwärme von Segelquallen befahren noch heute die See,
Nur einen winzigen Teil davon wehten Winde ans Land.
.
Fußnoten
[1] Name für einen hypothetischen Ahnen
[2] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.
[3] Benthos: Gesamtheit der über, auf oder im Grund oder im Uferbereich von Gewässern lebenden Organismen
[4] Fußscheibe, Fußplatte: Der flächig verbreiterte Anheftungsbereich des Fußes
[5] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria
[6] Algen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für überwiegend im Wasser lebende Thallophyten
[7] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[8] Periderm: Chitinöse Hülle von Polypen
[9] Tentakel
[10] Mund-After-Öffnung: Körperöffnung, die zugleich als Mund und After verwendet wird
[11] Dactylozoide, Wehrpolypen: Polypen mit meist einziger Aufgabe Prädatoren zu schädigen oder zumindest abzuschrecken
[12] Nährpolypen, Fresspolypen: Typische, mit Fangtentakel versehene, sich mit Beute versorgende Polypen
[13] Medusen, Quallen: Ein freischwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere
[14] Gastrodermis, Gastroderm: Epithel des Verdauungstraktes
[15] Velella velella: Segelqualle (Porpididae; nicht behandelt – Capitata – Anthoathecata – Leptolina – Hydrozoa –…)
Eingestellt am 23. November 2024
.
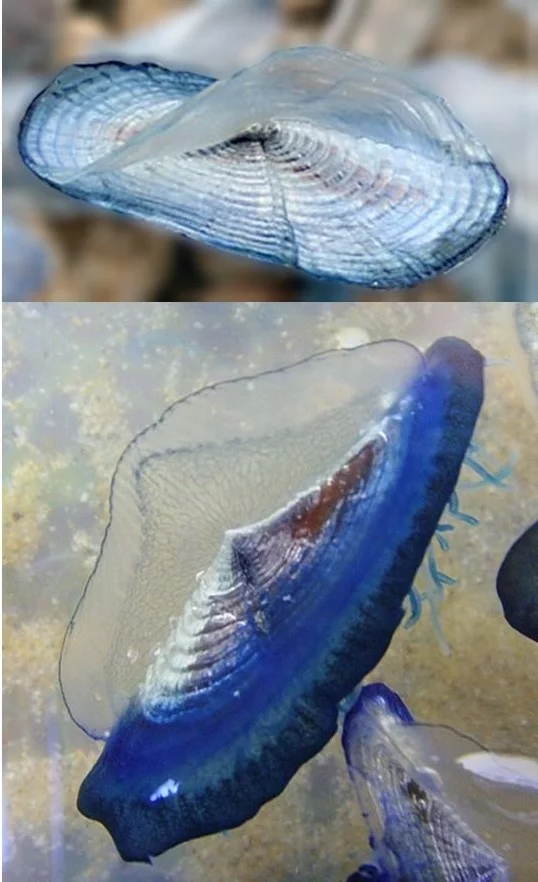
Oben: Velella velella, Segelqualle
Autor: yakafaucon
Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license; unverändert
Unten: Velella velella, Segelqualle
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Velella_Bae_an_Anaon.jpg
Autor: Jymm
Lizenz: public domain; unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
.

Charybdeida, Charybdis-Würfelquallen:
1 Kurzcharakteristik
.
Je nach Gattung, vier Mal ein, zwei oder drei Pedalien[1] pro Ecke,
Wobei jedes Pedalium nur einen Tentakel[2] trägt;
Keine Gastraltaschenblindsäcke[3] werden gebildet;
.
Fußnoten
[1] Pedalien: Stark aufgetriebene, wasserkanalführende, dehn- und krümmbare, hochkontraktile basale Teile von Tentakeln oder Tentakelbüscheln
[2] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[3] Gastraltaschenblindsäcke (Cubozoa): Gastraltaschen bilden nach außen Blindsäcke, die in die Subumbrellarhöhle hineinhängen
[4] Haploneme Anisorhize: Nesselkapseln mit schraubig gedrehtem Schlauch, auch nachdem sie explodiert ist; als Anisorhizen, ist eine Schraubung in diesem Zustand in Seitenansicht kaum mehr erkennbar; Haploneme Isorhize: Nesselkapseln mit schraubig gedrehtem Schlauch in der unentladenen Cnide; entladen ist der Schlauch gerade.
[5] Eurythelen: Nesselkapselschlauch mit zwei unterschiedlichen Bereichen wenn explodiert: Basal mit kurzem, geradem Anteil, an dem weit spiralig ein Haarkranz emporläuft, an den sich ein engschraubiger Schlauch anschließt, dessen Schraubung in diesem Zustand in Seitenansicht kaum mehr erkennbar ist und in Spitzenansicht keine Höhlung erkennen lässt.
[6] Stenothelen: Nesselkapseln mit stilett- oder skalpellartigen, leicht gekrümmten, messerscharfen, oft in zwei Etagen angeordneten Strukturen an der etwas verbreiterten Basis des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs
[7] Cnidom: Gesamtheit der Nesselzellen(typen)
Eingestellt am 23. November 2024
.
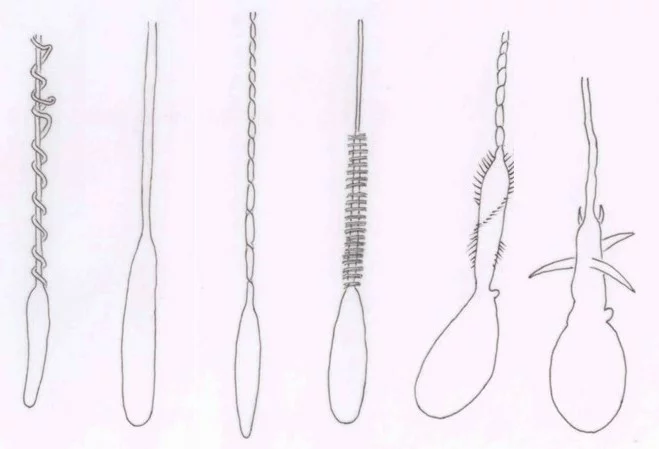
Cniden-Typen: Auswahl (Tusche; Reinhard Agerer)
Von links nach rechts:
Spirocyste, Klebkapsel: Der nach Explosion umgestülpte Schlauch ragt als gerades Stück aus der Cnide, dem, spiralig nach rückwärts wickelnd, sich sein erheblich längerer Teil anschließt und mit klebriger Masse umgeben ist; in der unentladenen Cnide, liegt der Schlauch schraubig um den geraden Teil
Haploneme Isorhize: Der nach Explosion umgestülpte Schlauch ragt als gerades Stück aus der Cnide; in der unentladenen Cnide liegt der Schlauch schraubig
Haploneme Anisorhize: Der nach Explosion umgestülpte Schlauch ragt enggeschraubt Stück aus der Cnide, in Seitenansicht ist die Schraubung kaum mehr erkennbar; in der unentladenen Cnide liegt der Schlauch schraubig
Rhaboide, Mastigophore: Nesselkapseln mit rundum etagiert angeordneten Mastigonemen in der unteren Hälfte des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs; in der unentladenen Cnide, liegt der Schlauch schraubig um den geraden Teil
Eurythele: Nesselkapselschlauch mit zwei unterschiedlichen Bereichen, wenn explodiert: Basal mit kurzem, geradem Anteil, an dem weit spiralig ein Haarkranz emporläuft, an den sich ein engschraubiger Schlauch anschließt, dessen Schraubung in diesem Zustand in Seitenansicht kaum mehr erkennbar ist; in der unentladenen Cnide, liegt der basal gegabelte Schlauch als Rolle
Stenothele: Nesselkapseln mit stilett- oder skalpellartigen, leicht gekrümmten, messerscharfen, oft in zwei Etagen angeordneten Strukturen an der etwas verbreiterten Basis des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs; in der unentladenen Cnide, liegt der basal ungegabelte Schlauch als Rolle
Zeichnung aus Westheide & Rieger, Seite 124, Abb. 193 (Auswahl)
Eingestellt am 23. November 2024
.

Charybdeida, Charybdis-Würfelquallen:
2 Die Tänzer
.
Der Dreifüßige Cystenträger[1], sein Name verrät es,
– Zellen, deren Geißeln[6] zu Stiften versteift,
Überzieh‘n als Sinnesorgane den Körper –
Zieht sich, wenn ungünstig die Lebensbedingungen, in eine Kapsel[7] zurück,
Holt seine drei Tentakel ein, einer davon auffällig lang,
Umgibt sich mit dünner Schicht Periderm.
Werden Strömungen heftiger, dann wird er vertragen:
Ihm macht es nichts! Löst sich, andernorts angekommen, daraus,
Sucht kriechend sich neu einen günstigen Ort,
Streckt nur einen Tentakel voran,
– Unklar ist, wie und wo er diesen verwendet –
Heftet sich fest, vollzieht als Polyp, wie’s in der Sippe so Brauch.
.
Zu Spermienbündel[8] fassen Quallenmännchen Spermatozoide zusammen,
Werden in speziellen Taschen gelagert und, damit
Zusammen sie halten, mit einer Membran[9] umgeben.
Aufwendig scheint es, bis er übertragen sie darf:
.
Zuerst schwimmen Männchen und Weibchen nebeneinander.
Irgendwann fängt das Männchen mit einem Tentakel einen der Braut,
Freier und Braut dreh'n sich danach im Kreis eine Weile;
Erhört, überbringt er auf einem Tentakel ihr das Spermienpaket,
Sie, nicht unverständlich, führt es mit ihrem belad‘nen
Nachdem das Männchen von ihr schon gelassen.
Dort öffnet die Spermatophore[13] sich,
Nach zwei bis drei Tagen werden sie Planulalarven[16] schon sein.
.
Hat die Braut etwas zu sagen?
Oder entscheidet der Bräutigam nur?
Sie übernimmt zumindest die dargebotene, zukunftverheißende Gabe!
Tut sie dies, weil um sie kein anderer warb?
.
Niedlich müssen die Reigentänzer erscheinen,
Die kaum eines Mädchens Fingerhut groß.
Können vielleicht nur deshalb sie, Arm in Arm zu tanzen, wagen,
Weil als einziger Art wohl auch für sie harmlos das Nesselgift?
.
Fußnoten
[1] Dreifüßiger Cystenträger: Tripedalia cystophora (Charybdeida – Cubozoa – Medusozoa – Cnidaria – Animalia –…)
[2] Pedalien: Stark aufgetriebene, wasserkanalführende, dehn- und krümmbare, hochkontraktile basale Teile von Tentakeln oder Tentakelbüscheln
[3] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[4] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.
[5] Periderm (Cubozoa): Epidermal gebildete Hülle von Polypen
[6] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt. (Abbildung unter „Eukarya, 12 Sprachlos“)
[7] Möglicherweise chitinös
[8] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Reife, haploide Keimzellen, Gameten, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind
[9] Möglicherweise chitinös
[10] Mund-After-Öffnung: Körperöffnung, die zugleich als Mund und After verwendet wird
[11] Manubrium: Lange Röhre als Fortsetzung des Magens und Träger des Munds
[12] Gastralraum (Schwämme, Nesseltiere): Großraum nahe des Osculums, oder des Mund-Afters, in den alle zuführenden engeren, dann weiteren, wasserführenden Kanäle oder Taschen münden
[13] Spermatophore: Zu männlichen Reproduktionsorganen verpackte Spermien, um die Übertragung auf Weibchen zu erleichtern
[14] Gonaden: Geschlechtszellen bildende Organe
[15] Eizellen: Unbewegliche, nährstoffreiche, weibliche, haploide Keimzellen
[16] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria
Eingestellt am 23. November 2024
.

Tripedalia cystophora, Dreifüßiger Cystenträger
Autoren: Jan Bielecki, Alexander K. Zaharoff, Nicole Y. Leung, Anders Garm, Todd H. Oakley
Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
.

Chirodropida, Hand-Würfelquallen:
1 Ein paar gute Merkmale
.
An jedem der Finger, so könnte jemand sie nennen, mit einem Tentakel[3] verseh’n.
Als Klauen vielleicht ließen diese sogar sich bezeichnen, obwohl schlängelnd biegsam, Greifen sie damit doch Beute ohne Chance zur Flucht.
.
Zwei Blindsäcke bildet jede Gastraltasche[4],
Die nach außen in die Subumrrellarhöhle hängen hinab.
Kommen bei Chirodropida noch Rhabdoiden[9] hinzu.
.
Kriechen Polypen[10],
Strecken sie nicht nur einen Tentakel voran.
.
Fußnoten
[1] Pedalien: Stark aufgetriebene, wasserkanalführende, dehn- und krümmbare, hochkontraktile basale Teile von Tentakeln oder Tentakelbüscheln
[2] Subumbrella: Konkave Unterseite einer Qualle
[3] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[4] Gastraltaschenblindsäcke (Cubozoa): Gastraltaschen bilden nach außen Blindsäcke, die in die Subumbrellarhöhle hineinhängen
[5] Haploneme Anisorhize: Nesselkapseln mit schraubig gedrehtem Schlauch, auch nachdem sie explodiert ist; als Anisorhizen, ist eine Schraubung in diesem Zustand in Seitenansicht kaum mehr erkennbar; Haploneme Isorhize: Nesselkapseln mit schraubig gedrehtem Schlauch in der unentladenen Cnide; entladen ist der Schlauch gerade;
[6] Eurythelen: Nesselkapselschlauch mit zwei unterschiedlichen Bereichen, wenn explodiert: Basal mit kurzem, geradem Anteil, an dem weit spiralig ein Haarkranz emporläuft, an den sich ein engschraubiger Schlauch anschließt, dessen Schraubung in diesem Zustand in Seitenansicht kaum mehr erkennbar ist und in Spitzenansicht keine Höhlung erkennen lässt.
[7] Stenothelen: Nesselkapseln mit stilett- oder skalpellartigen, leicht gekrümmten, messerscharfen, oft in zwei Etagen angeordneten Strukturen an der etwas verbreiterten Basis des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs
[8] Charybdeida: Charybdis-Würfelquallen (Cubozoa – Medusozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta –…)
[9] Rhabdoiden, Mastigophoren: Nesselkapseln mit rundum etagiert angeordneten Mastigonemen in der unteren Hälfte des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs
[10] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.
Eingestellt am 23. November 2024
.

Chirodropida, Hand-Würfelquallen:
2 Gefürchtetes Seeungeheuer
.
An Queenslands Küsten im Osten Australiens warnen Schilder
Vor Poisonous Jellyfishes[1], die Todesgefahr brächten, wird man davon berührt;
Abgesperrt sogar werden manchmal die Strände,
Damit niemand sich zu diesen gelegentlich tödlichen Quallen verirrt.
.
Als größte Würfelquallenart misst sie bis zu dreißig Centimeter der Quere,
Doch meist erreicht in Australiens Gewässern sie Handspannenlänge nur;
Fünfzehn Tentakel[2] lässt sie im Wasser pro Schirmecke hängen,
An Pedalien[3] wie Klauen jeweils fixiert:
Nur fünf bis fünfzehn Centimeter lang, wenn eingezogen,
Ausgestreckt, wollen Beute sie fangen, zwei Meter und mehr;
So gut wie unsichtbar sind Seewespen,
Ist ihr Körper doch glasklar und volltransparent.
.
Leben fast ausschließlich in küstennahem, flachem Gewässer
Bis fünf Meter Tiefe, kaum etwas mehr.
Fünf-Centimeter-Jungtiere jagen kleinere Krebsartige[4],
Größere, ältere, hin und wieder auch einen Fisch[5], Erwachsene setzen fast völlig darauf.
Mit Alter und Größe nimmt der Nesselzellanteil[6] mit
Hochwirksamen, gegen Wirbeltiere[7] gerichtete Gifte, immer mehr zu.
.
Sie wollen zwar nicht größere Wirbeltiere und Menschen fangen,
Die eher selbst sich verfangen in der Tentakel Schirm,
Den sie breiten, nachdem sie schnell nach oben geschwommen,
Dann gemächlich sinken sich lassen zum Grund;
Bleibt Beute hängen darin, verkürzen sie ihre Tentakel,
Führen, Pedalien dazu noch krümmend, was sie erbeutet, zum Mund[8].
.
Sie selbst werden der Grünen Meeresschildkröte[9] und größerer Fische Beute,
Gleichgewicht zu erhalten im Ökosystem.
Doch immer noch bleiben Schwärme von Seewespen über,
Von denen der Mensch bedroht sich fühlt.
.
Heftige Schmerzen folgen sofort
– Er fühlte sich wie mit glühendem Eisen berührt,
Berichtete jemand, der sehr daran litt. –
Myotoxisch[10] wirkt ihr Gift,
Herzmuskeln werden malträtiert,
Auch der Blutfluss und Blutgefäße sind Ziel,
Blutkörperchen fallen der Lyse[11] anheim.
Das Atemzentrum[12] lähmend, kommt nach fünf bis zwanzig Minuten,
.
Besonders Kinder sind davon betroffen, Herzstillstand und Tod.
Nekrosen[15] lassen Narben zurück.
.
Zwei Proteine[16] zumindest wirken zusammen;
Weitere Moleküle des Nesselgifts
Sind daran vermutlich beteiligt, das Gift zu befördern,
Lagern zusammen sich, bilden oft eine komplexe Struktur,
Wirken perforierend an Zellen,
Zerstören Zellmembranen[17] damit.
.
Auch wenn ein Gegengift bereits zur Verfügung,
Das intravenös verabreicht wird,
Sind unbedingt Sofortmaßnahmen in die Wege zu leiten,
Denn Tentakel, am Körper noch klebend, geben weiterhin erhebliche Giftmengen ab.
Oft wird Anwendung von Essig empfohlen,
Weil nichtentladene Nesselkapseln sie dauerhaft inaktiviert. –
.
Haften mit klebriger Fläche an festem Substrat;
Werden deswegen nicht mit Gezeitenströmungen[20]
Von der Küste gespült;
Können jedoch schwimmend zusagende Stellen finden.
Polypen[21] entstehen daraus,
Die keine Nahrung noch nehmen,
Genießen vor Prädatoren[22] durch Nesselkapseln Schutz;
– Jeder Fangarm bewehrt sich mit einziger terminaler Nesselzelle –.
Polypen geben weitere Kriechlarven ab:
Oktober bis November sind Metamorphosen[23] bereits abgeschlossen;
Im späten Südsommer, Januar bis Februar, besteht vor der Küste Seewespengefahr.
.
Fußnoten
[1] Seewespen: Chironex fleckeri (Chirodropida – Cubozoa – Medusozoa – Cnidaria – Animalia –…)
[2] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[3] Pedalien: Stark aufgetriebene, wasserkanalführende, dehn- und krümmbare, hochkontraktile basale Teile von Tentakeln oder Tentakelbüscheln
[4] Krebstiere, Krebsartige: Crustacea (Tetraconata – Mandibulata – Arthropoda – Panarthropoda – Ecdysozoa –...)
[5] Fische: Teleostei i.e.S. (Actinopterygii – Osteognathostomata – Gnathostomata – Umericingulata – Lacertipinnatae –…)
[6] Nesselzellen, Cnidocyten: Zellen in der Epidermis der Cnidaria, zum Beutefang und zur Abwehr dienend; bei Reizung wird ein Nesselschlauch ausgeschleudert, der häufig ein hochwirksames Gift in das Opfer injiziert
[7] Wirbeltiere: Craniota (Nothochordata – Chordata – Deuterostomia – Bilateria – Animalia –…)
[8] Mund-After-Öffnung: Körperöffnung, die zugleich als Mund und After verwendet wird
[9] Grüne Meeresschildkröte: Chelonia mydas (Cheloniidae – Cryptodira – Testudines – Anapsida – Sauropsida –…)
[10] Myotoxisch: wirken Substanzen die Muskeln schädigen oder gar zerstören
[11] Lyse: Auflösung
[12] Atemzentrum: Ein nicht scharf abgrenzbarer Nervenzellverband des Zentralnervensystems, der die Atmung steuert
[13] Erythrem: Mit bloßem Auge erkennbare Rötung der Haut
[14] Ödem: Ansammlung von Flüssigkeit im interstitiellen Raum, die aus dem Gefäßsystem stammt
[15] Nekrosen: Absterben mehrerer Zellen in begrenztem Gebiet
[16] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt, das zweite der beiden benachbarten den Aminosäurerest
[17] Zellmembran: Lipiddoppelmembran (Bacteria, Eukarya) oder Glyceroldiethermembran (Archaea), die das Zellinnere umgibt; bei Plantae als Plasmalemma bezeichnet
[18] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand
[19] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria
[20] Gezeiten, Tide: Wasserbewegungen der Ozeane, die durch von Mond und Sonne erzeugte Gezeitenkräfte im Zusammenspiel mit der Erddrehung verursacht und Wasserspiegel entsprechend gesenkt oder gehoben werden
[21] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.
[22] Prädatoren: Organismen, die andere zum Zweck der Nahrungsaufnahme nutzen und dabei meist töten. Das Opfer eines Prädators ist dessen Beute.
[23] Metamorphose: Entwicklung von der Zygote zum geschlechtsreifen Tier über selbständige Larvenstadien
Eingestellt am 23. November 2024
.
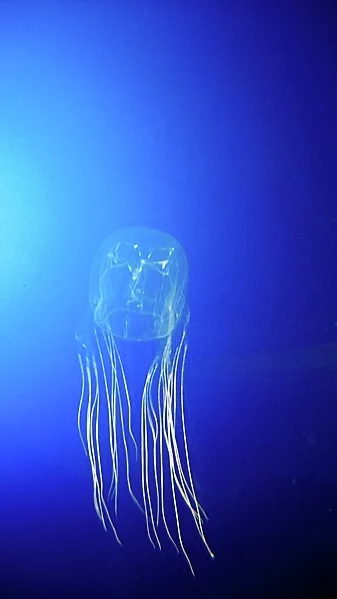
Seewespe, Chironex fleckeri (at Port of Nagoya Public Aquarium, Japan)
Autor: Guido Gautsch
Lizenz: Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license; unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
.

Warnung vor giftigen Quallen (Australien)
Warnschild vor Quallen „Marine Stingers“ im Wasser (in Queensland / Australien) – rechts daneben (im Rohr) liegt Essig zur Erst-Behandlung bereit
Autor: Genet
Lizenz: Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
.

Coronatae, Kronen-, Kranzquallen:
1 Schon an einem Merkmal zu erkennen
.
Wird durch eine rundum laufende Furche in zwei Bereiche getrennt.
Sechzehn Randlappen[3] zu Paaren oder jeweils einzeln stehend,
Werden vier Rhopalien durch Tentakel ersetzt.
Sekundär vermehrt sind Randlappen und Tentakel bei einer vierten[8]
Auf sechs bei einer fünften[9] reduziert.
.
subtropischen[12] Meeren,
Je tiefer sie leben, so dunkler die Farbe:
Violett, dunkelrot oder schwarzbraun gefärbt.
Wandständig durchzieht sie ein Muskelstrang.
.
Medusen fast aller Arten entlassen Keimzellen ins Wasser,
Sterben alsdann, ist ihre Pflicht erfüllt;
Der Planula-Laren[18] Entwicklung erfolgt offenbar ausschließlich im Wasser,
Brutpflege gibt es, wie manchmal abweichend berichtet, nicht.
.
Solitär oder koloniebildend[19] leben Polypen,
Woraus der Kopf des Polypen, sich nur streckend, erweitert;
Distal[22] umläuft die Polypen, wie auch Medusen, ein Ringkanal.
Mit vier Gastralkanälen ähneln sie ihren Medusen.
An Conulata[23] erinnert der Bau:
.
Sie waren mit tetramerem[24] Gehäuse ausgestattet,
Wenn viereckig, hingen vier verschließende Klappen terminal daran.
War vielleicht der Deckel zum Aussterben der Grund?
.
Fußnoten
[1] Medusen, Quallen: Ein freischiwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere
[2] Exumbrella: Konvexe Oberseite einer Qualle
[3] Randlappen: Vorhangartig herabhängende Lappen am unmittelbaren Schirmrand, im Kontaktbereich von Ex- und Subumbrella
[4] Rhopalium: Rand- oder Sinneskörper von Scophozoa (Schirmquallen) und Cubozoa (Würfelquallen), die am Rand des Schirms dieser Nesseltiere zu finden sind. Sie haben die Form kleiner mit Entoderm ausgekleideter Tentakel oder Keulen, die der Oberseite des Schirms der Meduse entspringen durch einen Decklappen geschützt werden; sie gelten als Rückbildungen von Tentakeln. Als Sinneszellen sind Statocysten (Gleichgewichtsorgane) und Ocellen an den entodermalen Zellen der Keulenspitze ausgebildet.
[5] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[6] Nausithoidae: Coronatae (Scyphozoa – Medusozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta –…)
[7] Linuchidae; nicht behandelt und Paraphyllinidae; nicht behandelt: Coronatae (Scyphozoa – Medusozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta –…)
[8] Atollidae; nicht behandelt: Coronatae (Scyphozoa – Medusozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta –…)
[9] Atorellidae; nicht behandelt: Coronatae (Scyphozoa – Medusozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta –…)
[10] Boreal: (Vegetations)zone auf der nördlichen Erdhalbkugel, etwa zwischen 50. und 70. Breitengrad
[11] Tropen, tropisch: Klimazone zwischen Äquator und Wendekreisen
[12] Subtropen, subtropisch: Klimazone zwischen Wendekreisen und gemäßigtem Klima
[13] Litoral: Bezeichnung für die Uferregion eines Sees oder Flusses, wie auch für die Küstenregion des Meeres
[14] Tiefsee: Weitgehend bis völlig lichtlose Bereiche des Meeres, die unterhalb einer Tiefe von mindestens 200 m liegen
[15] Septen: Mesenterien
[16] Septaltrichter: Vom Mundfeld der Polypen ausgehende in Mesenterien eingesenkte Trichter
[17] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.
[18] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria
[19] Kolonie: Dichte Versammlung von Einzelindividuen
[20] Chitin: Polymer aus N-Acetyl-Glucosamin, entstanden aus 1,4-β-Glucosen, an deren C2 eine [–NHCOCH3]-Gruppe hängt; anders ausgedrückt, an deren C2 eine [–NH2]-Gruppe, eine Aminogruppe, hängt, bei der ein Wasserstoffatom durch ein Acetat [CH3COO–] ersetzt ist. Zellwandpolysaccharid der Fungi (Echte Pilze), einiger Cnidaria (Nesseltiere) und Exoskelett der Arthropoda (Gliederfüßer)
[21] Periderm: Chitinöse Hülle
[22] Distal: Entfernt von einem vorgegebenen Bezugspunkt; meint z. B. bei festsitzenden Organismen einen von der Anheftungsstelle entfernten Bereich.
[23] Conulata (†): Coronatae (Scyphozoa – Medusozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta –…)
[24] Tetramer: vierteilig
[25] Ordoviz-Zeit: vor ca. 485 – 443 Millionen Jahren
[26] Trias-Zeit: vor etwa 251 – 199 Millionen Jahren
Eingestellt am 23. November 2024
.

Coronatae, Kronen-,Kranzquallen:
2 Nausithoe
.
Vornehmlich klein sind die Medusen[1] mit
Sechzehn Lappen[2] am Rand,
Gonaden[5] – zu vier mitunter gepaart –
Liegen unter- oder außerhalb der coronataetypischen Furche.
Zu den Tentakeln zentripetal[6],
Ziert sie ein winziger Augenfleck oberhalb der Rhopalien,
Auch Randlappen schmückten sich: Je ein Pigmentfleck liegt mittendrin.
.
Eumedusoides[7] lebt gern in mediterranen Meereshöhlen.
Doch bleiben Ephyren[10] am Stapel beisammen,
Bilden Geschlechtsorgane vorort;
Leben zwittrig[11] mit möglicher Selbstbefruchtung,
Wonach im Bauchsystem Planulalarven[12] entsteh’n.
.
Andere Arten entwickeln laufend freie Ephyren,
Wobei eine nach der andern dem Becher entschlüpft.
Wenige nur verzichten ganz auf Medusen,
Nur eine rudimentäre Furche weist darauf hin.
Auch Polypen gelten manchen als überflüssig:
Verzichten völlig darauf.
.
Punctata[13] gehört zu den Schönsten der Gattung:
Ihre Färbung wechselt von Grün zu hellerem Braun,
Gonaden leuchten meist gelb oder rot, auch dunkelbraun,
Rötliche Flecke zieren der Qualle Darm.SL
.
Fußnoten
[1] Medusen, Quallen (Cnidaria): Ein freischiwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere
[2] Randlappen: Vorhangartig herabhängende Lappen am unmittelbaren Schirmrand, im Kontaktbereich von Ex- und Subumbrella
[3] Rhopalium: Rand- oder Sinneskörper von Scophozoa (Schirmquallen) und Cubozoa (Würfelquallen), Hydrozoa (Hydrentiere), die am Rand des Schirms dieser Nesseltiere zu finden sind. Sie haben die Form kleiner mit Entoderm ausgekleideter Tentakel oder Keulen, die der Oberseite des Schirms der Meduse entspringen durch einen Decklappen geschützt werden; sie gelten als Rückbildungen von Tentakeln. Als Sinneszellen sind Statocysten (Gleichgewichtsorgane) und Ocellen an den entodermalen Zellen der Keulenspitze ausgebildet.
[4] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[5] Gonaden: Geschlechtszellen bildende Organe
[6] Zentripetal: Richtung Zentrum
[7] Nausithoe eumedusoides (Coronatae – Scyphozoa – Medusozoa – Cnidaria – Animalia –…)
[8] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.
[9] Strobilation (Medusenbildung): „Zapfenbildung“ im Zuge der Medusenentstehung bei Scyphozoa; seriale Anordnung der Ephyren erinnert an einen Zapfen (Strobus)
[10] Ephyra: Larvenform bei Medusozoa; Scheibe mit kurzen, zweilappigen, flügelartigen Anhängen
[11] Zwitter: Weibliche und männliche Gameten befinden sich auf ein und demselben Individuum, müssen aber nicht zur gleichen Zeit zur Reife kommen
[12] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria
[13] Nausithoe punctata (Coronatae – Scyphozoa – Medusozoa – Cnidaria – Animalia –…)
SL Molinari CG, Collins AG, Morandini AC (2023) A morphological review of the jellyfish genus Nausithoe Kölliker, 1853 (Nausithoidae, Coronatae, Scyphozoa, Cnidaria). Zootaxa 5336(1): 1-32
Eingestellt am 23. November 2024
.

Nausithoe aurea
Autor: unknown
Lizenz: The copyright holder of this file allows anyone to use it for any purpose, provided that the copyright holder is properly attributed.
Eingestellt am 23. November 2024
.

Cubozoa, Würfelquallen:
1 Ouvertüre
.
Woraus der dünnere Teil nur ragt hervor,
Winkt an des stumpfkegligen Mundrohrs[3] Basis
Mit der Tentakel Kranz.
.
Durch seitliche Knospung erhält er Gesellschaft:
Tentakelvoran schleicht der junge Polyp sich kriechend davon.
Nur ein einziges Mal kann der Polyp zur Meduse[4] sich wandeln,
Bevor er den Becher für immer zur Gänze verlässt.
.
Sie fasst die Tentakel[5] zu Viererpaketen zusammen,
Ersetzt sie durch randliche Sinnesorgane,
Treibt vollkommen neugestaltete Ruten[6].
Hohle gebog’ne Pedalien[7] verbinden Tentakel mit wellenrandigem Saum.
.
Zur rundwürflig schwebenden Haube höhlt sich
Der Schirm der modernen Meduse.
Den Randsaum mit kräftigem Ringmuskel stärkend,
Wird er zur rhythmisch pulsierenden Pumpe mit Rückstoßprinzip.
.
Für Richtungswechsel, für Feinjustierung der Schwimmbewegung
Zieht sich der Ringmuskel asymmetrisch zusammen,
Ändert so gezielt des Velariums[8] Lage,
Orientierung des strömenden Jets.
.
Pedalien wirken als ergänzende Steuer:
Sich krümmend, ändern sie ohne viel Aufwand den Kurs.
Hin zum Zentrum gewölbt,
Biegen sie beutebelegte Tentakel zum rüsselartigen Mund. –
.
Bedauernswerte Opfer, die unter der Haut giftgefüllte Schläuche verspüren!
Ein höllisches Stechen peinigt den Schwimmer warmer Meeresgewässer.
Krämpfe und Fieber wollen nicht gehen – Lähmung des Atemzentrums führt
mitunter zum Tod.
Helfen Seewespen hochentwickelte Augen, das Opfer zu finden?
.
Fußnoten
[1] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.
[2] Periderm: Chitinöse Hülle
[3] Mundrohr: Die Mundöffnung ist auf das Ende einer langen Röhre der Subumbrella verlegt
[4] Medusen, Quallen: Ein freischwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere
[5] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[6] Tentakel
[7] Pedalien: Stark aufgetriebene, wasserkanalführende, dehn- und krümmbare, hochkontraktile basale Teile von Tentakeln oder Tentakelbüscheln
[8] Velarium: Bildung der Subumbrella; ist von gastrovaskularen, also von entodermal ausgekleideten Kanälen durchzogen; unterscheidet sich damit grundlegend vom Velum der übrigen Medusoza, das lediglich aus einer Ektodermfalte unter Beteiligung der Mesogloea besteht
Eingestellt am 23. November 2024
.

Cubozoa, Würfelquallen:
2 Andersartig
.
Die bislang fünfzig beschriebenen Arten,
– Zehn wurden in den letzten zehn Jahren erst entdeckt –
Zeigen, an Nicht-Bilaterien[1] gemessen, eine
Überraschend hohe Organisation,
Morphologie, Verhalten und die Organe betreffend,
Obwohl nur einige Arten bis heute genauer analysiert.
.
Obwohl Polypen[2] recht klein, zeigen auch sie Ungewöhnliches:
Können sie bilden, oder auf ihn völlig verzichten;
Wenn etwas längergezogen ähnelt er einem Rüssel,
Den ein ektodermaler Nervenstrang, ein zweiter entodermalen Ursprungs, in der Basis umringt.
.
Tentakel zeigen eine leichte Dehnung am Ende,
Sind an der Basis gleichfalls etwas verdickt,
Tragen je nach Verwandtschaft, längsparallel geordnete Nesselzellen[7]
Oder vertrauen einer einzigen, terminalen[8] riesigen nur.
Keinen Hohlraum besitzen Polypentakel, können sich bis zur kugligen Form kontrahieren,
Zieh’n sich gelegentlich völlig zurück;
Nur Stenotelen[9] besitzen Polypen als Nesselzellen,
Medusen[10] bilden jedoch eine Vielfalt davon.
.
Nur unregelmäßige Längsfalten lassen im Innern sich finden,
Septalmuskeln[15] kommen deswegen keine vor.
.
Ihre Medusen übertreffen alles,
Was sonst von anderen Quallen[16] bekannt.
Schon die Metamorphose[17] des ganzen Polypen in das freischwebende Stadium
Lässt deutlich erkennen, eine Epyhra[18] würde stören, weil sowieso schon alles wie verzögert wirkt.
.
Zunächst aber will der Polyp sich gleichfalls vermehren,
Was allerdings ihm nur ungeschlechtlich[19] gelingt:
Eine oder ein paar Knospen nur bildet er seitlich,
Vertikal schnüren sie von der Wand sich ab,
Bilden bereits an der Mutter Tentakel,
Bewegen, wenn gelöst von ihr, langsam kriechend sich fort,
Strecken Tentakel nach vorne,
Zieh‘n vielleicht, was ungewiss, den Körper voran,
Muskelkontraktionen spielen bestimmt dabei eine Rolle,
.
Vollständig meist wandeln Polypen sich zu Medusen,
Gelegentlich bleibt ein Rest am Grund, der einmal zumindest sich regeneriert;
So erfolgt durch Polypen meist keine Vermehrung.
Als einmalige Strobilation[22] wird so der Medusen Entstehung interpretiert.
.
Nur wenige Millimeter misst die junge Meduse;
Auch wenn die erwachsene bis zu dreißig Centimeter erreicht.
.
Fußnoten
[1] Bilateria: Spiegelbildsymmetrische (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)
[2] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.
[3] Periderm: Epidermal gebildete Hülle von Polypen
[4] Epidermis: Außenschicht
[5] Mundkegel: Mundöffnung liegt nicht in der Ebene, sondern auf einer kegelförmigen Erhöhung
[6] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[7] Nesselzellen, Cnidocyten: Zellen in der Epidermis der Cnidaria, zum Beutefang und zur Abwehr dienend; bei Reizung wird ein Nesselschlauch ausgeschleudert, der häufig ein hochwirksames Gift in das Opfer injiziert
[8] Terminal: Am distalen, am entfernten Ende
[9] Stenotelen: Nesselkapseln mit stilett- oder skalpellartigen, leicht gekrümmten, messerscharfen, oft in zwei Etagen angeordneten Strukturen an der etwas verbreiterten Basis des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs
[10] Medusen, Quallen: Ein freischwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere
[11] Tetraradiär: Körper, dessen Strukturen nach vier Richtungen orientiert sind
[12] Scyphopolypen: Polypen nach der Klasse Scyphozoa benannt, um diese im Vergleich zu den etwas abweichend gestalteten Polypen anderer Klassen separat bezeichnen zu können
[13] Gastralsepten: Mesenterien
[14] Gastraltaschen: Taschenartige Strukturen, die durch Mesenterien abgetrennt sind
[15] Septalmuskeln: Muskeln, die in Septen (Mesenterien) ziehen
[16] Quallen: Schirm- oder glockenförmige Nesseltiere
[17] Metamorphose: Entwicklung von der Zygote zum geschlechtsreifen Tier über selbstständige Larvenstadien
[18] Ephyra: Larvenform bei Medusozoa; Scheibe mit kurzen, zweilappigen, flügelartigen Anhängen
[19] Ungeschlechtliche Fortpflanzung: Beruht grundsätzlich nur auf mitotisch entstandenen Zellen, Zellkomplexen, Gewebeteilen, Organen oder Jungorganismen
[20] Spanner: Geometridae (Macrolepidoptera – Ditrysia s.l. – Glossata – Lepidoptera – Amphiesmenoptera –…)
[21] Spannerraupenartige Bewegung: Spannerraupen besitzen am Vorderende echte Füßchen, am hinteren Stummelfüßchen; bewegen sie sich vorwärts, greifen die Vorderfüßchen weit aus, lösen die hinteren, führen diese nach vorne, um sich damit neu anzuheften und bilden dabei einen Katzenbuckel des unbefußten Zwischenaums, der vom zwischenzeitlichen geringen Abstand der beiden Füßchentypen herrührt.
[22] Strobilation (Medusenbildung): „Zapfenbildung“ im Zuge der Medusenentstehung bei Scyphozoa; seriale Anordnung der Ephyren erinnert an einen Zapfen (Strobus)
Eingestellt am 23. November 2024
.
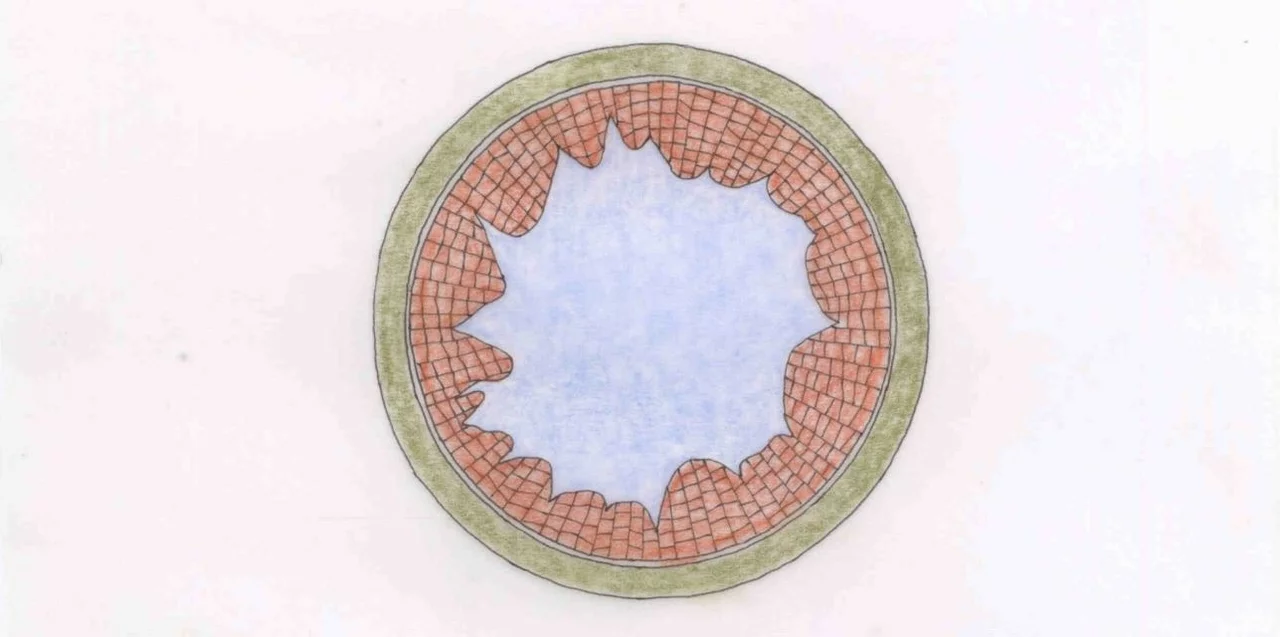
Querschnittschema des Polypen von Cubozoa (Tusche und Kreide; Reinhard Agerer)
Durch den Zentralmagen mit unregelmäßigen Längsfalten
Epidermis (grün), Mesogloea (grau), Gastrodermis (orange), Gastralraum (blau).
Nach Westheide & Rieger (2013), Seite 121, Abb. 188
Eingestellt am 23. November 2024
.

Cubozoa, Würfelquallen:
3 Die Metamorphose
.
In vier Quadranten teilen distal vier Längsfurchen zunächst den Polypen[1];
Waren anfangs Tentakel[2] kreisförmig geordnet, werden sie nun zu vier Gruppen zusammengefasst,
Tentakelbasen verwachsen zur Einheit, eingeschmolzen werden übrige Teile;
Vereinte Basen wandeln sich allmählich zu Rhopalien[3] um.
.
Vollkommen neu entstehen Tentakel dazwischen.
So verlässt der gewes’ne Polyp als Meduse[9]
Den Standort, schlüpft, falls vorhanden, aus des Polypen einstiger Hülle[10]
Und macht sich meist restlos davon.
.
Die Scheibe[13], mit der der Polyp einst festgeklebt,
Integriert sich in die Exumbrella[14] der Qualle;
Acht radiale Furchen weisen nicht selten die Schirme nun auf,
Warzen mit Nesselzellen[15] können die Exumbrella je nach Art belegen.
Senkrechte, wandparallele Septen trennen Außen- und Innenbereiche,
Doch eine verschließbare Öffnung stellt zum Zentralmagen eine Verbindung her;
Wachsen in die äußere Teilkammer dann und füllen sie aus.
.
Ein Ringkanal am Rand verbindet der Qualle Radialkanäle,
Von dem auch Kanäle in Tentakel, Rhopalien und Velarium[20] zieh‘n.
Ragen in den Gastralraum als Büschel hinein.
.
Fußnoten
[1] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.
[2] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[3] Rhopalium: Rand- oder Sinneskörper von Scyphozoa (Schirmquallen) und Cubozoa (Würfelquallen), Hydrozoa (Hydrentiere), die am Rand des Schirms dieser Nesseltiere zu finden sind. Sie haben die Form kleiner mit Entoderm ausgekleideter Tentakel oder Keulen, die der Oberseite des Schirms der Meduse entspringen durch einen Decklappen geschützt werden; sie gelten als Rückbildungen von Tentakeln. Als Sinneszellen sind Statocysten (Gleichgewichtsorgane) und Ocellen an den entodermalen Zellen der Keulenspitze ausgebildet.
[4] Mundkegel: Mundöffnung liegt nicht in der Ebene, sondern auf einer kegelförmigen Erhöhung
[5] Mundfeld, Mundscheibe: Bereich zwischen Mund und Tentakel
[6] Epidermis (allgemein): Außenschicht eines Tieres
[7] Quallen: Schirm- oder glockenförmige Nesseltiere
[8] Subumbrella: Konkave Unterseite einer Qualle
[9] Medusen, Quallen: Ein freischwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere
[10] Periderm: Epidermal gebildete Hülle der Polypen
[11] Manubrium: Lange Röhre als Fortsetzung des Magens und Träger des Munds
[12] Gemeint ist des Polypen langgezogener Mundkegel
[13] Fußscheibe, Fußplatte: Der flächig verbreiterte Anheftungsbereich des Fußes
[14] Exumbrella: Konvexe Oberseite einer Qualle
[15] Nesselzellen, Cnidocyten: Zellen in der Epidermis der Cnidaria, zum Beutefang und zur Abwehr dienend; bei Reizung wird ein Nesselschlauch ausgeschleudert, der häufig ein hochwirksames Gift in das Opfer injiziert
[16] Gastralraum: Großraum nahe des Osculums, des Mund-Afters, in den alle zuführenden engeren, dann weiteren, wasserführenden Kanäle oder Taschen münden
[17] Gastraltaschen: Taschenartige Strukturen, die durch Mesenterien abgetrennt sind
[18] Gastralsepten: Mesenterien
[19] Gonaden: Geschlechtszellen bildende Organe
[20] Velarium: Bildung der Subumbrella; ist von gastrovaskularen, also von entodermal ausgekleideten Kanälen durchzogen; unterscheidet sich damit grundlegend vom Velum der übrigen Medusoza, das lediglich aus einer Ektodermfalte unter Beteiligung der Mesogloea besteht
[21] Drüsenzellen: Zellen, die der Produktion und Abgabe (Sekretion) bestimmter Substanzen dienen
[22] Gastralfilamente: Wulste von Mesenterien, oft nur als Fäden an ihnen hängend
Eingestellt am 23. November 2024
.

Cubozoa, Würfelquallen:
4 Was noch dazugehört
.
Würfel- oder hochkant quaderförmig ist der Meduse[1] Schirm nun geworden.
An den vier gerundeten Ecken hängen ein bis drei
Des Gastralraums[5] Kanäle zieh‘n hinein.
.
Ein Velarium[6] verengt der Würfelqualle konkave Seite,
Das die Höhlung irisblendenartig[7] verschließt
Als Bildung der Subumbrella[8], ist somit durchzogen von gastrovaskularen Kanälen;
Zwischen Velarium und Epidermis[9] der Subumbrella liegt ein Nervenring,
Ergänzt in unmittelbarer Nähe durch einen breiten, kräftigen Ringmuskel,
Der wegen der Mächtigkeit zum Teil in des Schirmes Mesogloea[10] ragt.
.
Schnell und gewandt schwimmen Cubomedusen[11],
Nutzen dazu den Jet, wird durch des Schirms Ringmuskulatur
Und mit Velariums Hilfe Wasser aus dem Hohlraum getrieben,
Das mit des Vorhangs[12] asymmetrischer Kontraktion abgelenkt wird,
Worauf die Qualle[13] Schwimmrichtung und Höhenlage unmittelbar wechselt;
Als zusätzliche Steuer wirken, falls sie sich krümmen, Pedalia.
.
Hochmanövrierfähig können auch deshalb sie schwimmen,
Ist doch der Sinnesorgane Verbindung zum Nervensystem ausgesprochen kurz;
Auch die Ringmuskulatur liegt nahe des rundum führenden Nervenbündels.
Inwieweit ein diffuses Nervennetz mit diversen Ganglien[14] eine Rolle spielt,
Lässt sich des Nervenrings starker Wirkung wegen nicht eruieren.
Einige Arten kontrahieren den Schirm
Bis zu einhundertundfünfzig Mal pro Minute,
Kommen damit bis zu sechs Meter voran.
.
Überkörperlange, bis zu fünfzehn Tentakel – und dies vier Mal – hängen von den Pedalien.
Hohl, muskulös sind sie, dehnbar und stark kontraktil;
Nicht gleichmäßig ordnen sich die leicht schräg angebrachten Nesselzellen[15],
Sind vielmehr ringförmig oft versammelt, um die Tentakel an.
Umfassend ihre Cnidenpalette[16]:
.
Fußnoten
[1] Medusen, Quallen: Ein freischiwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere
[2] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[3] Tentakel
[4] Pedalien: Stark aufgetriebene, wasserkanalführende, dehn- und krümmbare, hochkontraktile basale Teile von Tentakeln oder Tentakelbüscheln
[5] Gastralraum: Großraum nahe des Osculums oder des Mund-Afters, in den alle zuführenden engeren, dann weiteren, wasserführenden Kanäle oder Taschen münden
[6] Velarium: Bildung der Subumbrella; ist von gastrovaskularen, also von entodermal ausgekleideten Kanälen durchzogen; unterscheidet sich damit grundlegend vom Velum der übrigen Medusoza, das lediglich aus einer Ektodermfalte unter Beteiligung der Mesogloea besteht
[7] Irisblende: Verstellbare Blende, deren Öffnung in der Größe kontinuierlich verändert werden kann
[8] Subumbrella: Konkave Unterseite einer Qualle
[9] Epidermis (allgemein): Außenschicht eines Tieres
[10] Mesogloea: Gallertartiges Gewebe bei Ctenophora (Rippenquallen) und Cnidaria (Nesseltieren), den Hohltieren, das den Zwischenraum zwischen der Gastrodermisschicht und der Epidermisschicht ausfüllt. Sie ist zunächst zellfrei, bei den meisten Gruppen wandern jedoch verschiedene Zellen in die Schicht ein. Es handelt sich dabei aber nicht um ein drittes Keimblatt, nicht um ein Mesoderm.
[11] Cubomedusen: Medusen nach der Klasse Cubozoa benannt, um diese im Vergleich zu den etwas abweichend gestalteten Quallen anderer Klassen separat bezeichnen zu können
[12] Velarium
[13] Quallen: Schirm- oder glockenförmige Nesseltiere
[14] Ganglion: Ansammlung von Nervenzellkörpern (Perikarya), aus der eine Verdickung des Nervenstrangs resultiert
[15] Nesselzellen, Cnidocyten: Zellen in der Epidermis der Cnidaria, zum Beutefang und zur Abwehr dienend; bei Reizung wird ein Nesselschlauch ausgeschleudert, der häufig ein hochwirksames Gift in das Opfer injiziert
[16] Cniden: Nesselkapseln
[17] Haploneme Anisorhize: Nesselkapseln mit schraubig gedrehtem Schlauch, auch nachdem sie explodiert ist; als Anisorhizen, ist eine Schraubung in diesem Zustand in Seitenansicht kaum mehr erkennbar; Haploneme Isorhize: Nesselkapseln mit schraubig gedrehtem Schlauch in der unentladenen Cnide; entladen ist der Schlauch gerade.
[18] Rhabdoiden, Mastigophoren: Nesselkapseln mit rundum etagiert angeordneten Mastigonemen in der unteren Hälfte des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs
[19] Eurythelen: Nesselkapselschlauch mit zwei unterschiedlichen Bereichen wenn explodiert: Basal mit kurzem, geradem Anteil, an dem weit spiralig ein Haarkranz emporläuft, an den sich ein engschraubiger Schlauch anschließt, dessen Schraubung in diesem Zustand in Seitenansicht kaum mehr erkennbar ist und in Spitzenansicht keine Höhlung erkennen lässt.
[20] Stenotelen: Nesselkapseln mit stilett- oder skalpellartigen, leicht gekrümmten, messerscharfen, oft in zwei Etagen angeordneten Strukturen an der etwas verbreiterten Basis des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs
Eingestellt am 23. November 2024
.

Tamoya ohboya
Autor: Ned DeLoach
Lizenz: public domain; unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
.
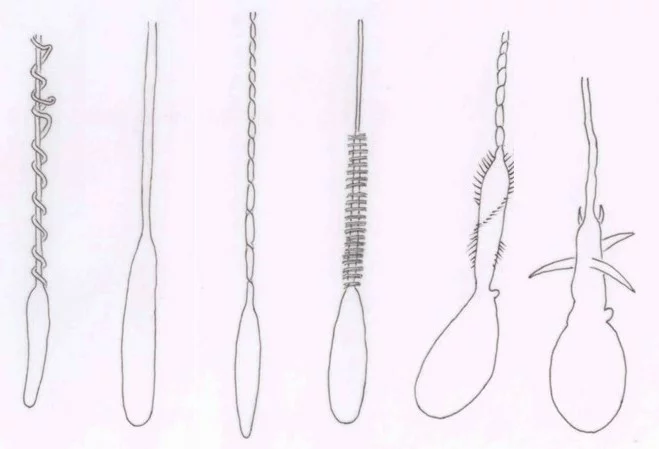
Cniden-Typen: Auswahl (Reinhard Agerer, Tusche)
Von links nach rechts:
Spirocyste, Klebkapsel: Der nach Explosion umgestülpte Schlauch ragt als gerades Stück aus der Cnide, dem, spiralig nach rückwärts wickelnd, sich sein erheblich längerer Teil anschließt und mit klebriger Masse umgeben ist; in der unentladenen Cnide, liegt der Schlauch schraubig um den geraden Teil
Haploneme Isorhize: Der nach Explosion umgestülpte Schlauch ragt als gerades Stück aus der Cnide; in der unentladenen Cnide liegt der Schlauch schraubig
Haploneme Anisorhize: Der nach Explosion umgestülpte Schlauch ragt enggeschraubt Stück aus der Cnide, in Seitenansicht ist die Schraubung kaum mehr erkennbar; in der unentladenen Cnide liegt der Schlauch schraubig
Rhaboide, Mastigophore: Nesselkapseln mit rundum etagiert angeordneten Mastigonemen in der unteren Hälfte des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs; in der unentladenen Cnide, liegt der Schlauch schraubig um den geraden Teil
Eurythele: Nesselkapselschlauch mit zwei unterschiedlichen Bereichen, wenn explodiert: Basal mit kurzem, geradem Anteil, an dem weit spiralig ein Haarkranz emporläuft, an den sich ein engschraubiger Schlauch anschließt, dessen Schraubung in diesem Zustand in Seitenansicht kaum mehr erkennbar ist; in der unentladenen Cnide, liegt der basal gegabelte Schlauch als Rolle
Stenothele: Nesselkapseln mit stilett- oder skalpellartigen, leicht gekrümmten, messerscharfen, oft in zwei Etagen angeordneten Strukturen an der etwas verbreiterten Basis des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs; in der unentladenen Cnide, liegt der basal ungegabelte Schlauch als Rolle
Zeichnung aus Westheide & Rieger, Seite 124, Abb. 193 (Auswahl)
Eingestellt am 23. November 2024
.
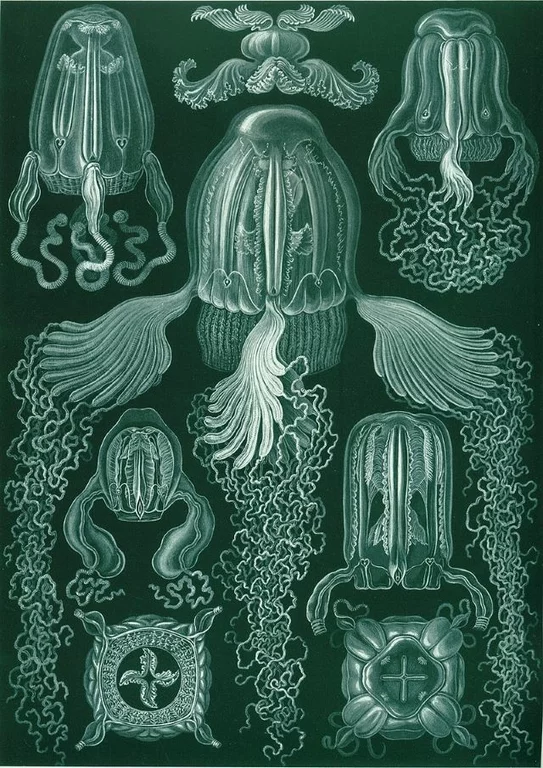
Cubomedusen
Autor: Ernst Haeckel
Lizenz: Public domain, unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
.

Cubozoa, Würfelquallen:
5 Sinnesorgane
.
Vier Rhopalien[1], die komplexesten aller Cnidarier,
Liegen in vier Vertiefungen der Exumbrella[2], überdeckt von einer Falte gleich einem Lid;
Der, von Sinneszellen umgeben, als Statolith[5] zum Feststellen der Senkrechten wirkt.
.
Der Schirmhöhle, also eher seitlich nach unten gerichtet, zugewandt,
Setzen sich aus zwei Gewebetypen zusammen,
.
Sechs Augen sitzen je Rhopalium zusammen:
Vier Pigmentaugen, je in einer Grube, auch Becheraugen[10] genannt,
Zwei davon mit schlitzförmiger, zwei mit runder Öffnung;
Erfassen vornehmlich Orientierung ankommenden Lichts.
Pigmentbecheraugen schirmen aus bestimmten
Richtungen eingehende Lichtstrahlen ab;
Damit lässt sich, aus weiter noch einfallenden Strahlen,
Näherungsweise bestimmen, woher die Helligkeit kommt.
.
Paarweise steh‘n Linsenaugen zusammen, eines hoch- und eines weniger hochentwickelt,
Die jeweils nach außen von einzellschichtiger Cornea[11] begrenzt;
Darunter liegt beim einfachen Linsenauge eine
Großzellige Linse, die von Plattenzellschichten[12] umhüllt,
In einen becherförmigen Glaskörper[13] ragend,
Licht gebündelt auf die Retina wirft.
.
Das höherentwickelte Linsenauge ist bedeutend stärker differenziert:
Eine azellulär[14] erscheinende Linse,
Die allein schon die Größe des anderen Auges erreicht,
Wird von noch dünneren, offensichtlich durchsichtigeren Plattenzellschichten umgeben,
Die einzellschichtige Linsenkapsel liegt unmittelbar dem Glaskörper auf,
Unmittelbaren Kontakt zur Retina hält.
.
So besitzen Würfelquallen ein Linsenauge,
Wie es in ähnlicher Weise auch bei höherentwickelten Bilateria[19] besteht.
.
Schwarz und Weiß, Hell und Dunkel, können die Augen erkennen:
In Laborversuchen wichen Würfelquallen geschickt schwarzen Plättchen aus,
Schwammen Richtung entzündetem Streichholz, in eineinhalb Meter Entfernung gehalten.
Warum sie positive Phototaxis[20] zeigen, ist ungewiss:
Womöglich erbeuten damit sie nachts leuchtende Beute[21]
Oder Beute, die Licht reflektiert.SL
.
Fußnoten
[1] Rhopalium: Rand- oder Sinneskörper von Scyphozoa (Schirmquallen) und Cubozoa (Würfelquallen), Hydrozoa (Hydrentiere), die am Rand des Schirms dieser Nesseltiere zu finden sind. Sie haben die Form kleiner mit Entoderm ausgekleideter Tentakel oder Keulen, die der Oberseite des Schirms der Meduse entspringen durch einen Decklappen geschützt werden; sie gelten als Rückbildungen von Tentakeln. Als Sinneszellen sind Statocysten (Gleichgewichtsorgane) und Ocellen an den entodermalen Zellen der Keulenspitze ausgebildet.
[2] Exumbrella: Konvexe Oberseite einer Qualle
[3] Calciumsulfathemihydrat: CaSO4 . ½ H2O; Calciumsulfat mit durchschnittlich einem Molekül Kristallwasser pro zwei Molekülen Calciumsulfat
[4] Konkrementkörper: Aus mehreren Teilen sekundär zusammengefasster Mineralienkörper
[5] Statolithen: Mikroskopisch kleine Körnchen aus kristallinem Calciumcarbonat [CaCO3], Calciumsulfat [CaSO4] oder Calciummagnesiumphosphat [Ca3Mg3(PO4)4], die die Wahrnehmung von Schwerkraft (und Beschleunigung) ermöglichen
[6] Becheraugen: Die Photorezeptoren befinden sich in einer becherförmigen Vertiefung, die Richtung, aus der das Licht einfällt, kann damit wahrgenommen werden.
[7] Linsenaugen: Augen mit meist linsenförmiger, glasklarer, lichtbündelnder Struktur, die eine lichtstarke und gleichzeitig scharfe Abbildung im Auge ermöglicht. In Abhängigkeit von Tierverwandtschaften können Linsenaugen hinsichtlich Funktionalität in unterschiedlicher Weise optimiert werden. Linsenaugen sind evolutiv mehrfach konvergent entstanden.
[8] Epidermis (Animalia, allgemein): Außenschicht eines Tieres
[9] Gastrodermis, Gastroderm: Epithel des Verdauungstraktes
[10] Pigmentbecheraugen, Pigmentbecherocellen: Bestehen meist aus 20 bis 30 Sehzellen (Fotorezeptoren), die in einer halbkreisförmigen Vertiefung angeordnet sind und in einem von lichtundurchlässigen Zellen (Pigmentzellen) ausgekleidetem Becher liegen. Je nach Richtung des einfallenden Lichtes werden daher nur wenige Fotorezeptoren angeregt, sodass es dem Organismus damit möglich ist, die Richtung des Lichtes wahrzunehmen.
[11] Cornea, Hornhaut des Auges: Stellt eine glasklare, gewölbte, schützende Schicht für den vorderen Teil des Auges dar und hilft zudem dabei, das Licht auf die Netzhaut im hinteren Teil des Auges zu bündeln.
[12] Plattenzellen: Zu dünnen Platten geformte Zellen
[13] Glaskörper: Der Glaskörper ist eine gelartige Substanz, die den größten Teil des Auges ausmacht. Er füllt den Raum zwischen Linse sowie Netzhaut und ist normalerweise klar und durchsichtig.
[14] Azellulär: Nicht aus Zellen bestehend (aber möglicherweise von Zellen geformt)
[15] Prismatisch: Körper mit zwei parallel verschobenen Vielecken; https://de.wikipedia.org/wiki/Prisma_(Geometrie), nähere Erklärung dort
[16] Pyramidal: Geometrischer Körper mit einem ebenen Vieleck als Grundfläche und einer entsprechenden Anzahl von gleichschenkligen Dreiecken als Seitenflächen, die in einer gemeinsamen Spitze enden
[17] Dendrite: Zellen mit astartigen Cytoplasmafortsätzen; bei Nervenzellen dienen sie der Aufnahme elektrischer Reize und ihrer Weiterleitung ins Innere der Zelle
[18] Neuropil: Nervengeflecht zwischen Zellkörpern
[19] Bilateria: Spiegelbildsymmetrische (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)
[20] Phototaxis: Bewegung bezogen auf Beleuchtungsstärke; positive Phototaxis bezeichnet die Bewegung hin zu größerer Helligkeit; negative die Bewegung weg von einer größeren Helligkeit.
[21] Biolumineszenz: Emission kalten, sichtbaren Lichts eines Lebewesens
SL Berger EW (1900) Physiology and histology of the Cubomedusae, including Dr. F.S. Conant’s notes on the physiology. Mem Biol Lab Johns Hopkins Univ 4: 1–84.
Eingestellt am 23. November 2024
.
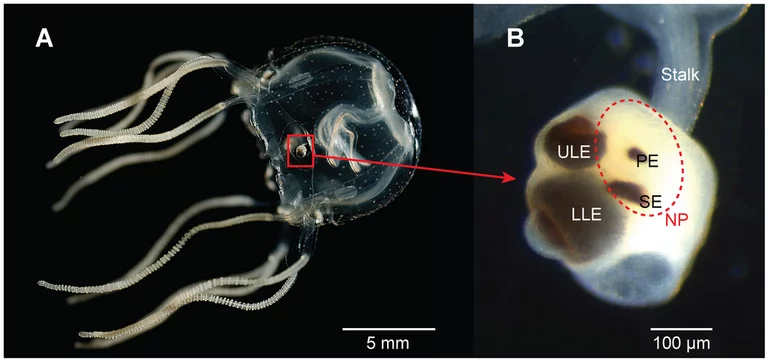
Visuelles System der Cubozoa
The visual system of the cubozoan Tripedalia cystophora (A) comprises four sensory structures called rhopalia (B). Each rhopalium carries six eyes of four morphological types (lower lens eye LLE, upper lens eye ULE, pit eye PE and slit eye SE) and a light sensitive neuropil (NP, red broken line). The eyes are responsible for the image formation in the animal and the light sensitive neuropil is thought to be involved in diurnal activity.
Autoren: Jan Bielecki, Alexander K. Zaharoff, Nicole Y. Leung, Anders Garm, Todd H. Oakley; DOI:10.1371/journal.pone.0098870
Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International; unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
.
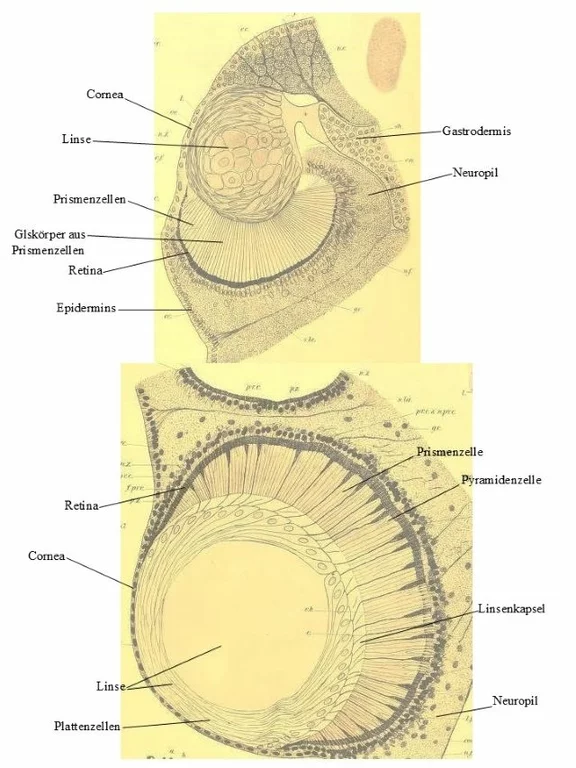
Augen der Cubozoa; dargestellt an Augen von Charybdea spp.
Nach: Berger, E.W., 1900. Physiology and histology of the Cubomedusae, including Dr. F.S. Conant’s notes on the physiology. Mem. Biol. Lab. Johns Hopkins Univ. 4, 1–84. Plate I (Ausschnitt), Plate II (Ausschnitt); Beschriftungen verdeutlicht hinzugefügt.
Lizenz: gemeinfrei; wegen Alter der Publikation. Entnommen: https://www.biodiversitylibrary.org/item/45281#page/9/mode/1up
Eingestellt am 23. November 2024
.

Cubozoa, Würfelquallen:
6 Der Qualle Fortpflanzung
.
Doch lassen Geschlechter äußerlich kaum sich trennen wegen der Durchsichtigkeit.
Je nach Art.
.
Experten haben von wenigen Arten nur Kenntnis über die Ontogenese[5]:
Total-äquale Furchung[6] kommt zumindest bei einigen vor,
Verlassen nicht viel später die Mutter,
Setzen, stark bewimpert, nach einigen Tagen sich fest,
Bilden als Polypen[11] anfangs lediglich zwei oder drei Tentakel,
Unterscheiden sich dadurch von Scyphopolypen[12], beginnen doch diese mit vier.
.
Entleert werden nahezu alle Gonaden[13],
Füllen mitunter für weitere Fortpflanzung sich erneut. –
.
Großflächige Schelfgebiete[16] bevorzugt,
Leben nur selten in kälteren Zonen.
Schwimmen mitunter in Häfen, Flussmündungen, mangrovenumstandenen[19] Inseln.
Polypen scheren generell sich wenig um der Gewässer Salzgehalt.
.
Eine Würfelqualle wurde aus dem mittleren Kambrium[20] beschrieben,
In Juraschichten[24] sind sie nicht selten.
Blicken somit zurück auf urlange Zeit der Evolution.
.
Fußnoten
[1] Getrenntgeschlechtlich: Weibliches und männliches Geschlecht sind auf zwei verschiedene Individuen verteilt
[2] Cubomedusen: Medusen nach der Klasse Cubozoa benannt, um diese im Vergleich zu den etwas abweichend gestalteten Quallen anderer Klassen separat bezeichnen zu können
[3] Äußere Befruchtung: Die Befruchtung der Eizelle erfolgt außerhalb des Körpers
[4] Innere Befruchtung: Die Befruchtung der Eizelle erfolgt innerhalb des Körpers
[5] Ontogenese (oft Ontogenie): Vorgang der Entwicklung des Individuums von der Zygote ab
[6] Total-äquale Furchung: Die Zygote und deren Abkömmlinge hin zur Blastula teilen sich vollkommen, und gleichzellig, es bleiben keine Partien ungeteilt; Teilungsweise dotterarmer Eier (Zygoten)
[7] Entoderm: Inneres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation nach innen gebrachte Zellschicht der Blastula
[8] Blastoderm: Begrenzende Zellschicht der Blastula
[9] Vivipar: Lebendgebärend; bereits entwickelte Larven, oder (junge) Adulte verlassen das Mutterzoon
[10] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria
[11] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.
[12] Scyphopolypen: Polypen nach der Klasse Scyphozoa benannt, um diese im Vergleich zu den etwas abweichend gestalteten Polypen anderer Klassen separat bezeichnen zu können
[13] Gonaden: Geschlechtszellen bildende Organe
[14] Tropen, tropisch: Klimazone zwischen Äquator und Wendekreisen
[15] Subtropen, subtropisch: Klimazone zwischen Wendekreisen und gemäßigtem Klima
[16] Schelf, Kontinentalschelf, Festlandsockel: Küstennahe, flache Meeresbereiche bis zu 200 m Tiefe.
[17] Fische: Teleostei i.e.S. (Actinopterygii – Osteognathostomata – Gnathostomata – Umericingulata – Lacertipinnatae –…)
[18] Krebstiere, Krebsartige: Crustacea (Tetraconata – Mandibulata – Arthropoda – Panarthropoda – Ecdysozoa –...)
[19] Mangroven: Mangrovenwälder bestehen aus Bäumen und Sträuchern verschiedener Pflanzenfamilien mit insgesamt fast 70 Arten, die sich an die Lebensbedingungen der Meeresküsten und brackiger Flussmündungen durch aus dem Wasser herausragende Wurzeln angepasst haben.
[20] Kambrium-Zeit: vor 542 – 488 Millionen Jahren
[21] Unterkarbon-, Mississisppian-Zeit: vor 359 – 318 Millionen Jahren
[22] Oberkarbon-, Pensylvanian-Zeit: vor 318 – 299 Millionen Jahren
[23] Tripedalia aptophora † (Cubozoa – Medusozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta –…)
[24] Jura-Zeit: vor ca. 201 – 145 Millionen Jahren
Eingestellt am 23. November 2024
.

Cystonectae, Schlauchschwimmer:
1 Die wohl ursprünglichsten ihrer Ordnung
.
Ihr Stamm, generell als Siphonophor[1] bezeichnet,
Dafür hält sie an der Wasserfläche
Oft ein hochdifferenzierter Pneumatophor[4].
.
Fußnoten
[1] Siphonophor: Zentraler Polyp, Stammpolyp, der Staatsquellen, an dem modifizierte Polypen und Medusoiden hängen
[2] Nectophoren: Schwimmglocken: Glockenartig umgewandelte, mit der Exumbrella am Zentralpolypen ansitzende, im Subumbrellarraum undifferenzierte, kontraktionsfähige Medusoide, die einen Polypenstock vorantreiben können
[3] Phyllozoide: Blattförmig umgebildete, nesselzellenversehene Polypen mit erkennbarem Hohlraum, am Zentralpolypen eines Polypenstocks sitzend, als Schutzorgan für darunterstehende Polypen und Gonozoide
[4] Pneumatophor: Luft-, Gasträger; Luftkissen
Eingestellt am 23. November 2024
.

Cystonectae, Schlauchschwimmer
2 Portugiesische Galeere
.
Ein dreieckig flächiger Pneumatophor[1] als Längskamm,
Prall mit Luft mitunter mit Kohlenmonoxid[2] zudem gefüllt,
Liegt in windstiller See.
Eine Brise kommt auf, richtet den Kamm zum Segel empor,
Stemmt sich dem Lufthauch entgegen –
Schaukelnd fährt die Galeere[3] dahin,
Benetzt sich beidseits immer wieder,
Nötig sonst trocknet es aus.
.
Dutzende langgezogene, spiralig gedrehte Tentakel[4]
Hängen ins Wasser Dutzende Meter tief,
Tragen pro Centimeter tausend Nesselzellen[5], kleine Fische zu töten;
Bringen Menschen brennende, mitunter gefährdende Pein.
Stabilisieren, luvseitig[6] befestigt, das segelnde Schiff, das
Reusengleich filternd, windgetrieben Meere durchzieht;
Steuern, manövrieren den Segler ein wenig,
Dass als Schutzgemeinschaft ihr Großverband möglichst zusammenbleibt.
.
Reihen sich dicht an dicht dem Siphonophor[10] entlang,
Fassen vereint auch größere Beute,
Ziehen Opfer, sie mehrfach fixierend, unaufhaltsam, sich verkürzend dabei, heran.
.
Der Wind legt sich.
Das Segel klatscht aufs Wasser zurück.
Die Fahrt ist beendet – macht nichts –
Denn für lange Zeit ist die Mannschaft versorgt. –
.
Physalia phyalis wird oft, trotz vieler Nesselzellen, als Beute betrachtet:
Auch kleinere Fische knabbern, unempfindlich gegen der Galeere Tentakel, an ihren feuernden Fäden.
Wird zu bunt es ihr, lässt sie sekundenschnell die Luft einfach aus: sinkt rasch tiefer hinab.
.
In dieser hochorganisierten Gemeinschaft
Ergänzen sich arbeitsteilig wirkende Glieder
Zum Wohl des gesamten Verbunds.
Könnte Physália phýsalis nicht Vorbild für manche Gemeinschaft sein?
.
Fußnoten
[1] Pneumatophor: Luft-, Gasträger; Luftkissen
[2] Kohlenmonoxid, CO: [C≡O]
[3] Portugiesische Galeere: Physalia physalis (Cystonectae – Siphonophorae – Leptolina – Hydrozoa – Medusozoa –…)
[4] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[5]Nesselzellen, Cnidocyten: Zellen in der Epidermis der Cnidaria, zum Beutefang und zur Abwehr dienend; bei Reizung wird ein Nesselschlauch ausgeschleudert, der häufig ein hochwirksames Gift in das Opfer injiziert
[6] Luvseite: Dem Wind zugewandte Seite
[7] Gonozoide: Träger von Gonophoren
[8] Luvseite: Dem Wind zugewandte Seite
[9] Verdauungspolypen: Dactylozoide der Staatsquallen
[10] Siphonophor (Staatsquallen, Cnidaria): Zentraler Polyp, Stammpolyp der Staatsquellen, an dem modifizierte Polypen und Medusoiden hängen
[11] Karettschildkröten; Caretta caretta (Cheloniidae – Cryptodira – Testudines – Anapsida – Sauropsida –…)
[12] Atlantische Blauschnecke: Glaucus atlanticus (Claucidae; nicht behandelt – Caenogastropoda – Gastropoda – Mollusca – Schizocoelia –…)
[13] Veilchenschnecken: Janthina janthina (Janthinidae; nicht behandelt – Caenogastropoda – Gastropoda – Mollusca – Schizocoelia –…)
[14] Mondfisch: Mola mola (Molidae – Tetraodontiformes – Percomorpha – Acanthopterygii – Acanthomorpha –…)
Eingestellt am 23. November 2024
.

Portugiesische Galeere, Physalia physalis
Duzende Tentakel sind hier verdrillt, ein freier, etwas länger ausgezogener Tentakel lässt sich am unteren Bildrand noch erkennen.
Autor: Image courtesy of Islands in the Sea 2002, NOAA/OER
Lizenz: Gemeinfrei; unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
.

Discomedusae, Scheibenquallen:
1 Die häufigsten Quallen
.
Vierkantig ausgezogen das Mundrohr[1],
Faltige, langgezogene Fahnen in entsprechender Zahl hängen recht oft daran;
Meterlang zieh’n sie meist hinterher.
Rückt sie vom Rand nah an den Mund.
.
Bilden dafür mitunter auch Podocysten[8].
.
Sehr unterschiedlich evolvierten sich Scheibenquallen:
Manchen fehlen Fangentakel am Rand;
Zudem verwächst früh ihre Mundöffnung;
So besteht nur aus Röhren ihr Manubrium[9], das,
In den zentralen Teil des Gastrovaskularsystems[10] mündend,
Nur über sekundär entstandene Poren mit der Außenwelt in Verbindung steht;
Meist sind sie von kleinen Tentakeln umstanden, bekommen Nahrungspartikel von Wimpern[11] zugewedelt;
Unverdaute Reste werden durch die Poren entsorgt.
Zierliche Fransen, Falten und Krausen
Umgeben den einstigen Mund.
.
Fußnoten
[1] Mundrohr: Die Mundöffnung ist auf das Ende einer langen Röhre der Subumbrella verlegt
[2] Rhopalium: Rand- oder Sinneskörper von Scophozoa (Schirmquallen) und Cubozoa (Würfelquallen), Hydrozoa (Hydrentiere), die am Rand des Schirms dieser Nesseltiere zu finden sind. Sie haben die Form kleiner mit Entoderm ausgekleideter Tentakel oder Keulen, die der Oberseite des Schirms der Meduse entspringen durch einen Decklappen geschützt werden; sie gelten als Rückbildungen von Tentakeln. Als Sinneszellen sind Statocysten (Gleichgewichtsorgane) und Ocellen an den entodermalen Zellen der Keulenspitze ausgebildet.
[3] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[4] Cyanidae: Blauquallen (Discomedusae – Scyphozoa – Medusozoa – Cnidaria – Amimalia –…)
[5] Tentakel
[6] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.
[7] Stolonial: An basalen hohlen Ausläufern
[8] Podocyste: Mit undifferenzierten Zellen gefüllte, mit chitinöser Hülle versehenes Überdauerungsstadium, aus der ein planulaähnliches Stadium schlüpfen kann
[9] Manubrium: Lange Röhre als Fortsetzung des Magens und Träger des Munds
[10] Gastrovaskularsystem: Verdaungsgefäßsystem
[11] Wimpern: Eukarya-Flagellen, -Geißeln, Cilien
Eingestellt am 23. November 2024
.

Discomedusae, Scheibenquallen:
2 Cyanea
.
Schmerzverzerrten Gesichts schwimmen mitunter badende Gäste
Schnellstmöglich der rettenden Nord- oder Ostseeküste zu.
Umschlingen Arme und Beine, rissen sich los vom flottierenden Schirm.
Grund war die Feuerqualle, Cyanea capillata[3],
Gelbe Haarqualle auch genannt.
.
Randtentakel fehlen der ganzen Familie,
Dafür haben sie acht Tentakelgruppen, die, an die Unterseite gerückt
– Mehr als einhundertundfünfzig steh‘n zum Bündel zusammen –
Gelegentlich bis zu dreißig, vierzig Metern strecken sich aus,
Zieh’n in Sekundenschnelle sich auf ein Zehntel zusammen,
Breiten sich, Beute zu fangen, wie ein Netz weit über den Rand hinaus,
Lassen mit gebreiteten Tentakeln
Sich langsam sinken Richtung Grund,
Bedecken lautlos, fangen mit Nesselkapseln,
Was arglos sich darunter befand:
Was immer sich verfängt darin, kommt nicht mehr los.
.
So leben die Feuerquallen!
Treiben, von Badenden so gesehen, ihr Unwesen küstennah;
Berühren Schwimmer ihre agressiv nesselnden Arme,
Gilt es, sofort zu verlassen des Unfalls Ort, denn
Oft hängen Tentakelreste noch an Armen und Beinen,
Deren Nesselkapseln womöglich erst zu zwanzig Prozent explodiert.
.
Brennende Schmerzen und Striemen, Verbrennungen ähnlich,
Rufen die Gifte hervor, mitunter allergische Reaktion,
Die einen Schock gelegentlich bringen;
So ist Verlassen des Wassers unbedingt angezeigt.
.
Abreiben der Haut lässt restliche Nesselzellen explodieren!
Mit Essigwasser zu spülen sei aber Mittel der Wahl;
Und Schmerzmittel reichen, wie Brandwunden diese Irritationen behandeln
Käme am besten Schmerzen und Hautvergiftungen bei.
.
Wären Löwenmähnenquallen nicht so sehr giftig,
Wären sie, nah betrachtet, ihrer Farbenpracht wegen bewundernswert:
Mundarme[6] purpurfaben, Tentakel gelb vor allem, doch auch rötlich,
Woher der Bezug zu den bekannten Steppenbewohnern kommt;
Hellrosa bis rotgelb, auch bauviolett getönt ihre Haube,
Die dreißig Centimeter Durchmesser oft erreicht. –
.
In der Arktis hingegen
– Glücklicherweise schwimmt niemand dort –
Erreicht die Löwenmähne zwei Meter:
Wer unter die fünfhundert Quadratmeter deckende Fangarme käme, dem winkte der Tod. –
.
Ihre nahe Verwandte, die Blaue Qualle[7],
Wegen der Farbe auch Kornblumenqualle genannt,
Kann gleichfalls mit Fangarmen quälend nesseln,
Doch wer das leuchtende Blau erspäht, ist gewarnt, hält gehörigen Abstand daher.
.
Fußnoten
[1] Nesselkapseln: In Nesselzellen gebildete, kapselartige Gebilde, die bei Reizung der Nesselzellen ihr schlauchartiges Fangorgan hervorschleudern
[2] Tentakel (Nesseltiere): Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[3] Cyanea capillata: Feuerqualle, Gelbe Haarqualle, Löwenmähnenqualle (Cyanidae; nicht behandelt – Discomedusae – Scyphozoa – Medusozoa – Cnidaria –…)
[4] Garnelen: Die Bezeichnung fasst in einer Gruppe als nicht direkt miteinander verwandte Krebstiere zusammen
[5] Krustentiere: Crustacea (Tetraconata – Mandibulata – Arthropoda – Panarthropoda – Ecdysozoa –…)
[6] Mundarme, Mundtentakel, Mundfahnen, Mundlappen (Quallen): Cnidocytentragende unregelmäßig geformte, unmittelbar dem Mundrand, am Ende des Mundrohrs (Manubrium) entspringende Auswüchse
[7] Blaue Qualle, Kornblumenqualle: Cyanea lamarckii (Cyanidae; nicht behandelt – Discomedusae – Scyphozoa – Medusozoa – Cnidaria –…)
Eingestellt am 23. November 2024
.

Oben: Cyanea capillata, Feuerqualle, Gelbe Haarqualle, Löwenmähnenqualle
Autor: Wusel007
Lizenz: GNU Free Documentation License; unverändert
Unten: Cyanea capillata, Feuerqualle, Gelbe Haarqualle, Löwenmähnenqualle
Autr: Arnstein Rønning
Lizenz: Creative Commons Attribution 3.0 Unported license; unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
.

Discomedusae, Scheibenquallen:
3 Die Leuchtende
.
Stark nesselnd, doch etwas weniger irritierend als Haarquallen[1],
Begegnet Pelagia noctiluca[2] uns im Mittelmeer:
Durchschlägt die Haut mit Nesselkapseln[3],
Verursacht ein Brennen doppelt so stark wie der Brennessel[4] Gift,
Um Blasen danach aufzuwerfen, die
Brandblasen nicht unähnlich sind.
.
Hübsch auch diese Qualle[5] als Glocke oder als Hemisphäre,
Höchstens handtellergroß ihr Schirm,
Blasspink oder malvenfarben[6] bis bläulich,
Intensiver gefärbt die Warzen darauf
Mit dichtgedrängten Cnidocyten[7] versehen,
Sich oben zu wehren, fasst jemand von dort sie an.
.
Zwischen sechzehn Randlappen[8] sitzen
Mit denen Nahrung sie fangen; außen hübsch gekraust.
.
Werden elektrisch sie gereizt, oder stark erschüttert,
Leuchten sie bläulich, je stärker die Reize, umso mehr.
Leben in Schwärmen, die mehrere Kilometer oft lang,
Brechen in Aquakulturen gelegentlich ein, fressen, was nur möglich, darin;
Auch größere Fische, wie Lachse[13], verletzen, töten sie ohne Gewissen,
Doch zu groß ist ihnen die Beute, lassen sie unverzehrt.
.
Ihre riesigen Wanderzüge lassen sich fortpflanzungsbiologisch begründen:
Danach vermehren als Quallen sie der Wanderzüge Glieder;
Weil keine Polypen sie bilden, erfolgt Vermehrung auf Hochsee,
Brauchen damit keinen festen Ort für den Entwicklungskreislauf;
Wandern nahe der Oberfläche, sinken auf zwanzig Meter höchstens hinab.
.
Fußnoten
[1] Haarquallen: Cyanea spp. (Cyanidae; nicht behandelt – Discomedusae – Scyphozoa – Medusozoa – Cnidaria –…)
[2] Pelagia noctiluca: Leuchtqualle (Pelagiidae; nicht behandelt – Discomedusae – Scyphozoa – Medusozoa – Cnidaria –…)
[3] Nesselkapseln: In Nesselzellen gebildete, kapselartige Gebilde, die bei Reizung der Nesselzellen ihr schlauchartiges Fangorgan hervorschleudern
[4] Brennessel: Urtica spp. (Urticaceae – Rosales - ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae – Rosidae –…)
[5] Quallen: Schirm- oder glockenförmige Nesseltiere
[6] Malven: Malva spp. (Malvaceae – Malvales – Malvanae – Rosidae – Superrosidae –…)
[7] Cnidocyten: Nesselkapseln bildende Zellen
[8] Randlappen: Vorhangartig herabhängende Lappen am unmittelbaren Schirmrand, im Kontaktbereich von Ex- und Subumbrella
[9] Rhopalium: Rand- oder Sinneskörper von Scophozoa (Schirmquallen) und Cubozoa (Würfelquallen), Hydrozoa (Hydrentiere), die am Rand des Schirms dieser Nesseltiere zu finden sind. Sie haben die Form kleiner mit Entoderm ausgekleideter Tentakel oder Keulen, die der Oberseite des Schirms der Meduse entspringen durch einen Decklappen geschützt werden; sie gelten als Rückbildungen von Tentakeln. Als Sinneszellen sind Statocysten (Gleichgewichtsorgane) und Ocellen an den entodermalen Zellen der Keulenspitze ausgebildet.
[10] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[11] Mundtentakel, Mundarme: Cnidocytentragende unregelmäßig geformte, unmittelbar dem Mundrand, am Ende des Mundrohrs (Manubrium) entspringende Auswüchse
[12] Mund-After-Öffnung: Körperöffnung, die zugleich als Mund und After verwendet wird
[13] Atlantischer Lachs: Salmo salar (Salmonidae – Salmoniformes – Protacanthopterygii – Euteleostei – Clupeocephala –…)
[14] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria
[15] Ephyra: Larvenform bei Medusozoa; Scheibe mit kurzen, zweilappigen, flügelartigen Anhängen
Eingestellt am 23. November 2024
.

Pelagia noctiluca, Leuchtqualle
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pelagia_noctiluca_(Sardinia).jpg
Autor: Hans Hillewaert
Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
.

Discomedusae, Scheibenquallen:
4 Kompassqualle
.
Wie eine Kompassrose[1] erscheint die Zeichnung,
Betrachtet man von oben den Schirm;
Gelbbraune, orange, rote oder dunkelbraune Bänder
Vermitteln das namengebende Bild[2].
.
Ansonsten zeigt sich der flache Schirm recht zurückhaltend in
Farblos, Weißlich, Gelblichweiß, Orange oder Braun;
Zweiunddreißig bis achtundvierzig Lappen[3], dazwischen mit
Vierundzwanzig ziemlich kräftigen, langen Tentakeln[4] verseh’n;
Vier auffällige, faltig-wellige Mundarme[5], V-förmig im Querschnitt,
Hängen noch weiter als die Randtentakel herab.
.
Chrysaoren leben als Zwitter[6]
Meist proterandrisch[7], beginnend mit Männchenfunktion,
Im Übergang wirken beide Geschlechter gleichzeitig,
Beiderlei Gonaden[8] werden zugleich dann reif,
Bis am Ende sie ausschließlich mütterlich und
Planulalarven[9] entstehen, die anfangs noch von der Mutter geschützt.
.
Dem normalen Generationswechsel folgend[10],
Setzen sie als Polypen[11] sich fest,
Bilden gestapelt nacheinander Ephyren[12],
Die später als Medusen in Scharen Mittelmeer,
Nordsee, auch den Atlantik in
Grilltellergröße durchzieh’n.
.
Fußnoten
[1] Kompassrose: Vielstrahlige Windrose (Himmelsrichtungen anzeigend) auf einem Kompass
[2] Kompassqualle: Chrysaora hysoscella (Semaeostomidae; nicht behandelt – Discomedusae – Scyphozoa – Medusozoa – Cnidaria –…)
[3] Randlappen: Vorhangartig herabhängende Lappen am unmittelbaren Schirmrand, im Kontaktbereich von Ex- und Subumbrella
[4] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[5] Mundarme, Mundtentakel, Mundfahnen, Mundlappen (Quallen): Cnidocytentragende unregelmäßig geformte, unmittelbar dem Mundrand, am Ende des Mundrohrs (Manubrium) entspringende Auswüchse
[6] Zwitter: Weibliche und männliche Gameten befinden sich auf ein und demselben Individuum, müssen aber nicht zur gleichen Zeit zur Reife kommen
[7] Prot(er)andrisch: Vormännlich; zunächst werden die männlichen Gameten reif, dann erst die weiblichen, um Eigenbefruchtung zu verhindern
[8] Gonaden: Geschlechtszellen bildende Organe
[9] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria
[10] Auch als Metagenese bezeichnet
[11] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.
[12] Ephyra: Larvenform bei Medusozoa; Scheibe mit kurzen, zweilappigen, flügelartigen Anhängen
Eingestellt am 23. November 2024
.

Kompassqualle, Chrysaora hysoscella
Autor: Francesco Crippa
Lizenz: Creative Commons Attribution 2.0 Generic license; unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
.

Discomedusa, Scheibenquallen:
5 Ohrenqualle
.
Ihre acht sind zu vier Paaren zusammengerückt,
Zeigen für manche Betrachter die Form von Ohren,
Andere erinnern sie an Hufeisen nur;
Erscheinen violett bei Weibchen
Bei Männchen aber weiß bis rotorange.
.
Für nordatlantische Populationen zumindest wurde ihr Fortpflanzungsverhalten beobachtet
– Doch kommen Ohrenquallen weltweit vom siebzigsten Breitengrad Nord bis zum fünfundfünfzigsten südlich vor. –
Im Frühsommer kommen an Schottlands Westküste geschlechtsreife Medusen,
Männchen geben Spermatozoen[3] alsdann ins Meer.
Freie Planulalarven[4] finden sich
Ende Juni zwischen den Mundfahnen[5] der Weibchen;
Anfang August bedecken massenhaft
Bilden Epyhra-Larven[8] von November bis Ende Januar en masse.
.
Schwimmen Ephyralarven und junge Quallen[9] im Wasser,
Endet der Quallen Fortpflanzungszeit mit Tod;
Ende Februar bereits verschwinden auch die Polypen;
Viereinhalb Monate vielleicht scheint damit der Ohrenquallen Lebensdauer zu sein. –
.
Flachgewölbt nur zeigt sich Aurelia aurita,
Gleicht eher größerem Teller, den jemand umgedreht,
Und farblos-durchsichtig, nur Gonaden lassen sich darin erkennen;
Fransig wirkt der Qualle Rand, der dicht von kurzen, für Menschen harmlosen Tentakeln[10] besetzt;
Vorhangartige Lappen[11] lassen sich nicht erkennen, weil nicht vorhanden,
Mundarme dagegen wirken gut ausgebildet und kräftig gefärbt.
.
Für kleinerer Beute Erwerb verwenden sie
Tentakel nur zum geringeren Teil;
Als Hauptfangapparate wirken des ganzen Körpers bewimperte Zellen:
Sie bewegen in Schleim eingehüllte Partikel zum Rand des Schirms,
Werden in Gruben dort zwischengelagert,
Bis Mundarme sie holen, zum Mund sie führ’n.
.
Neben Kleinpartikeln, sechs Millimeter, aber nicht größer,
Nehmen sie kleinere Fische ebenfalls an,
Von zehn Centimeter Größe waren sie im Magen zu finden.
Fingen und brachten Mundarme sie zum Mund?
.
Fußnoten
[1] Ohrenqualle: Aurelia aurita (Ulmariidae; nicht behandelt – Discomedusae – Scyphozoa – Medusozoa – Cnidaria –…)
[2] Gonaden: Geschlechtszellen bildende Organe
[3] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Gameten, reife, haploide Keimzellen, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind
[4] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria
[5] Mundarme, Mundtentakel, Mundfahnen, Mundlappen (Quallen): Cnidocytentragende unregelmäßig geformte, unmittelbar dem Mundrand, am Ende des Mundrohrs (Manubrium) entspringende Auswüchse
[6] Scyphopolypen: Polypen nach der Klasse Scyphozoa benannt, um diese im Vergleich zu den etwas abweichend gestalteten Polypen anderer Klassen separat bezeichnen zu können
[7] Laminaria spp.: Zuckertang (Laminariales – Phaeophyceae – Chromophyta – Straminipila – “Wimpeola” –…)
[8] Ephyra: Larvenform bei Medusozoa; Scheibe mit kurzen, zweilappigen, flügelartigen Anhängen
[9] Quallen: Schirm- oder glockenförmige Nesseltiere
[10] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[11] Randlappen: Vorhangartig herabhängende Lappen am unmittelbaren Schirmrand, im Kontaktbereich von Ex- und Subumbrella
Eingestellt am 24. November 2024
.

Ohrenqualle, Aurelia aurita
Autor: Julian Fahrbach
Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license; unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
.

Discomedusae, Scheibenquallen:
6 Mangrovenquallen (TP)
.
Liegen zu Tausenden auf schlammigem Grund!
Ja liegen! Richtig gelesen!
Saugen sich fest, damit sie nicht Strömung verschwemmt.
.
Nicht mit Mundrohr[4] nach unten,
Wo denkst du hin?!
Auf den Rücken dreht sich Cassiopea[5],
Liegt dort auf einer Delle recht gut.
Macht es sich leicht, sich festzusetzen,
Hebt den Hohlraum nur etwas an, schon hält der Dellenrand dicht.
.
Nicht schon immer liegt sie bequem auf dem Boden.
Und als Jungqualle bis zu zwei Centimeter Durchmesser
Schwebt sie, mehr als sie schwimmt, herum.
Nur die Mundarme[10] helfen ihr. –
.
Auch wenn sie bequem am Boden, scheint es mitunter ihr nötig,
Den Ort zu wechseln aus unbekanntem Grund,
– Fühlt sich erheblich gestört vielleicht durch irgendetwas –
Löst den Saugnapf, hebt ab,
Schwimmt wenig nur weiter, legt sich,
Den Saugnapf umgehend hochziehend,
Sofort wieder hin.
.
Gekrauste, feinverästelte Mundarme legt sie
Schräg-flach, einem Stern fast gleich,
Mit nesselzellbestückten[11] Zweigbüscheln
Nach oben, ausgestreckt gegen des Schirmes Rand,
Der, sauerstoffhaltiges Wasser und Plankton[12] heranzubefördern,
Bis zu zwanzig Mal in der Minute sich zusammenzieht und wieder dehnt.
.
Wohl in Schleimballen verpackt, werden die Fänge
Irgendwie zum Mund transportiert.
Doch lässt sich der Hunger damit wohl nicht vollkommen stillen,
Denn als eine der wenigen Quallen setzt sie auf der Zooxanthellen[13] Werk.
.
Doch damit noch nicht genug! An Nahrung zu kommen,
Schickt sie Kügelchen los, Opfer zu treffen, damit sie getötet sinken herab.
.
– Lange schon klagten Schnorchler und Schwimmer,
Die in Mangrovenzonen des Öftern unterwegs,
Über stechendes Gefühl an freiliegenden Stellen,
Obwohl sie mit wirbellosen Tieren nie,
Auch mit Quallen[14] nicht, in Kontakt gekommen sind.
Mehr als ein lästiges Jucken, ein leichtes Brennen, war es jedoch nicht. –
Forscher kamen erst vor wenigen Jahren
Diesem Phänomen auf die Spur:
.
An hervorgehobenen, etwas aufgeblähten Stellen der Mundarmkrausen
Bilden sich Kügelchen, schnüren sich ab!
Und – überraschend für die Experten –
Schlossen Zooxanthellen ebenfalls ein.
.
Stießen mit Krebschen[20] im Versuch sie zusammen,
Waren die Opfer umgehend tot, weiter aber schwamm das Projektil.
Erfolgen Zusammenstöße über der Qualle,
Sinkt die Beute womöglich auf die gebreiteten Arme herab.
.
Was der Zooxanthellen Aufgabe in den Cassiosomen[21],
Darüber rätselt die Wissenschaft heute noch.
Liefern Energie sie für der Projektile Reise,
Dienen der asexuellen Vermehrung der Qualle sie?
Setzen sie sich irgendwo nieder, Polypen zu werden?
Entstehen Quallen aus ihnen sogar?SL
.
Fußnoten
[1] Mangroven: Mangrovenwälder bestehen aus Bäumen und Sträuchern verschiedener Pflanzenfamilien mit insgesamt fast 70 Arten, die sich an die Lebensbedingungen der Meeresküsten und brackiger Flussmündungen durch aus dem Wasser herausragende Wurzeln angepasst haben.
[2] Mangrovenzone: Gezeitenbereiche vorwiegend tropischer Küsten mit Wassertemperaturen über 20oC
[3] Tropen, tropisch: Klimazone zwischen Äquator und Wendekreisen
[4] Mundrohr: Die Mundöffnung ist auf das Ende einer langen Röhre der Subumbrella verlegt
[5] Mangrovenqualle: Cassiopea xamachana (Cassiopeidae; nicht behandelt – Discomedusae – Scyphozoa – Medusozoa – Cnidaria –…)
[6] Ephyra: Larvenform bei Medusozoa; Scheibe mit kurzen, zweilappigen, flügelartigen Anhängen
[7] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.
[8] Randlappen: Vorhangartig herabhängende Lappen am unmittelbaren Schirmrand, im Kontaktbereich von Ex- und Subumbrella
[9] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[10] Mundarme, Mundtentakel, Mundfahnen, Mundlappen: Cnidocytentragende unregelmäßig geformte, unmittelbar dem Mundrand, am Ende des Mundrohrs (Manubrium) entspringende Auswüchse
[11] Nesselzellen, Cnidocyten: Zellen in der Epidermis der Cnidaria, zum Beutefang und zur Abwehr dienend; bei Reizung wird ein Nesselschlauch ausgeschleudert, der häufig ein hochwirksames Gift in das Opfer injiziert
[12] Plankton: Gesamtheit der im Wasser freischwebenden oder mit geringer Eigenbeweglichkeit schwimmende, kleinere Organismen, deren Ortswechsel hauptsächlich durch Wasserströmungen vermittelt wird
[13] Zooxanthellen: Endosymbionten in einer Reihe von Lebewesen. Bei den Zooxanthellen handelt es sich meistens um Dinoflagellaten; aber auch um Chrysomonden, Cryptomonaden oder Diatomeen kommen vor
[14] Quallen: Schirm- oder glockenförmige Nesseltiere
[15] Ektoderm: Äußeres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation außen verbliebene Zellschicht der Blastula
[16] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle
Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.
[17] Cnidocyten: Nesselkapseln bildende Zellen
[18] Amoebocyten: Sich amöbenartig bewegende Zellen
[19] Mesogloea: Gallertartiges Gewebe bei Ctenophora (Rippenquallen) und Cnidaria (Nesseltieren), den Hohltieren, das den Zwischenraum zwischen der Gastrodermisschicht und der Epidermisschicht außen füllt. Sie ist zunächst zellfrei, bei den meisten Gruppen wandern jedoch verschiedene Zellen in die Schicht ein. Es handelt sich dabei aber nicht um ein drittes Keimblatt, nicht um ein Mesoderm.
[20] Krebstiere, Krebsartige: Crustacea (Tetraconata – Mandibulata – Arthropoda – Panarthropoda – Ecdysozoa ... –)
[21] Cassiosomen (Mangrovenquallen): Von geißeltragendem Ektoderm und von Cnidocyten umgebene, von Mundarmen abgegebene, frei flottierende, Zooxanthellen und Amoebocyten beinhaltende winzige Gallertkügelchen, die dem Beuteerwerb dienen
SL Ames CL, Klompen AML, Badhiwala K, Muffett K, Reft AJ, Kumar M, Janssen JD, Schultzhaus JN, Field LD, Muroski ME, Bezio N, Robinson JT, Leary DH, Cartwright P, Collins AG, Vora GJ (2020) Cassiosomes are stinging-cell structures in the mucus oft the upside-down jellyfish Cassiopea xamachana. Nature Communic Biol 3(67): 1-15.
Eingestellt am 23. November 2024
.

Mangrovenqualle, Cassiopea xamachana
Autor: Marco Almbauer
Lizenz: public domain; unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
.

Discomedusae, Scheibenquallen:
7 Blumenkohlquallen
.
Gehörig hat sich Ephyra[1] zu wandeln,
Bis als ausgewachs‘ne Qualle[2] sie schwimmt:
Ihre Mundpartie stellt sie vor größte Probleme,
Bis ihre Mundlappen[3] arbeitsbereit, mit Krausen verziert:
.
Zuerst legen sich der Mundlappen vier freie Kanten aneinander,
Verwachsen und gabeln sich wiederholt;
Verschmelzen miteinander, auch durch Querverbindungen,
Wodurch allmählich zwei Krausen geformt.
.
Am kurzgehalt‘nen Manubrium[4] entsteht eine Schulterepaulette,
Ein Stück darunter bleibt frei,
Bis ein Mundkranz, umfangreicher etwas, größer und auffälliger
Nach unten zu folgt, dem sich acht
Zunächst verwachsene Arme anschließen,
Nur die Endkolben bleiben ein stückweit frei.
.
Epaulette[5], das Schulterstück, und die Mundkrause,
Sind derart gebuchtet, dicht gezähnt,
Können Betrachtern so den Eindruck vermitteln,
Zwei Blumenkohlrosen wären übereinander um dickeren,
furchigen Strunk gruppiert.
.
Einer Lampe ähnelt Rhizostoma octopus[6],
Schwimmt sie so frei im Meer, doch hängt der Lampenstiel frei,
Während der weiß- bis cremefarbene Schirm wie ein hochgewölbter Pilzhut das
Kunstwerk in schwerelos scheinender Schwebe hält.
Kunstvoll ist auch der Rand gestaltet:
Sechsundneunzig kleine Läppchen[7] hängen dort in Kobaltblau bis violett;
Keine Tentakel[8] sind hier zu finden,
Doch Nesselzellen[9] liegen über den ganzen Schirm verstreut.
.
Eine zweite Zierde hübscht die Qualle: blaue Gonaden der Männchen;
Weibchen heben sie Gelb über Braun bis Rot hervor.
.
Keine Mundöffnung ist der Qualle gegeben,
Auch den zentralen Magenraum sparte sie ein.
Für Ersatz sorgen sechzehn Radialkanäle,
Die peripher ihr Ende finden im Ringkanal.
.
Feine Poren verbinden diese verzweigten Kanäle mit der Umgebung,
Die in der Schulterkrause erheblich gehäuft,
Dorthin sollen passende Planktonwesen gelangen,
Größeres aber hätte, hätte, der verlorengegangene Mund nur gefasst.
.
Doch wie kommt die Qualle zur gefangenen Nahrung?
Schnell kann sie schwimmen, verengt dafür den Lampenschirmraum;
Schon durch diese Bewegung trifft Plankton[10] auf Hut und Krause,
Cilien[11] wohl strudeln, was kommt, in die Poren hinein.
.
Fußnoten
[1] Ephyra: Larvenform bei Medusozoa; Scheibe mit kurzen, zweilappigen, flügelartigen Anhängen
[2] Quallen: Schirm- oder glockenförmige Nesseltiere
[3] Mundarme, Mundtentakel, Mundfahnen, Mundlappen (Quallen): Cnidocytentragende unregelmäßig geformte, unmittelbar dem Mundrand, am Ende des Mundrohrs (Manubrium) entspringende Auswüchse
[4] Manubrium: Lange Röhre als Fortsetzung des Magens und Träger des Munds
[5] Epaulette: Schulterklappe
[6] Blumenkohlquallen: Rhizstoma octopus (Rhizostomidae; nicht behandelt – Discomedusae – Scyphomedusae – Medusozoa – Cnidaria –…)
[7] Randlappen: Vorhangartig herabhängende Lappen am unmittelbaren Schirmrand, im Kontaktbereich von Ex- und Subumbrella
[8] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[9] Nesselzellen, Cnidocyten: Zellen in der Epidermis der Cnidaria, zum Beutefang und zur Abwehr dienend; bei Reizung wird ein Nesselschlauch ausgeschleudert, der häufig ein hochwirksames Gift in das Opfer injiziert
[10] Plankton: Gesamtheit der im Wasser freischwebenden oder mit geringer Eigenbeweglichkeit schwimmende, kleinere Organismen, deren Ortswechsel hauptsächlich durch Wasserströmungen vermittelt wird
[11] Cilie, Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.
Eingestellt am 23. November 2024
.

Wurzelmundqualle, Rhizostoma pulmo
Schulterkrause verdeckt
Autor: MarkusGarger
Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
.
