4.2 Cnidaria Texte A-R

Cnidaria, Nesseltiere:
1 Giftschleudern (HP)
.
Tief verborgen in der Zelle, dicht umhüllt vom Dictyosom[1],
Belebt die winzige Cisterne[2], ständig sich vergrößernd,
Vom Schirm der Mikrotubuli[3] zur Birngestalt geformt,
Den Park der Organellen[4] mit evolutionärer Rarität.
.
Zum dünnen Fortsatz wächst der Birne Beule,
Nicht fest, nicht voll,
Ein hohler Schlauch wird bald der kollagenverstärkten[5] Kapsel
Stark verjüngtes Ende zieren.
.
Kein Ende ist des Schlauches Wachstum noch geboten:
Verlängert sich spiralig in der Zelle,
Umwindet innen eng der Zelle äußere Membran.
Der Platz wird knapp, der Druck der Zelle wirkt nun formverändernd:
So stülpt der Schlauch sich handschuhfingerförmig in die Kapsel ein.
Warum von jeglicher Struktur des Schlauches Hohlraum frei belassen?
.
Strukturlos ja, doch leer noch lange nicht!
Cisternen sezernieren unentwegt,
Nesselartig reizende, neurotoxische Substanzen[6] in das Innere des Schlauchs.
Bald wird der Zelle Innendruck zu hoch.
.
Die Zelle birst, sie hält dem Druck nicht stand.
Der Schlauch entrollt sich explosiv, stülpt dabei sich um!
Öffnet sich am Spitzenende, seine Grenze gar durchschlagend,
Heftet klebrig haftend, sich dem ahnungslosen Opfer an.
.
Festgezurrt, durch Nervengifte schnell gelähmt,
Wird es so zur Beute!
Gift aus Schläuchen schleudern
Wird zum unbestrittenen Erfolgsmodell.
.
Die Nesselkapsel ist geboren, gut getarnt und wohlverborgen.
Anlasslos zuerst explodieren oft die giftbewehrten Katapulte.
Doch ein frei nach außen orientierter Stift, von der Zelle Geißel[7] wohlgeformt,
Löst, wenn unsanft er berührt, im nächsten evolutionären Schritt die Schleudern aus.
.
Die Kapseln sind verschossen, kein Zurück gilt ihnen mehr.
Doch unverzagt, am Epidermisgrund wartet schon Ersatz:
Bilden neue Kapseln schon;
Diese zwängen sich durch Zellen,
Steh‘n zum Einsatz dann bereit.
.
– Ein Gummihandschuh, umgestülpt, dient nun als Vergleich,
Den Schleudermechanismus zu erklären:
Der Druck wird durch das Blasen schnell erhöht,
Schon sprießen rasch die Finger aus der Hand. –
.
Warum wohl stülpt der Schlauch sich anfangs in die Kapsel ein?
Der Spitze Wand ist dünner noch als dünn!
Verspürt den zellulären Druck an erster Stelle, weicht zurück,
Verschwindet mehr und mehr, zieht den Rest des Schlauches hinterher.
.
Verwenden stets das neue Stück.
Doch optimieren es noch viele,
Angepasst dem eigenen Bedarf.
Gespannt verfolgen wir, was im Lauf der Zeit sie so entwarfen.
Was entscheidend aber blieb: der Kapsel Explosion.
.
Fußnoten
[1] Dictyosom, Netzorganell: Oft tellerförmig anmutende Cisternen treten gern in gestapelter Weise auf, an deren Rändern Vesikel abgeschnürt werden; jedes einzelne Organell der Zelle wird oft als Dictyosom (Netzorganell) bezeichnet, während alle Organelle zusammen als Golgi-Apparat geführt werden
[2] Cisternen (Zelle): Abkömmlinge des endoplasmatischen Retikulums in hohler und oft flacher Form; Zellvesikel auch Zellkerne sind damit umgeben, besitzen den gleichen Grundbau wie die Zellmembran.
[3] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen und in Geißeln; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.
[4] Organell (zellintern): Lipidmembranumgrenzter Bereich eigener Funktion
[5] Kollagen: Heterogene Gruppe von Proteinen; der wichtigste Faserbestandteil von Sehnen, Knorpeln, Blutgefäßen und Zähnen; bildet eine linksgängige Schraube, wobei jeweils drei dieser Schrauben in einer rechtsgängigen Superschraube arrangiert sind, dem eigentlichen Kollagen; diese Trippelschraube wird durch Wasserstoffbrücken zwischen den einzelnen Strängen stabilisiert; nur bei Animalia (Echte Tiere) vorkommend
[6] Bestehend aus hohen Ionenkonzentrationen, Aminosäuren und Proteinen; darunter Neurotoxine
[7] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt
[8] Stammzellen: Zellen, die in der Lage sind, eine Kopie von sich selbst hervorzubringen, indem sie sich teilen. Doch durch die Teilung entstehen nicht zwei neue Stammzellen, sondern es handelt sich um eine asymmetrische Zellteilung, bei der zwei verschiedene Zellen entstehen. Die eine der neu entstandenen Zellen ist ein Duplikat der Mutterzelle und hat die gleichen Eigenschaften, es entsteht also eine neue Stammzelle. Die andere Zelle, die durch die asymmetrische Zellteilung entstanden ist, entwickelt sich zu einem spezialisierten Zelltyp.
[9] Interstitielle Zelle: Stammzelle
[10] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.
[11] Quallen: Schirm- oder glockenförmige Nesseltiere
[12] Korallen: Blumentiere (Anthozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta – Eukarya)
Eingestellt am 23. November 2024
.
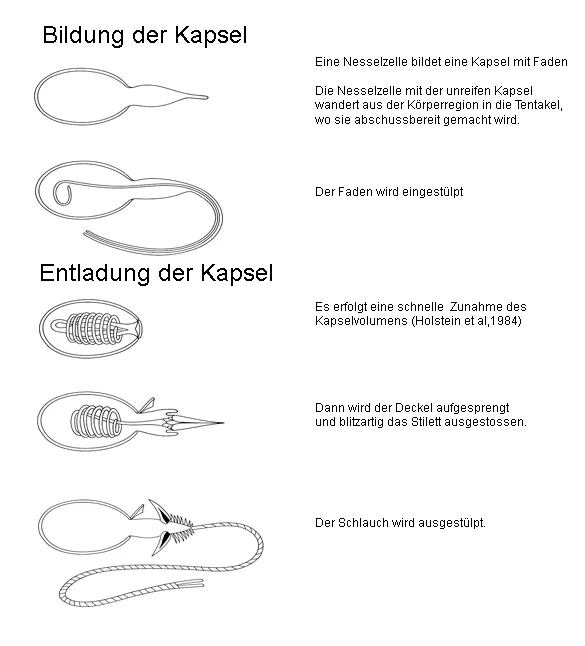
Bildung und Entladung einer Nesselkapsel
Autor: k.herrmann
Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode; unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
.

Cnidaria, Nesseltiere:
2 Die Anfänge
.
Schwimmend und schwebend gleitet die Blastula[1] sacht sich bewegend
Im salzigen Wasser des Meeres dahin,
Wehrt sich erfolgreich listig fischender, klebriger Ruten[2].
Wird nicht zur Beute, hascht vielmehr selbst nach Nahrung und Leben.
.
Oder teilt ihre Zellen der Quere zur doppelten Hülle[5].
Erfinderisch wirken noch andere:
Schicken vermehrt Zellen nach innen ins zweitnächste Glied[6].
.
Als Hohlkugel oder als Gastrula setzt sich die Planula
– Anders als Schwämme – dem Urmund[7] gegenüber, jeglichem Untergrund an.
Blastulae brechen apikal auf,
Den inneren Raum nach außen zu öffnen.
.
Längs streckt sich das sitzende Tier, wandelt zur Schlauchform sich um.
Nahende Beute mit Schleudern[12] zu jagen, lauernden Häschern zu wehren.
.
Noch vermehrt werden die Arme[13] im Laufe der Zeit.
Den Bewohnern des Meeres streckt der Polyp[14] sich vielarmig entgegen.
Schier konkurrenzlos wähnt sich das nesselnde Tier;
Verlängert den Körper, vergrößert den Bauchraum,
Unterteilt ihn in Taschen,
Strömende Nahrung an Zellen schnellstmöglich zu binden.
.
Fußnoten
[1] Blastula: Einzellschichtiges Hohlkugelstadium während der Ontogenese von Animalia
[2] Tentakel der Rippenquallen
[3] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria
[4] Gastrula: Im Verlauf der Ontogenese der Eumetazoa stülpt sich die Blastula zur Gastrula ein, bildet dadurch ein zweizellschichtiges Stadium
[5] Delamination: Entodermbildung erfolgt durch Ablösung der inneren Lage einer zweischichtig gewordenen Blastula
[6] Ingression: Einwanderung
[7] Urmund: Öffnung der Gastrula, die nach Einstülpung der Blastula im Zuge der Gastrulation entstanden ist
[8] Ektoderm: Äußeres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation außen verbliebene Zellschicht der Blastula
[9] Pharynx (allgemein): Rachen, Schlund
[10] Mundfeld (Coelenterata, Hohltiere): Bereich zwischen Mund und Tentakeln
[11] Tentakel (Nesseltiere): Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[12] Nesselzellen: Zellen in der Epidermis der Cnidaria, zum Beutefang und zur Abwehr dienend; bei Reizung wird ein Nesselschlauch ausgeschleudert, der häufig ein hochwirksames Gift in das Opfer injiziert
[13] Tentakel
[14] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet
Eingestellt am 23. November 2024
.
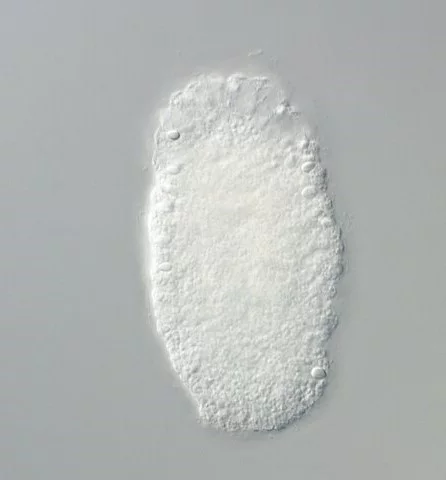
Planula-Larve von Rhizotoma luteum (Scyphozoa)
Autoren: Karen Kienberger, Marta Riera-Buch, Alexandre M. Schönemann, Vanessa Bartsch, Roland Halbauer, Laura Prieto
Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International; unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
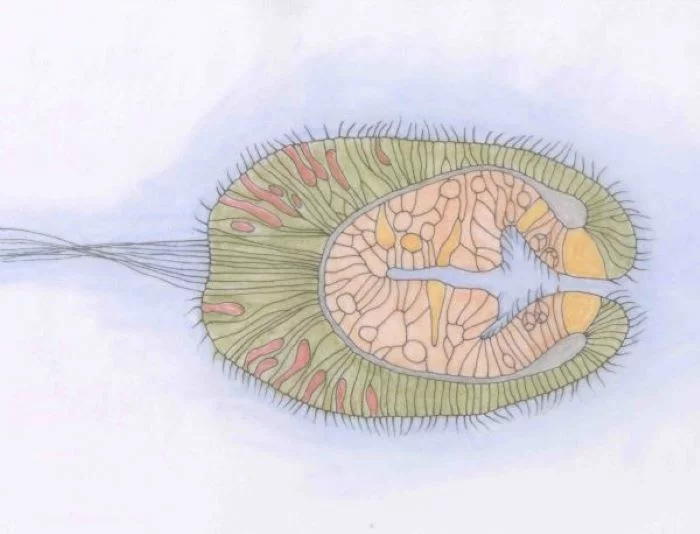
Planulalarve von Aiptasia mutabilis; Längsschnitt (Tusche und Kreide; Reinhard Agerer)
Bewimpertes Ektoderm (moosgrün) mit Spirocysten (rot); aboraler Pol mit Wimpernschopf; Mesogloea (grau); Entoderm (orange) mit Drüsenzellen (gelb); Gastrovaskularsystem (blau).
Nach Westheide & Rieger (2013), Seite 127, Abb. 197.
Eingestellt am 23. November 2024
.

Cnidaria, Nesseltiere:
3 Des Polypen Bau
.
Setzen mit Scheitelpol, dem animalen Pol[4], sich fest, der zur Fußplatte wird;
Der Urmund[5] streckt sich weg vom Substrat, wird Mund und After,
So werden vier- bis vielstrahlig Polypen[8] der Nesseltiere,
Radiärsymmetrisch[9], wenn betrachtet von oben herab.
.
Dehnbar-elastisch zeigt sich der Körper,
Werden größere Opfer verschluckt,
Nachdem Tentakel sich nach innen gebogen,
In den Mund abstreifen, was daran hing.
.
Unterschiedlich mächtig, oftmals ektodermzellenbevölkert, zeigt sich die Mesogloea[10];
Verbindet sie Ekto- und Entoderm, klebt Fußplatten[14] fest an den Boden;
Epidermis[15], vom Ektoderm abgeleitet, und Gastrodermis, Bildung des Entoderms,
Waren, ursprünglich zumindest, wie an Planula-Larven, monociliate[16] Zellen,
Verloren gelegentlich Geißeln[17]; spezielle Aufgaben wurden zugeteilt.
.
Längsverlaufende, weit vorspringende Falten des Entoderms, mit dünner
Mesogloea-Schicht[18] versteift, zergliedern in unterschiedliche Anzahl von Teilen den Raum,
Vergrößern des Gastroderms[19] verdauende, resorbierende Fläche,
Erhöhen signifikant den Ressourcengewinn.
.
Verflüssigtes nehmen Epithelmuskelzellen[22] anschließend auf;
Partikel werden, davon wird zumindest nichts berichtet,
Nicht endocytotisch[26] einverleibt,
Unverdauliches ausgeschieden, wenn nötig durch Muskelkontraktionen hervorgewürgt.
.
Resorbieren schon Zellen der Epidermis und kommen so dem Zellengesamt
Der Polypen zugute.
.
Nicht nur der Resorption dienen Epithelmuskelzellen,
Auch der Tentakel Bewegung, des Körpers Längs- und Radialkontraktion;
Bilden an ihrer Basis Ausläufer, deren Actinomyosinfilamente[31] längs in der Epidermis verlaufen,
In der Gastrodermis hingegen formen sie des Körpers Ringmuskulatur.
.
Nervensysteme lenken der Nesseltiere Bewegung,
Wobei einzelne Rezeptorzellen bis zur Epitheloberfläche zieh’n,
Andere, mit langen Fortsätzen, liegen unterhalb Epithelien, bilden netzartige Systeme,
Konzentrieren gelegentlich sich, wo erhöhter Informations- und Reaktionsbedarf;
Über Synapsen[32] sind sie unter sich und mit einzelnen Zellen verbunden;
Nicht selten liegen zwei oder mehr dieser Nervennetze vor.
.
Eines besteht gewöhnlich aus multipolaren Neuronen[33] mit kurzen Fortsätzen, langsamer Erregung und
Rasch fortschreitendem Abbau, geeignet für Informationen im Nahbereich;
Andere bestehen aus bipolaren Neuronen[34] mit längeren Ausläufern,
Bei deren Erregung rasch der Polyp zusammen sich zieht.
Auch Nervennetze kommunizieren miteinander,
Deren Neuronen sind bipolar.
.
Viele Polypen vermehren sich asexuell[35] durch Abschnüren von Schirmquallen, Medusen;
Werden schnell sie nacheinander, hintereinander gebildet, schnürt der Polyp seriell sich ein.
Was als Mundfeld mit Tentakel am Polyp nach oben gerichtet, dreht sich,
Zeigt nach unten, was nach unten gerichtet war, wird der gelatinöse Schirm[36].
.
Fußnoten
[1] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria
[2] Ektoderm: Äußeres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation außen verbliebene Zellschicht der Blastula
[3] Entoderm: Inneres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation nach innen gebrachte Zellschicht der Blastula
[4] Animaler Pol (Embryonalentwicklung): Scheitelpol, gegenüber dem Urmund; Pol der stärksten Zellteilungsaktivität; bei Bewegungen der hintere Bereich
[5] Urmund: Öffnung der Gastrula, die nach Einstülpung der Blastula im Zuge der Gastrulation entstanden ist
[6] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[7] Mundfeld (Coelenterata, Hohltiere): Bereich zwischen Mund und Tentakel
[8] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.
[9] Radiärsymmetrisch: Durch einen Gegenstand, Organismus oder Organismenteil lassen sich mehr als zwei Symmetrieebenen legen
[10] Mesogloea: Gallertartiges Gewebe bei Ctenophora (Rippenquallen) und Cnidaria (Nesseltieren), den Hohltieren, das den Zwischenraum zwischen der Gastrodermisschicht und der Epidermisschicht außen füllt. Sie ist zunächst zellfrei, bei den meisten Gruppen wandern jedoch verschiedene Zellen in die Schicht ein. Es handelt sich dabei aber nicht um ein drittes Keimblatt, nicht um ein Mesoderm.
[11] Kollagen: Heterogene Gruppe von Proteinen; der wichtigste Faserbestandteil von Sehnen, Knorpeln, Blutgefäßen und Zähnen; bildet eine linksgängige Schraube, wobei jeweils drei dieser Schrauben in einer rechtsgängigen Superschraube arrangiert sind, dem eigentlichen Kollagen; diese Trippelschraube wird durch Wasserstoffbrücken zwischen den einzelnen Strängen stabilisiert; nur bei Animalia (Echte Tieren) vorkommend.
[12] Glycoproteine: Substanzen aus Zuckern und Proteinen
[13] Glucosaminglucane: Bestehen aus Estern einer Uronsäure. Meist handelt es sich um Glucoronsäure. Die Disaccharid-Einheiten sind 1-3-glycosidisch mit N-Acetylglucosamin verbunden. Die Kettenbildung der Disaccharid-Einheiten erfolgt durch 1-4-glycosidische Bindungen
[14] Fußscheibe, Fußplatte: Der Anheftungsbereich des Polypenfußes ist flächig verbreitert
[15] Epidermis: Außenschicht eines Tieres
[16] Monociliat: Mit nur einer Geißel versehen
[17] Geißel, Flagellum: Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt
[18] Stützlamelle: Dünne Schicht der Mesogloea zwischen Ekto- und Entoderm
[19] Gastrodermis, Gastroderm: Epithel des Verdauungstraktes
[20] Drüsenzellen: Zellen, die der Produktion und Abgabe (Sekretion) bestimmter Substanzen dienen
[21] Enzym: Protein, das, an spezielle Moleküle angepasst, die Synthese katalysiert. Meistens werden mehrere Enzyme zu einem Komplex verbunden, um eine räumliche Nähe zwischen den einzelnen, aufeinanderfolgenden Syntheseschritten herzustellen
[22] Epithelmuskelzellen (Nesseltiere): Epithelzellen mit basalen Ausläufern, in den Actinomyosinkomplexe für Bewegungsvorgänge liegen
[23] Glycogen: Ein hochverzweigtes Polysaccharid aus meist α-1,4 verknüpfter Glucose (mitunter α-1,6 am freien [–CH2OH] des Glucoserings); Speicherprodukt von Tieren, Pilzen und Bakterien
[24] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt, das zweite der beiden benachbarten den Aminosäurerest
[25] Fettes Öl, Lipid: Ein Triglycerid aus Glycerin (mit drei [–OH]-Gruppen) und drei Fettsäuren, die als Fettsäurereste unter Wasserabspaltung ans Glycerin gebunden und eine Bindungsgruppe –C–O–(C=O)– ergeben
[26] Endocytose: Aufnahme eines Partikels aus der Zellumgebung mit Hilfe eines aus der Zellmembran durch Einstülpung entstandenen Vesikels
[27] Glucose, Traubenzucker: Ringförmiger Zucker mit sechs [C]-Atomen [C6H12O6]; der Ring besteht aus fünf [C]-Atomen und einem Sauerstoffatom; das restliche [C]-Atom hängt als [–CH2OH]-Gruppe an einem dem Sauerstoff benachbarten [C]-Atom; vier [–OH]-Gruppen stehen an [C]-Atomen des Rings, wobei [–CH2OH] und die dem Sauerstoff benachbarte [–OH]-Gruppe in gleicher Richtung stehen, alle anderen wechseln sich richtungsmäßig ab
[28] Aminosäuren: Organische Säuren mit einer Amino-[–NH2] Seitengruppe. Biologisch bedeutend sind hauptsächlich jene Aminosäuren, die an dem der Säuregruppe benachbarten Kohlenstoffatom diese Gruppe besitzen
[29] Zooxanthellen: Endosymbionten in einer Reihe von Lebewesen. Bei den Zooxanthellen handelt es sich meistens um Dinoflagellaten, aber auch um Chrysomonden, Cryptomonaden oder Diatomeen kommen vor
[30] Symbionten: Organismen, die wechselseitig zu beiderseitigem Vorteil dem anderen nehmen; auch als wechselseitige Parasiten verstehbar
[31] Actinomyosin-Komplexe: Actin bildet mit Myosin für Bewegungen in Zellen Komplexe mit mehreren Fibrillen; Myosin als Motorprotein, kann Verknüpfungen zu verschiedenen Actin-Fibrillen herstellen und dadurch die Fibrillen aneinander vorbeiziehen, was in Zellbewegungen münden kann.
[32] Synapsen: Verbindungen zwischen Nervenzellen, bzw. von Axon zu Axon. Dort enden die elektrischen Signale (an der Grenze zwischen prä- und postsynaptischem Teil); die Informationsübertragung erfolgt nun durch Ausschüttung von in Vesikeln gebildeten Neurotransmittern; sie werden vom postsynaptischen Teil aufgenommen, wodurch wieder elektrisches Potential entsteht, das vom Axon rasch weitergeleitet wird
[33] Multipolare Neuronen: Häufig vorkommende Form einer Nervenzelle, die viele Dendriten, aber nur ein Axon besitzt
[34] Bipolare Neuronen: Nervenzellen mit zwei getrennt voneinander abgehenden Fortsätzen. Sie haben somit nur einen Dendriten und ein Axon.
[35] Asexuell (Vermehrung): Nur aufgrund von Mitosen gebildet
[36] Umbrella: Schirm der Quallen
Eingestellt am 23. November 2024
.

Cnidaria, Nesseltiere:
4 Medusenbildung auf die Spitze getrieben (gezeigt an Scyphozoa: Kronen- und Scheibenquallen)
.
Der ganze Polyp[1] wächst in die Höhe,
Lässt Tentakel[2] hinter sich;
Die Mundscheibe[3] nur, die dazwischen geborgen,
Beschreitet nun einen entscheidenden Weg:
.
Einschnürung auf Einschnürung entstehen am Zuwachs,
Der den Polypen nach oben erhöht,
Von denen, eine der anderen, folgend vom Stapel geht.
.
Die erste übernimmt des Polypen etwas vorgezogenen Mundkegel[6],
Formt ihn, leicht ihn verlängernd, zum künftigen Mundrohr[7],
Trennt sich von der nächsten, jüngeren, noch weniger eingeschnürten Scheibe
Dreht sich nach Ablösen um, wird zum Schirm[15],
Das Mundrohr hängt nun nach unten:
Eine junge Qualle, die erste Ephyra, flottiert im Wasser dahin!
.
Die nächste Scheibe, sie ist an der Reihe nun, sich zur Ephyra
zu bilden,
Hat jedoch das Nachsehen, denn des Polypen Mundkegel verschwand
Mit der älteren Schwester; so nimmt sie, wie auch die folgenden, ein
Rohr, das im Innern des Scheibenstapels bereits liegt,
Gebildet aus längsmuskeldurchzogenen, vereinten Mesenterien[16] des Polypen;
Nimmt nun das nötige Stück,
Trennt sich in gleicher Weise von der darunter schon wartenden jüngeren Schwester,
Macht sich, wie die ältere Schwester auf den von Abenteuern gesäumten Weg.
.
Ein Dutzend und mehr der Ephyren kann so entstehen,
Bis der Polyp darunter, seine Tentakel sind noch vorhanden, nicht aber intakt,
Meint, mit regenerierten Tentakeln will als Polyp er jetzt wieder leben,
Sein Mundfeld mit Mund wieder versieht und wie früher, mit neuen Tentakeln fischt.
.
Doch jung ist sie noch, die Epyhra,
Eine erwachsene Qualle aber möchte in Zukunft sie sein:
So bildet sich aus ihren acht zweilappigen Anhängen
Nach und nach ein vergrößerter, harmonisch gebogener, ganzrandiger Schirm;
Meist bleiben die Läppchen als kleine Rhopalarlappen[17] erhalten,
Neue Tentakel entstehen am Rand des Schirms;
Doch zu unbedeutend mitunter sind dem Mund die mitunter recht kurzen Tentakel,
So bilden sich rundherum eigene Mundarme[18] aus.
.
Fußnoten
[1] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.
[2] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[3] Mundfeld, Mundscheibe (Coelenterata, Hohltiere): Bereich zwischen Mund und Tentakeln
[4] Ephyra: Larvenform bei Scyphozoa (Schirmquallen) und Hydrozoa (Hydrozoen); Scheibe mit kurzen, zweilappigen, flügelartigen Anhängen
[5] Medusen, Quallen: Ein freischiwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere
[6] Mundkegel: Wenn die Mundöffnung nicht in der Ebene liegt, sondern auf einer kegelförmigen Erhöhung
[7] Mundrohr: Die Mundöffnung wird auf das Ende einer langen Röhre verlegt
[8] Ektoderm: Äußeres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation außen verbliebene Zellschicht der Blastula
[9] Entoderm: Inneres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation nach innen bebrachte Zellschicht der Blastula
[10] Stützlamelle: Dünne Schicht der Mesogloea zwischen Ekto- und Entoderm
[11] Mesogloea: Gallertartiges Gewebe bei Ctenophora (Rippenquallen) und Cnidaria (Nesseltieren), den Hohltieren, das den Zwischenraum zwischen der Gastrodermisschicht und der Epidermisschicht außen füllt. Sie ist zunächst zellfrei, bei den meisten Gruppen wandern jedoch verschiedene Zellen in die Schicht ein. Es handelt sich dabei aber nicht um ein drittes Keimblatt, nicht um ein Mesoderm.
[12] Kollagen: Heterogene Gruppe von Proteinen; der wichtigste Faserbestandteil von Sehnen, Knorpeln, Blutgefäßen und Zähnen; bildet eine linksgängige Schraube, wobei jeweils drei dieser Schrauben in einer rechtsgängigen Superschraube arrangiert sind, dem eigentlichen Kollagen; diese Trippelschraube wird durch Wasserstoffbrücken zwischen den einzelnen Strängen stabilisiert; nur bei Animalia (Echte Tieren) vorkommend.
[13] Glycoproteine: Substanzen aus Zuckern und Proteinen
[14] Glucosaminglcane: Besehen aus Estern einer Uronsäure. Meist handelt es sich um Glucoronsäure. Die Disaccharid-Einheiten sind 1-3-glycosidisch mit N-Acetylglucosamin verbunden. Die Kettenbildung der Disaccharid-Einheiten erfolgt durch 1-4-glycosidische Bindungen
[15] Umbrella (Nesseltiere): Schirm der Quallen
[16] Mesenterien (Polypen): Scheidewände im Innern von Polypen, die den Gastralraum aufteilen
[17] Rhopalium: Rand- oder Sinneskörper von Scophozoa (Schirmquallen) und Cubozoa (Würfelquallen), Hydrozoa (Hydrentiere), die am Rand des Schirms dieser Nesseltiere zu finden sind. Sie haben die Form kleiner mit Entoderm ausgekleideter Tentakel oder Keulen, die der Oberseite des Schirms der Meduse entspringen durch einen Decklappen geschützt werden, gelten als Rückbildungen von Tentakeln. Als Sinneszellen sind Statocysten (Gleichgewichtsorgane) und Ocellen an den entodermalen Zellen der Keulenspitze ausgebildet.
[18] Mundarme: Cnidocytentragende unregelmäßig geformte, unmittelbar dem Mundrand entspringende Auswüchse
Eingestellt am 23. November 2024
.
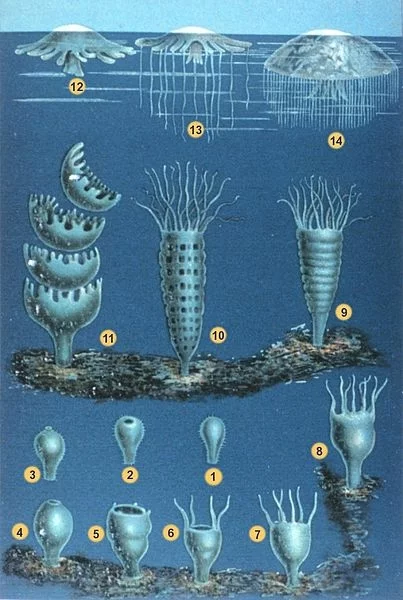
Lebenszyklus einer Schirmqualle
1–8: Festsetzen der Planulalarve und Metamorphose zum Polyp 9–11: Abschnürung (Strobilation) der Ephyralarven 12–14: Umwandlung der Ephyren zur ausgewachsenen Qualle
Autor: Matthias Jacob Schleiden
Lizenz: Gemeinfrei; unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
.
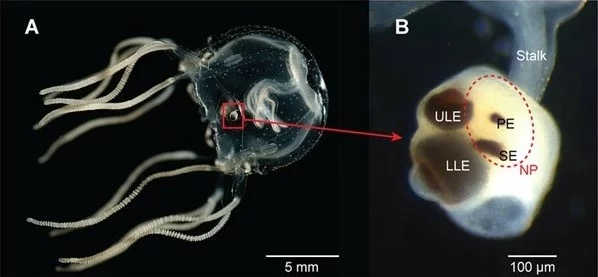
Cubozoa-Sehsystem
Das Sehsystem des Cubozoa Tripedalia cystophora (A) besteht aus vier sensorischen Strukturen, die Rhopalia (B) genannt werden. Jedes Rhopalium trägt sechs Augen von vier morphologischen Typen (unteres Linsenauge LLE, oberes Linsenauge ULE, Grubenauge PE und Schlitzauge SE) und ein lichtempfindliches Neuropil (NP, rote gestrichelte Linie). Die Augen sind für die Bildbildung im Tier verantwortlich und das lichtempfindliche Neuropil ist vermutlich an der täglichen Aktivität beteiligt.
Autoren: Jan Bielecki, Alexander K. Zaharoff, Nicole Y. Leung, Anders Garm, Todd H. Oakley
Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
.
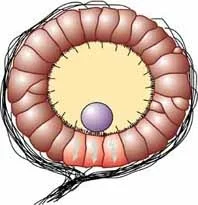
Schema einer Statocyste
Rezeptorzellen (rotbraun), Statolith (violett), Sensible Nervenfasern (schwarz)
Bei Bewegungen und Lageänderungen der Cyste kommt der Statolith an die Sinneshärchen der Hülle und reizt diese. Der Reiz wird an das Nervensystem weitergeleitet und dient der räumlichen Orientierung.
Autor: Davis, W. J.
Lizenz: Gemeinfrei; unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
.

Cnidaria, Nesseltiere:
5 Der Medusen Bau
.
Zwanglos lassen Medusen, wie schon betrachtet, sich als der Polypen[1] Abkömmlinge sehen,
So liegt auch, evolutiv bedacht, sekundäre Entstehung der Quallen[2] wohl auf der Hand.
Aber nicht allen Cnidarien sind Quallen zu eigen, viele vermehren sich nur als Polypen.
Auch Molekularphylogenie[3] bestätigt der Polypen Ursprünglichkeit.
.
Weil von Polypen abgeleitet, ähneln sich auch der Medusen Merkmale.
Werden Medusen nicht wenig verändert, erreichen habituell[6] hohe Vielfalt:
.
Fangtentakeln hängen frei nach unten am Rand der Umbrella[10];
Unterseits hängt das Manubrium mit Mundöffnung im Zentrum und mit Zentralmagenverbindung,
Mundarme schließen in unterschiedlicher Weise gestaltet sich daran.
.
Des Verdauungssystems Oberfläche stark zu vergrößern,
Wobei am Schirmrand ein Ringkanal[17] sie miteinander verbinden kann.
.
Eine Sippe entwickelte gar sich zu obligaten Parasiten[18],
Reduzierten beinahe alles, was für Cnidaria als typisch gilt:
Polypen und Medusen legten sie, weil nicht mehr nötig, beiseite,
Behielten umgewandelte Cnidocyten[19] als Mittel der Penetration und Okkupation.
.
Fußnoten
[1] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.
[2] Quallen: Schirm- oder glockenförmige Nesseltiere
[3] Molekularphylogenie: Auf Molekülähnlichkeiten (meistens von DNA, doch mitunter auch von Proteinen) basierende Schlüsse bezüglich Stammesgeschichte bzw. Verwandtschaftslinien von Organismen
[4] Klasse: Hierarchische Ebene unterhalb Abteilung (Phylum)
[5] Sippe: Unter Sippe wird eine oft nicht genauer genannte Verwandtschaft verstanden, im Gegensatz zu Gruppe, die lediglich eine Gruppe nicht näher verwandter Organismen bezeichnen will
[6] Habitus: Äußere Gestalt
[7] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[8] Manubrium: Lange Röhre als Fortsetzung des Magens und Träger des Munds
[9] Mundarme: Cnidocytentragende unregelmäßig geformte, unmittelbar dem Mundrand am Ende des Mundrohrs (Manubrium) entspringende Auswüchse
[10] Umbrella: Schirm der Quallen
[11] Statocysten, Gleichgewichtsorgane: in ihnen liegt der Statolith
[12] Augen: Lichtempfindliche Meldeorgane vieler Tiere und weniger Algen
[13] Magentaschen: Taschenförmige Abgrenzungen in Polypen und Quallen, von in den Verdauungsraum vorspringenden Mesenterien gebildet
[14] Mesenterien: Scheidewände im Innern von Polypen, die den Gastralraum aufteilen
[15] Anastomosen: Stellen sekundär miteinander verbundener Röhren oder hohler Trichome
[16] Radialkanäle, Radiärkanäle (Cnidaria): Quallen besitzen, vom zentralen Magen ausgehend, radial, nach außen verlaufende, Kanäle, die peripher meist über einen Ringkanal miteinander verbunden sind.
[17] Ringkanal: Quallen besitzen meistens einen peripheren Ringkanal, der vom zentralen Magen ausgehende Kanäle miteinander verbindet
[18] Obligate Parasiten: Parasiten, Organismen, die auf Kosten eines anderen leben und zumindest in einer ihrer Lebensphasen auf lebende Organismen unbedingt angewiesen sind
[19] Cnidocyten, Nesselzellen: Nesselkapseln bildende Zellen
Eingestellt am 23. November 2024
.

Ab hier werden die Texte bezüglich Taxanamen der Cnidaria (s. Stammbaum und/oder Pfade) alphabetisch geordnet.
Die evolutiven Zusammenhänge lassen sich deshalb aber nur erkennen und verfolgen, wird auch der zugehörende Stammbaum berücksichtigt.

Actinaria, Seeanemonen:
1 Der Ordnung Merkmale
.
Skelettlos leben zu mancherlei Vorteilen Seeanemonen,
Halten strenge Ordnung im Inneren ein:
Nur paarweise stehen Mesenterien[1],
Deren Einheit geringerer Abstand zeigt.
.
Zwei hervorgehobene Paare begleiten nach unten, beide
Siphonogyphen[2] einschließend, die Winkel des langgezogenen Schlunds:
Der Mesenterien Retraktoren[3], die Muskelfahnen, zeigen weg von der Tasche,
Nach außen gekehrt, nicht zueinander, wie für die anderen Paare dies gilt.
.
Jedes Mesenterienpaar umschließt eine Tasche,
Die Korallenexperten als Binnenfach[4] gilt;
Der Raum zwischen benachbarten Paaren, größer,
Gilt als Zwischenfach[5]; nur darin entsteht das neue Mesenterienpaar:
Bleibt oft kürzer, erreicht bei weitem
Das Schlundrohr nicht.
Ins Zentrum reichende Septen[6] durchbrechen ein oder zwei größere Poren,
Zum Wasseraustausch und zum Druckausgleichen gedacht.
.
Nicht wenige Seeanemonen erweisen sich als ausgesprochen beweglich,
Brauchen aber dafür noch weitere Muskulatur:
In Mesenterienbasen, parallel zur Fußscheibe[7],
Zieh’n sie zentripetal[8], zur Mitte, hin;
Andere, davon ausgehend, richten sich schräg in der Wand nach oben,
Nehmen dann aber schnell des Polypen[9] Hauptrichtung an;
Nur aus Epithelmuskelzellen[10] besteh‘n all die Strukturen,
Mit denen sich der Seeanomonenkörper bewegt.
.
.
Neue Tentakel, deren Hohlraum Verbindung zum Binnenfach hält;
So wächst der Polyp auch in Weite,
Schafft so für neue, oft in zwei Kreisen stehende Arme den nötigen Raum.
.
Manche Arten entwickeln, von der Mesenterienbasis ausgehend,
Langgezogene, weitreichende Nesselfäden, die gezielt,
Wohl mit raumverkleinernder Wasserströmung verbunden,
Weit hinausgeschleudert werden,
Beute zu haschen, sie durch Polypenstreckung ins Innere zu zieh’n.
Spezielle Nesselsäckchen[19] liegen bei anderen
Außen unterhalb der Tentakel rundum.
.
Die, mit wohlausgebildetem Nervensystem verbunden, eine schnelle Reaktion
Von Tentakeln oder des ganzen Polypen veranlassen,
Ein Hin zur Beute, oder Rückzug bei angezeigter Gefahr.
.
Verwirklichen vielfältige Fortpflanzungsweisen:
Larven[25] eine Zeitlang im Inneren hütend;
.
Fußnoten
[1] Mesenterien: Scheidewände im Innern von Polypen, die den Gastralraum aufteilen
[2] Siphonoglyphen: An Winkeln der Mund-Afteröffnung der Polypen beginnende, nach unten in den Magenraum ziehende bewimperte Streifen
[3] Retraktoren: Rückziehmuskeln
[4] Binnenfach: Tasche zwischen zwei gleichzeitig als Paar gebildeten Mesenterien, die enger stehen als benachbarte Mesenterien
[5] Zwischenfach: Weite Tasche zwischen zwei benachbarten Mesenterien im Vergleich zu jenem Paar, das das Binnenfach bildet
[6] Mesenterien
[7] Fußscheibe, Fußplatte: Der flächig verbreiterte Anheftungsbereich des Fußes
[8] Zentripetal: Richtung Zentrum
[9] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.
[10] Epithelmuskelzellen: Epithelzellen mit basalen Ausläufern, in denen Actinomyosinkomplexe für Bewegungsvorgänge liegen
[11] Sphinktermuskel: Schließmuskel
[12] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[13] Tentakel
[14] Tangential: eine gekrümmte Fläche oder Linie berührend (schneidend)
[15] Paare werden immer zugleich und paarweise gegenüber angelegt
[16] Mundfeld, Mundscheibe: Bereich zwischen Mund und Tentakeln
[17] Scapus, Hydrocaulus: schmaler Teil (Stamm) eines Polypen
[18] Mund-After-Öffnung: Körperöffnung, die zugleich als Mund und After verwendet wird
[19] Nesselsäckchen: In Säckchen zusammengefasste Nesselzellen
[20] Mechanorezeptoren: Auf körperliche Reize reagierende Sinneszellen
[21] Chemorezeptoren: Auf Moleküle reagierende Sinneszellen
[22] Tentakel
[23] Getrenntgeschlechtlich: Weibliches und männliches Geschlecht sind auf zwei verschiedene Individuen verteilt
[24] Zwitter: Weibliche und männliche Gameten befinden sich auf ein und demselben Individuum, müssen aber nicht zur gleichen Zeit zur Reife kommen
[25] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria
[26] Vivipar: Lebendgebärend; bereits entwickelte Larven, oder (junge) Adulte verlassen das Mutterzoon
[27] Parthenogenetisch: Eine Fortpflanzungsstrategie, bei der sich ein weiblicher (selten männlicher) Gamet ohne Befruchtung entwickelt
Eingestellt am 23. November 2024
.

Actinaria, Seeanemonen:
2 Purpurrose alias Pferdeaktinie (AP)
.
Zu Aktinien[1], den Seerosen unter Actinaria,
Gehört die Purpurrose[2], die bekannteste Art:
Lebt in vielen Farbvariationen in Gezeitenzonen[3] europäischer Meere,
Wenig empfindlich gegen Trockenfallen und variierendem Salzgehalt;
Schützt sich mit Schleimen, sollte es doch geschehen,
Dass für längere Zeit Wasser Seltenheit bleibt.
.
Mit fünf bis sechs Centimeter Durchmesser
Und in etwa ebenso hoch,
Trägt sie einhundertundzweiundneunzig Tentakeln[4] in sechs Kreisen am
Rand ihrer Mundscheibe[5] rundum.
Bis zu zwei Centimeter lang werden die spitzzulaufenden Arme[6];
Droht Gefahr oder kommt sie zur Ruhe, zieht Tenakel sie kurzerhand ein.
.
Nervt sie der Standort schon etwas länger,
Zieht sie weiter nach unten womöglich um:
Lässt Muskelwellen über die Fußscheibe[7] laufen,
Bewegt sich so fünfzig Centimeter pro Tag.
.
Nähert sie sich zu sehr einer andern auf diese Weise,
Braucht sie nicht sich zu wundern, wenn die Bedrängte Pfeilarsenale schießt
Aus ihren außerhalb des Tentakelrunds liegenden Kapselsäckchen[8],
Um ihr Halt zu gebieten, auch wenn den ein oder anderen Arm sie verliert;
Der Säckchen Haut bleibt an der anderen hängen,
Verursacht Gewebezerfall, rückt der Zudringling nicht rechtzeitig weg.
.
Aktinien leben nur von tierischer Beute,
Verwenden die kräftigen, nesselbestückten Tentakel dazu,
Packen und lähmen die Opfer,
Bringen mit iheen Armen sie zum Mund;
Reste kleiner Fischchen, von Krebschen, von
Weichtieren[9], entdeckten Experten im Bauchraum bereits.
.
Zwei Formen scheint es unter Pferdaktinien zu geben,
Wovon die eine sechs bis sieben Centimeter erreicht,
Nur in unteren Gezeitenzonen siedelt,
Ovipar[10] ausschließlich lebt;
Die andere aber, wesentlich kleiner,
Bewächst obere Tidenzonen und vermehrt sich nur vivipar[11]. –
Wer ökologisch, fortpflanzungsbiologisch schon etwas belesen,
Schließt, Nachkommen aus stark bewegten Gezeitenzonen brauchen in ihrer Jugend erhöhten Schutz. –
.
Wer aber Tiere als Beute fängt, dem sind solche Helfer womöglich egal.
.
Fußnoten
[1] Aktinien, Seerosen: Actinia (Actinaria – Hexacorallia – Anthozoa – Cnidaria – Animalia –…)
[2] Purpurrose, Pferdeaktinie: Actinia equina (Actinaria – Hexacorallia – Anthozoa – Cnidaria – Animalia –…)
[3] Gezeiten, Tide: Wasserbewegungen der Ozeane, die durch von Mond und Sonne erzeugte Gezeitenkräfte im Zusammenspiel mit der Erddrehung verursacht und Wasserspiegel entsprechend gesenkt oder gehoben werden
[4] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[5] Mundscheibe: Bereich zwischen Mund-After-Öffnung und Tentakelkranz
[6] Tentakel
[7] Fußscheibe, Fußplatte: Der flächig verbreiterte Anheftungsbereich des Fußes
[8] Nesselzellsäckchen: In Säckchen zusammengefasste Nesselzellen
[9] Weichtiere: Mollusca (Schizocoelia – Spiralia – Protostomia – Bilateria – Animalia –…)
[10] Ovipar: Eizellen oder Zygoten verlassen das Mutterzoon
[11] Vivipar: Lebendgebärend; bereits entwickelte Larven, oder (junge) Adulte, verlassen das Mutterzoon
[12] Aktinien
[13] Zooxanthellen: Endosymbionten in einer Reihe von Lebewesen. Bei den Zooxanthellen handelt es sich meistens um Dinoflagellaten; aber auch um Chrysomonden, Cryptomonaden oder Diatomeen kommen vor
Eingestellt am 23. November 2024
.

Oben: Purpurrose, Pferdeaktinie, Actinia equina
Mit offenen Armen
Autor: Hans Hillewaert
Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert
Unten: Purpurrose, Pferdeaktinie, Actinia equina, eingezogenem Zustand
Mit eingezogenen Armen
Autor: Andy Cowley
Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
.

Actinaria, Seeanemonen:
3 Mantelaktinie (TP)
.
Ohne den zu leben, sie nicht mehr im Stande ist;
So eng ist der Aktinie Abhängigkeit schon geworden,
Dass sie, zieht er, obwohl ohne Grund, einmal aus, unweigerlich stirbt.
.
Auf der Oberseite setzt sie am Schneckenhaus[3],
Das er bezogen, sich fest; nach vorne unten gerichtet der Tentakelkranz[4],
Unmittelbar hinter des Krebses Mundöffnung;
Ernährt sich wohl von dem, was bei der Mahlzeit er überlässt.
.
Wächst der Krebs in seinem gefund’nen Gehäuse,
Wächst auch die Mantelaktinie heran,
Ummantelt mit horniger Fußscheibe[5] des Krebses Wohnung,
Löst den Kalk des Gehäuses bisweilen auf,
Umgibt selbst nun den Anemoneneinsiedler röhrig;
Er braucht kein neues, größeres Zuhause mehr, denn
Seine Behüterin, die er nicht selbst sich erkoren,
Lässt ihm immerzu den nötigen Raum.
.
Obwohl ihm der vollständige Rückzug genommen
– Er schaut aus seiner Ersatzbehausung ohne Pause hervor –
Schützen ihn allem Anschein nach der Seerose[6] Tentakel
Mit Nesselfäden[7] aus dem Bauchraum, die herausgepresst,
Vielerlei Feinde schrecken, ihr sich zu nähern, und bei Berührung sofort sich verzieh‘n,
Obwohl der Krebs als Leckerbissen den Vielen gilt;
Verlassen Anemoneneinsiedler freiwillig oder unfreiwillig ihr Zuhause,
Haben Mantelaktinien das Nachsehen, sie gehen ein. –
.
Auch andere Krebstiere, Krabben[8], erkannten, wie wertvoll Aktinien:
Lösen Bunodeopsis[9]-Arten vom Untergrund los,
Tragen sie mit sich mit den Scheren;
Greift ein Prädator[10] sie an, halten sie die stark Nesselnde ihm entgegen,
Der daraufhin gerne die Reißleine zieht.
Diese Krabben benutzen, wie es scheint, niemals Scheren,
Sich zu verteidigen oder zum Beutefang.
.
Fußnoten
[1] Anemonen-Einsiedlerkrebs: Pagurus prideauxi (Decapoda – Eumalacostraca - Malacostraca – Crustacea – Thoracopoda – …)
[2] Mantelaktinie: Adamsia palliata (Actinaria – Hexacorallia – Anthozoa – Cnidaria – Animalia –…)
[3] Schnecken: Gastropoda (Mollusca – Schizocoelia – Spiralia – Protostomia – Bilateria –…)
[4] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[5] Fußscheibe, Fußplatte: Der flächig verbreiterte Anheftungsbereich des Fußes
[6] Seerosen, Aktinien: Actinia (Actinaria – Hexacorallia – Anthozoa – Cnidaria – Animalia –…)
[7] Nesselfäden: Nesselzellen tragende Fäden des Bauchraums, die zum Beutefang herausgepresst werden können
[8] Krabben: Melia spp. (Brachiopoda – Thoracopoda – Crustacea – Malacostraca – Eumalacostraca –…)
[9] Bunodeopsis spp. (Actinaria – Hexacorallia – Anthozoa – Cnidaria – Animalia –…)
[10] Prädatoren: Organismen, die andere zum Zweck der Nahrungsaufnahme nutzen und dabei meist töten. Das Opfer eines Prädators ist dessen Beute.
Eingestellt am 23. November 2024
.

Actinaria, Seeanemonen:
4 Wie wertvoll die wandernde Schnecke (TP)
.
Siedeln sonst aber gleichfalls auf irgendeinem Hartsubstrat.
Doch kommt ihr eine Schnecke[3] entgegen, die ein Pagurus als Wohnung gefunden,
Lastet, auf ihr zu wohnen, Calliactis alle Mühen sich auf:
.
Betastet zunächst, wie es aussieht, die wandernde mögliche Bleibe,
Biegt, sobald das Kunststück vollzogen,
Den Körper nach unten, Fußscheibe[6] voran,
Hält mit ihm gleichfalls sich auf dem Schneckengehäuse,
Lockert und löst ihren tentakelbewirkten Halt danach,
Richtet sich auf, steht nun wie üblich
Auf ihrem Gefährt, streckt ihre Arme[7], frei nun, ins Meer.
.
Zieht der Krebs in eine größere Wohnung,
Lässt er die Rose[8] achtlos zurück.
Sie steht nun am Ort, niemand zieht sie noch weiter!
Worauf wartet sie wohl?
Auf einen neuen Wohnwagenbewohner, der fährt?
Oder hofft sie, dass eine andere Schnecke an ihr vorüberzieht,
Die womöglich schon mit anderen ihrer Spezies‘[9] besiedelt?
Wachsen gerne zu mehreren an solchem Ort.
.
Fußnoten
[1] Schmarotzerseerosen: Calliactis parasitica (Actinaria Actinaria – Hexacorallia – Anthozoa – Cnidaria – Animalia –…)
[2] Pagurus spp.: Einsiedlerkrebse (Decapoda – Eumalacostraca - Malacostraca – Crustacea – Thoracopoda – …)
[3] Schnecken: Gastropoda (Mollusca – Schizocoelia – Spiralia – Protostomia – Bilateria –…)
[4] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[5] Klebkapseln, Spirocysten: Deren umgestülpter Schlauch nach Explosion als gerades Stück aus der Cnide ragt, dem, spiralig nach rückwärts wickelnd, sich sein erheblich längerer Teil anschließt und mit klebriger Masse umgeben ist
[6] Fußscheibe: Der Anheftungsbereich des Polypenfußes ist flächig verbreitert
[7] Tentakel
[8] Schmarotzerseerosen
[9] Spezies: Art
Eingestellt am 23. November 2024
.

Actinaria, Seeanemonen:
5 Die Turnerin
.
Gemütlich steht sie[1] auf festem Grund,
Schwingt ihre Tentakel[2] hin und her,
Will Plankton[3] erhaschen damit.
Nicht schlecht diese Zeit! Hat nicht wenig Erfolg.
.
Etwas erhöht sitzt sie auf felsigem Grund,
Auf einer Schneckenschale, deren Einwohnerin längst schon tot;
Nicht den ganzen Fuß klebte sie fest,
Nur der Rand brachte ihr haltbaren Stand,
Wählte die Weise wohl mit Bedacht, denn
Schon kommt Ungemach an sie heran:
.
Ein Seestern[4] nähert sich!
Er hat das Gespür,
Dort vorne sitzt etwas für seinen Bauch,
Tastet sich langsam heran,
Schon hat er Kontakt,
Umgreift Coccinia[5]!
Dies aber leidet sie nicht!
Wackelt mit ihrem Zylinder hin und her,
Streckt sich, verschmälert sich,
Löst plötzlich von der Schale sich ab!
Der Seestern greift ins Leere nun,
Denn schon hat sie etwas Abstand erreicht!
Sie biegt sich seitlich zum U,
Schnellt sich wieder zurück,
Biegt gegenüber den Schopf hin zum Fuß,
Schnellt ihn wieder empor,
Wiederholt das Schnellen Zug um Zug,
Landet, vielleicht etwas erschöpft,
Weit entfernt,
Irgendwo
Seitlich auf festem Grund.
Richtet sich langsam empor,
Nachdem zuvor sie tief sich gebeugt,
Klebt den Fuß am Rand wieder fest.
Höchste Zeit, der Hunger bohrt!
Streckt Tentakel wieder ins Meer. –
.
Sechs Centimeter Höhe erreicht Coccinia,
Recht niedrig wirkt sie, zog sie die sechzig Tentakel zurück.
Lebt ab zehn Meter Tiefe in Subgezeitenzonen im
Nordatlantik, Nordpazifik, im arktischen Meer;
Minus ein Grad Celsius macht ihr nichts aus, liebt es eigentlich wärmer,
Doch mehr als zehn Grad schätzt sie nicht.
.
Fußnoten
[1] Stomphia coccinea (Actinaria – Hexacorallia – Anthozoa – Cnidaria – Animalia –…)
[2] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[3] Plankton: Gesamtheit der im Wasser freischwebenden oder mit geringer Eigenbeweglichkeit schwimmende, kleinere Organismen, deren Ortswechsel hauptsächlich durch Wasserströmungen vermittelt wird
[4] Seesterne: Asteroidea (Asterozoa – Eleutherozoa – Echinodermata – Ambulacraria – Deuterostomia –…)
[5] Stomphia coccinea
Eingestellt am 23. November 2024
.
.

Actinaria, Seeanemonen:
6 Auf Gegenseitigkeit (TP)
.
Warum sind sie wohl so riesig geworden, die Riesenaktinien[1]?
Fünfzig bis einhundertundfünfzig Centimeter misst das Feld um den Mund[2]!
Mineralien und Stickstoff ließen sie liefern,
Fischchen brachten sie frei ins Haus.
.
Sechs Arten gehören zu dieser Sippe.
Mit zwei Partnern leben sie alle zugleich:
Was sonst sie noch brauchen, tragen Seeanemonenfischchen noch bei,
Der Tentakel[5] Angelerfolg ist womöglich beinah zu vernachlässigen;
Sie besitzen zwar eine Menge davon,
Bei einigen Arten sind sie aber
Außergewöhnlich kurz, fleischig und zugespitzt.
.
Dreizehn Fischarten sind als Symbionten[6] der sechs Riesenaktinien bekannt,
Keine kommt ohne diese Beschützer aus;
Manche Stichodactylen[7] leben nur mit einer der Arten zusammen,
Andere jedoch akzeptieren mehr.
Nur eine Fischchenart aber findet pro Seeanemonenindividuum ihr Zuhause,
Verschanzt sich dort über Generationen hinweg.
.
Als bekanntestes Beispiel der Nesseltier-Fisch-Symbiosen
.
Obwohl Seeanemonen, wie es scheint, auch ohne Pomacentriden[10] überleben,
An den offenbar für sie recht schmackhaften Tentakeln,
So sind sie doch angewiesen auf ihre schützenden Partner, leben sie in freier Natur.
.
Nicht nur Schutz bieten sie vor gefräßigen Prädatoren[14],
Auch Parasiten[15] sollen sie fernhalten, wie man gelegentlich liest.
.
Clownfische bewohnen Seeanemonen als Pärchen
Oder in kleinen Gruppen mit einem Weibchen nur
– Wobei das dominante Männchen die Eier des Weibchens befruchtet –
Verteidigen gegen jeden zu nahe Kommenden ihre Tentakelwohnstatt aggressiv.
.
So achten aus gutem Grunde sie wenig ihr Leben,
Jagen aber nur in naher Umgebung Eindringlinge fort;
Fliehen, wenn nötig, rasch ins Tentakeldickicht wieder,
Zu neuen Vorstößen jederzeit bereit. –
.
Lange rätselten Wissenschaftler, warum keinen Schaden Seeanemonenfische nehmen,
Berühren sie Nesselzellen[16] im dichten Tentakelwald.
Heute aber wird immer mehr deutlich:
Sie schützen sich mit einem Film davor,
Den auch der Seeanemonen Tentakel verwenden,
Berühren sie auf Suche nach Beute sich selbst.
.
Vorsichtig, mit Bedacht, scheinen die Fischchen den schützenden Film sich zu holen,
Berühren, zunächst nur mit Flossen, wenn möglich nur einen einzigen Arm.
Werden dort sie beschossen, kümmert dies sie wohl wenig,
Doch der Film breitet sich ein wenig schon aus,
Immunisiert die nahe Umgebung;
So schwimmen Schritt für Schritt sie weiter bis auch der Kopf ist erreicht.
Wie wichtig die schützende Schicht für Tentakelwaldbewohner,
Erfahren Erkrankte und Schwache, werden sie doch, weil der Film ihnen wohl fehlt, verzehrt.SL
.
Fußnoten
[1] Riesenaktinien: Stichodactyla spp. (Actinaria – Hexacorallia – Anthozoa – Cnidaria – Animalia –…)
[2] Mundfeld, Mundscheibe: Bereich zwischen Mund und Tentakeln
[3] Zooxanthellen: Endosymbionten in einer Reihe von Lebewesen. Bei den Zooxanthellen handelt es sich meistens um Dinoflagellaten; aber auch um Chrysomonden, Cryptomonaden oder Diatomeen kommen vor
[4] Fotosynthetisch (Fotosynthese): Umwandlung von Lichtenergie in Energie organischer Moleküle. Dabei wird letztlich CO2 über komplexe Vorgänge zu energiereicher Glucose aufgebaut. Mit Hilfe von Chlorophyll (Licht!), erzeugtem ATP (zyklischer Elektronentransport) und NADPH2 (azyklischer Elektronentransport) werden von Zellen Zucker synthetisiert
[5] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[6] Symbionten: Organismen, die wechselseitig zu beiderseitigem Vorteil sich nehmen; auch als wechselseitige Parasiten verstehbar
[7] Stichodactyla: Riesenaktinien
[8] Clownfische: Amphiprion sp spp. (Pomacentridae – Labroidei – Perciformes – Percomorpha – Acanthopterygii –…)
[9] Mertens Riesenaktinie: Stichodactyla mertensii (Actinaria – Hexacorallia – Anthozoa – Cnidaria – Animalia –…)
[10] Pomacentridae: Riffbarsche (Labroidei – Perciformes - Percomorpha – Acanthopterygii – Acanthomorpha –…)
[11] Falterfische: Chaetodontidae; nicht behandelt
[12] Feilenfische: Monacanthidae; nicht behandelt
[13] Zackenbarsch: Epinephelidae; nicht behandelt
[14] Prädatoren: Organismen, die andere zum Zweck der Nahrungsaufnahme nutzen und dabei meist töten. Das Opfer eines Prädators ist dessen Beute.
[15] Parasit, Schmarotzer: Ein Organismus lebt auf Kosten eines anderen.
[16] Nesselzellen, Cnidocyten: Zellen in der Epidermis der Cnidaria, zum Beutefang und zur Abwehr dienend; bei Reizung wird ein Nesselschlauch ausgeschleudert, der häufig ein hochwirksames Gift in das Opfer injiziert
Eingestellt am 23. November 2024
.

Oben: Stichodactyla mertensii mit Clownfisch with Amphiprion sandaracinos
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anemone_with_Clownfish.jpg
Autor: Silke Baron
Lizenz: Creative Commons Attribution 2.0 Generic license; unverändert
Unten: Riesenseeanemone (Stichodactyla gigantea) mit Amphiprion ocellaris
Autor: Michael arvedlund
Lizenz: public domain; unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
.
.

Alcyoniidae, Lederkorallen:
1 Des Menschen Phantasie
.
Phantasievoll sind oft des Menschen Gedanken,
Sieht in der Natur er etwas, was in anderer Weise vielleicht er besser schon kennt,
Belegt er das Neue mit ähnlichem Namen, den das Bekannte schon hatte.
So geschah es mit einer Koralle, die heute als Tote-Mannshand[1] bekannt.
.
Handförmig verzweigt ist sie, manchmal einem Klumpen recht ähnlich,
Zehn Centimeter hoch, vielleicht etwas mehr,
Weiß, gelblich, fahl, auch hellorange, rosa,
Ragt auf festem Substrat empor,
Nimmt wahllos Dosen, Flaschen, versunkene Schiffe;
Daher wohl seine etwas makabre Assoziation!
.
Reinweiß erscheinen Polypen[2], strecken sie sich und breiten die Arme,
Zurückgezogen aber hebt die Koralle sich kaum vom Untergrund ab,
Wirkt auch erheblich kleiner, weil ohne Wasser ihre Kanäle,
Dehnt und streckt sie sich,
Treten Schlauchpolypen[3] in Aktion.
Kleine Kalknadeln[4] festigen Alcyonium-Korallen.
Diese Art der Gattung kommt ohne Zooxanthellen zurecht.
.
Von August bis Dezember ruh‘n sie in eingezogenem Zustand,
Bereiten, Reserven nutzend, die Fortpflanzung vor,
Übergeben Dezember erhebliche Mengen Spermien und Eier dem Wasser,
Danach fischen wieder sie Plankton aus Hunger, was das Meer so gibt.
.
In der Nordsee, im europäischen Atlantik bis zum Nordkap,
Im Ärmelkanal, in der westlichen Ostsee, kommt sie vor,
Lebt in Tiefen ab etwa zwanzig Metern,
Gar auf Muschelbänken im Watt;
Galt früher als eine der häufigsten Kaltwasserkorallen,
War oft bedeutender Beifang der Grundnetzfischerei.
Warf nicht, was aus Versehen die Fischer gefangen,
Wieder zurück ins Meer,
Trocknete es vielmehr, mahlte die Äste,
Brachte das Mahlgut als stickstoff-, phosphat- und kaliumreichen Dünger aufs Feld.
.
Fußnoten
[1] Tote-Mannshand: Alcyonium digitatum (Alcyoniidae – Malacalcyonacea – Octocorallia – Anthozoa – Cnidaria –…)
[2] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.
[3] Schlauchpolypen, Siphonopolypen: (Fast) tentakellose Polypen, die nur der Wasserversorgung und dem Wasseraustausch für Sauerstoffgewinnung dienen
[4] Sclerite, Scleren, Spicula: Oft nadelförmige Gebilde
Engestellt am 23. November 2024
.

Tote-Mannshand, Alcyonium digitatum
Autor: Haplochromis
Lizenz: GNU Free Documentation License, Version 1.2; unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
.

Anthozoa, Blumentiere:
1 Mehrfach vorgesorgt
.
Als artenreichste Klasse der Nesseltiere[1]
Erreichen sie, obwohl ihnen Medusen[2] fehlen, hohe Diversität,
Sind rein marin verbreitet; im Brackwasser[3] kommen nur wenige vor.
Zu rezenten Vertretern kommen noch viele fossile,
Spezielle Merkmale des basalen Kalkskeletts erwiesen dabei sich überraschend informativ.
.
Ausgesprochene Vielfalt im inneren Bau der Polypen[8],
Ihre Lebensweise als Einzeltiere und ihrer oft riesigen Kolonien Gestalt,
– Meist als zusammenhängender Tierstock[9] gebildet
Der über allseits genutzte Gewebe vereint –
Erlauben, sie in einzelne, oft gut definierte Sippen zu trennen;
.
Das zwei bewimperte Rinnen, von den Winkeln nach unten ziehend, trägt,
Nahrungsaufnahme und Defäkation[18] zu erleichtern,
Wasseraustausch zu regulieren, auch den inneren Druck,
Den Polypen steif und in Form zu halten,
Fehlt ihm etwa ein mineralienfestes Skelett.
.
Der Tentakel Hohlräume steh’n mit je einer Bauchraumtasche in direkter Verbindung, die
Beidseits von Mesenterien[19] begrenzt,
An denen längsverlaufende, zum Teil sich freibewegende Wülste[20] sitzen,
.
Vor allem größere, dem Gastralraum[23] zugeführte Beute
Wird dort von Nesselkapseln[24] fixiert,
In Drüsenzellnähe gehalten
Und durch Kontakt schneller verdaut.
Cilien[25] sorgen für Verteilung der Nährstoffe,
So werden sie aufgenommen fast ohne Verzug.
.
Ein normales Cilium setzen Anthozoa als
Abzug ein für der Nesselkapseln Schuss;
Kein oder ein dreiteiliger Deckel schließt die Kapsel;
Einteilig ist er bei anderen Nesseltieren jedoch.
.
Bei extraintestinaler[26], extrakorporaler Verdauung, skelettbildenden Arten von großer Bedeutung,
Werden Gastralfilamente aus der Mund-After-Öffnung gestreckt,
Umhüllen damit von Tentakeln ergatterte Beute,
Verdauen sie, danach werden Verdauungsprodukte über die Öffnung eigesaugt.
.
Unter der Mundscheibe[27] liegt ein ringförmiger Schließmuskel;
Experten führ’n ihn auf lokal modifizierte entodermale[28] Muskulatur zurück.
Den Mundraum zu schließen, scheint Blumentieren geraten,
Wie auch Mesenterialmuskelstränge Polypen zusammenzieh’n.
.
Kalkleisten können, in Mesenterien abgeschieden, von Fußscheiben[29] ausgehend,
Polypen Stabilität verleihen, Widerstandsfähigkeit und, bilden basal sie Gehäuse, Schutz;
Färben oft intensiv Gewebe und die Skelette,
Meist tragen Carotinoide[30] Verantwortung dafür.
.
Fußnoten
[1] Nesseltiere: Cnidaria (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)
[2] Medusen, Quallen (Cnidaria): Ein freischiwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere
[3] Brackwasser: In Mündungsgebieten und in Strandseen sich bildendes Gemisch aus Salz- und Süßwasser
[4] Ordoviz-Zeit: vor ca. 485 – 443 Millionen Jahren
[5] Perm-Zeit: vor etwa 299 – 251 Millionen Jahren
[6] Trias-Zeit: vor etwa 251 – 199 Millionen Jahren
[7] Muschelkalk: Die fossilreichen Gesteine dieser Einheit enthalten nicht nur Muscheln, sondern vor allem die den Muscheln äußerlich ähnlichen Brachiopoda bzw. deren massenhaft neben- und übereinandergeschichtete Bauch- und Rückenschalen. Der Ablagerungszeitraum des Muschelkalks erstreckt sich etwa auf den Zeitraum vor 243 bis 235 Millionen Jahren
[8] Polypen (Nesseltiere): Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.
[9] Tierstock: Aussehen einer Kolonie, doch sind die einzelnen Individuen über ein gemeinsames Gewebe verbunden, unterscheiden sich darin von Kolonien, die durch dichte Siedlung einzelner Individuen gekennzeichnet sind.
[10] Symbiose, symbio(n)tisch: wechselseitiges Nehmen zu beiderseitigem Vorteil; auch als wechselseitiger Parasitismus verstehbar
[11] Zooxanthellen: Endosymbionten in einer Reihe von Lebewesen. Bei den Zooxanthellen handelt es sich meistens um Dinoflagellaten; aber auch um Chrysomonden, Cryptomonaden oder Diatomeen kommen vor
[12] Radiärsymmetrisch: Durch einen Gegenstand, Organismus oder Organismenteil lassen sich mehr als zwei Symmetrieebenen legen
[13] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[14] Mund-After-Öffnung: Körperöffnung, die zugleich als Mund und After verwendet wird
[15] Bilateralsymmetrisch: Spiegelbildsymmetrisch
[16] Ektoderm: Äußeres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation außen verbliebene Zellschicht der Blastula
[17] Pharynx: Schlundrohr, das sich von der Mund-After-Öffnung bis zum Magenraum erstreckt
[18] Defäkation: Entleerung, Entfernung von Unverdaulichem
[19] Mesenterien: Scheidewände im Innern von Polypen, die den Gastralraum aufteilen
[20] Gastralfilamente: Wulste von Mesenterien, oft nur als Fäden an ihnen hängend
[21] Cnidocyten: Nesselkapseln bildende Zellen
[22] Drüsenzellen: Zellen, die der Produktion und Abgabe (Sekretion) bestimmter Substanzen dienen
[23] Gastralraum (Schwämme, Nesseltiere): Großraum nahe des Osculums, des Mund-Afters, in den alle zuführenden engeren, dann weiteren, wasserführenden Kanäle oder Taschen münden
[24] Nesselkapseln: In Nesselzellen gebildete, kapselartige Gebilde, die bei Reizung der Nesselzellen ihr schlauchartiges Fangorgan hervorschleudern
[25] Cilie, Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.
[26] Extraintestinal: Außerhalb des Verdauungsraums; außerhalb des Körpers, extrakorporal
[27] Mundscheibe: Bereich zwischen Mund-After-Öffnung und Tentakelkranz
[28] Entoderm: Inneres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation nach innen gebrachte Zellschicht der Blastula
[29] Fußscheibe, Fußplatte: Der flächig verbreiterte Anheftungsbereich des Fußes
[30] Carotinoide: Carotinoide sind lineare Kohlenwasserstoffe mit vielen konjugierten Doppelbindungen (= benachbarte Kohlenstoffatome sind in wechselnder Abfolge mit einer einfachen und einer Doppelbindung miteinander verknüpft), an deren beiden Enden jeweils ein Kohlenstoffring aus sechs Atomen hängt. Je nach Lage einer Doppelbindung in diesen Sechserringen und ob eine Hydroxylgruppe [–OH] oder andere zusätzliche Gruppen an Sechserringen hängen, werden verschiedene Typen an Carotinoiden unterschieden, die auch in ihrer Färbung voneinander abweichen und somit Licht anderer Wellenlängen aufnehmen können; nicht selten nur als Farbstoff vorhanden.
Eingestellt am 23. November 2024
.
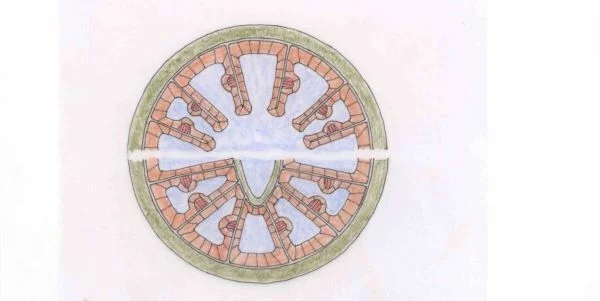
Querschnittschema des Polypen von Anthozoa (Tusche und Kreide; Reinhard Agerer)
Oben durch den Zentralmagen, unten durch die Schlundregion. Schlund zur Ellipse gezogen. Von seinen Winkeln ausgehend, verlaufen die Siphonoglyphen nach unten und zwischen jenen Mesenterien, deren Gastraltasche die Retraktormuskeln nach außen zeigt, alle übrigen Gastraltaschen richten sie zueinander; der Siphonoglyphen benachbarte Mesenterien werden als Richtungssepten bezeichnet.
Epidermis (grün), Mesogloea (grau), Gastrodermis (orange), Retraktormuskeln (rot), Pharynx und Gastralraum (blau).
Nach Westheide & Rieger (2013), Seite 121, Abb. 188
Eingestellt am 23. November 2024
.

Ceriantharia, Zylinderrosen:
1 Selbsterrichtete Wohnkammer
.
Auf weichen Böden, wie Sand und Schlick, finden sie Heimat und
Bauen sich selbst eine Wohnröhre, die hinab in den Untergrund reicht!
Bis zu einem Meter Tiefe kann sie sich ziehen;
Gefahr zum Einsturz besteht aber nicht,
Denn lederartige Wandung stabilisiert innen die Röhre,
Aus Schleim, feinen Bodenpartikeln und Cniden[1] zusammengeklebt.
.
Zieh’n sich, wenn Gefahr, blitzschnell zurück in die Röhre,
Von der Epidermis[2] umfangreicher Längsmuskulatur bewirkt.
Der Mesenterien[3] Zusammenziehen hülfe zu wenig,
Sind ihre Muskelstränge doch einzeln nur und im Innern des Körpers verteilt.
So wurden sie nach dem Prinzip der Sparsamkeit
Evolutiv konsequent reduziert.
.
Blitzschnelles Verkürzen muss intensivem Druck entgegenwirken,
Von Wasser zum Aufrechterhalten der Form etabliert;
Zu klein wäre die Mund-After-Öffnung[4] wohl, das Wasser
Schnellstmöglich aus dem Raum zu entfernen, damit der Körper schnell sich verkürzt.
So kann es physikalisch und evolutiv Denkenden kaum mehr verwundern,
Dass am Fußende des Polypen[5] eine Spritzöffnung wirkt.
.
Zweierlei Arten Tentakel[6] schmücken Zylinderrosen:
Lange, überlang erscheinende Arme am Mundfeldrand
Breiten sich wie eines Springbrunnens Strahlen nach außen.
Lugt der Polyp aus der Röhe hervor,
Fallen sie, in ein bis vier Kreisen stehend,
Weitbogig über den Untergrund hin.
Ein Polyp von zwei Centimeter Körperdurchmesser
Belegt dann einen Keis von sechzig Centimetern rund um sich.
.
Verschwindet der Träger in der Behausung,
Zieht er sie bis auch die letzte Spitze verschwindet, zügig sich nach,
Denn die Tentakel sind nicht in der Lage, sich schnell zu verkürzen,
Was für die Länge der Wohnröhre spricht.
Mundtentakel, entschieden kürzer und geringer an Zahl als die randlichen Partner,
Steh‘n unmittelbar am Rand des Munds[7].
.
Als Zwitter[8] können sie ihr Geschlecht auch wechseln;
Pflanzen sich, aber selten, auch ungeschlechtlich fort.
Larven leben lange pelagisch[9],
Besitzen bereits einen Mund[10],
.
Später noch kurze Tentakel, die erheblich länger schnell werden,
Zweireihig und wie bei Erwachs‘nen gestellt.
.
Fußnoten
[1] Cniden: Nesselkapseln
[2] Epidermis: Außenschicht eines Tieres
[3] Mesenterien: Scheidewände im Innern von Polypen, die den Gastralraum aufteilen
[4] Mund-After-Öffnung: Körperöffnung, die zugleich als Mund und After verwendet wird
[5] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.
[6] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[7] Mund-After-Öffnung
[8] Zwitter: Weibliche und männliche Gameten befinden sich auf ein und demselben Individuum, müssen aber nicht zur gleichen Zeit zur Reife kommen
[9] Pelagisch: schwimmend, schwebend
[10] Mund-After-Öffnung
Eingestellt am 23. November 2024
.

Ceriantharia membranacea, Zylinderrose
Autor: unbekannt
Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 1.0 Generic license; unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
.

Clavulariidae, Keulenkorallen:
1 In einiger Hinsicht ursprünglich
.
Polypenstöcke[1] charakterisieren diese Familie, die
Nur durch bandförmig angeordnete Stolonen[2] verknüpft,
Somit fehlt durchgehend eine Achsenverstärkung;
Ihre Polypen[3] erweisen sich undifferenziert
Zieh’n, wenn irritiert, sich in chitinhaltige[6] Kelche zurück.
.
Frei oder miteinander verwachsen können die Fiedern[9] jedoch sein,
Ähneln Blättern oder auch Paddeln, wenn sie verbunden;
Polypen sind von Blättchen-, Stäbchen- oder Schuppenscleriten[10] verstärkt:
In Stolonen und Kelchen glatt oder höckrig,
Zu Klumpen vereint in Stolonen oft.
.
Sind angewiesen auf der Symbionten energie- und baustoffliefernde Art.
.
Zu den buntesten Arten gehören Clavariidae, eine Familie, die
Indopazifisch, bei Indonesien, Philippinen, Melanesien[14] und Nordau
.
Fußnoten
[1] Polypenstock: Aussehen einer Kolonie, doch sind die einzelnen Individuen über ein gemeinsames Gewebe verbunden, unterscheiden sich darin von Kolonien, die durch dichte Siedlung einzelner Individuen gekennzeichnet sind
[2] Stolonen: Basale, hohle Ausläufer, die benachbarte Polypen miteinander verbinden
[3] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.
[4] Schlauchpolypen, Siphonopolypen: (Fast) tentakellose Polypen, die nur der Wasserversorgung und dem Wasseraustausch für Sauerstoffgewinnung dienen
[5] Nährpolypen, Fresspolypen: Typische, mit Fangtentakel versehene, sich mit Beute versorgende Polypen
[6] Chitin: Polymer aus N-Acetyl-Glucosamin, entstanden aus 1,4-β-Glucosen, an deren C2 eine [–NHCOCH3]-Gruppe hängt; anders ausgedrückt, an deren C2 eine [–NH2]-Gruppe, eine Aminogruppe, hängt, bei der ein Wasserstoffatom durch ein Acetat [CH3COO–] ersetzt ist. Zellwandpolysaccharid der Fungi (Echte Pilze), einiger Cnidaria (Nesseltiere) und Exoskelett der Arthropoda (Gliederfüßer)
[7] Gefiedert: Organ, das Fiedern trägt
[8] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[9] Fiedern (allgemein): Seitenstrahlen meist gleicher Gestalt einer gemeinsamen Achse entlang
[10] Sclerite, Scleren, Spicula: Oft nadelförmige Gebilde
[11] Zooxanthellen: Endosymbionten in einer Reihe von Lebewesen. Bei den Zooxanthellen handelt es sich meistens um Dinoflagellaten; aber auch um Chrysomonden, Cryptomonaden oder Diatomeen kommen vor
[12] Obligat: unerlässlich, erforderlich
[13] Symbiose, symbio(n)tisch: wechselseitiges Nehmen zu beiderseitigem Vorteil; auch als wechselseitiger Parasitismus verstehbar
[14] Melanesien: Besteht aus fünf Ländern: Indonesien, Papua-Neuguinea, Fidschi, den Salomonen und Vanuatu, sowie dem Territorium Neukaledonien
Eingestellt am 23. November 2024
.

Clavularia crassa
Autor: Parent Géry
Lizenz: Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication; unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
.

Corallinidae, Echte Korallen:
1 Die Kostbarste
.
Ohrringe, rote, korallenrote von Eurostückgröße,
Hängen an Ohrläppchen der vornehmen Frau,
Der Kenner Blicke an sich zu ziehen;
Doch wer kennt heut noch Korallen von Modeschmuck weg?
.
Stammten von Riesenkorallen, die im Mittelmeer von Felsen gebrochen,
Aus Zeiten als Korallenbänke[1] noch nicht so überfischt,
Noch nicht mit Stangen und Netzen und Taucherausrüstung
Auch noch die dünnsten nach oben geholt.
.
Doch die kostbaren Korallen, mit leuchtendem Rot gingen der Dame verloren!
Unerschwinglich erweis sich tröstender Kauf.
Kein entsprechendes Rot mehr ließ sich finden,
Nur in hellem und in fast bräunlichem Ton
Lagen welche, wofür ihr Portemonnaie[2] bereit war, zu geben.
Nun griff sie doch, was zuvor sie verpönte, zum korallenroten Modeschmuck.
.
Fußnoten
[1] Korallenbank, Korallenriff: Große, festgefügte Formation von Korallen im Meer
[2] Portemonnaie: Geldbörse
Eingestellt am 23. November 2024
.

Corallinidae, Echte Korallen:
2 Der Korallenstock
.
Unregelmäßig und spärlich verzweigt steht Rubrum[1]
Daumengroß bis ellenlang am felsigen Grund;
Bis zu drei Centimeter kann, wenn älter, die Basis werden,
Auf drei bis fünf Millimeter dünnt ihre Spitze aus.
.
Die kalkigen Äste sind aus kalkverbund‘nen Scleriten[2] entstanden:
Variabel ihre Gestalt,
Oval, spindelig, strahlig, keulig.
Zinnoberrot, Dunkel- bis Leuchtendrot steht der steifragende steinharte Strauch,
Selten auch pink oder weißlich,
Wie auch das dünne Coenenchym[3], der Äste Bezug.
.
Herrlich kontrastreich heben sich weiße,
Nahezu transparente Polypen ab,
Zwei bis acht Millimeter wachsen in Länge nur diese Kostbaren pro Jahr.
.
Lichtscheu sind sie, wie immer wieder berichtet,
Gönnen gerne sich schattige Plätzchen, denn Zooxanthellen[6] kennen sie nicht;
In flacherem Wasser steh’n sie bevorzugt in Höhlen,
Freistehend in schwachem Licht nur, von Überhängen und Spalten geschützt.
.
Sitzen dichtgedrängt an engen Stolonen[9] am Rande des Coenenchyms.
.
Eizellen werden in Polypen befruchtet,
Bleiben, bis sie Planula[10] geworden, in der Mutter Schutz,
Leben einige Tage planktontisch[11], etwas entfernt sich anzusiedeln,
Setzen danach als Primärpolypen[12] sich fest,
Erste Sclerite werden zur Achse verbunden,
Stolonen durchzieh’n das Coenenchym,
Immer mehr der Polypen knospen, werden mit der Zeit rötlich,
.
Von vierzig bis einhundert Metern Tiefe
Finden normal sie den Aufenthaltsort;
Kommen in westlichem und zentralem Mittelmeer vor, sowie im angrenzenden Atlantik:
An Portugals, an Marokkos Küsten, an den Kanaren, an den Kapverden sogar. –
.
Womöglich hätte die tiefenttäuschte Dame doch besser Ausschau gehalten nach
Neuem Korallenschmuck pazifischer Arten und dortiger Produktion.
Erschwinglicher wären vielleicht sie gewesen.
Doch wer lässt sich schon hohe Gewinne entgeh’n?
.
Fußnoten
[1] Corallium rubrum: Edelkoralle (Corallinidae – Der Scleralcyonacea Rest – Scleralccyoacea s. l. – Octocorallia – Anthozoa – …)
[2] Sclerite, Scleren, Spicula: Oft nadelförmige Gebilde
[3] Coenenchym: Dicke Gewebeschicht als gemeinsame Lebensbasis von Polypen, ohne im Inneren ein Skelett zu bilden.
[4] Oktokorallen: Octocorallia (Anthozoa - Cnidaria – Animalia – Opisthokonta – Eukarya)
[5] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[6] Zooxanthellen: Endosymbionten in einer Reihe von Lebewesen. Bei den Zooxanthellen handelt es sich meistens um Dinoflagellaten; aber auch um Chrysomonden, Cryptomonaden oder Diatomeen kommen vor
[7] Schlauchpolypen, Siphonopolypen: (Fast) tentakellose Polypen, die nur der Wasserversorgung und dem Wasseraustausch für Sauerstoffgewinnung dienen
[8] Nährpolypen, Fresspolypen: Typische, mit Fangtentakel versehene, sich mit Beute versorgende Polypen
[9] Stolonen: Basale hohle Ausläufer, die benachbarte Polypen miteinander verbinden
[10] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria
[11] Als Plankton
[12] Primärpolyp, Stammpolyp: Polyp, der sich als erster ansiedelt, um, nach und nach sich verzweigend, sich mit weiteren Polypen zu versehen
[13] Zooplankton: Gesamtheit der im Wasser freischwebenden oder mit geringer Eigenbeweglichkeit schwimmende, tierische Organismen, deren Ortswechsel hauptsächlich durch Wasserströmungen vermittelt wird
[14] Carotinoide: Carotinoide sind lineare Kohlenwasserstoffe mit vielen konjugierten Doppelbindungen (= benachbarte Kohlenstoffatome sind in wechselnder Abfolge mit einer einfachen und einer Doppel-bindung miteinander verknüpft), an deren beiden Enden jeweils ein Kohlenstoffring aus sechs Atomen hängt. Je nach Lage einer Doppelbindung in diesen Sechserringen und ob eine Hydroxylgruppe [–OH] oder andere zusätzliche Gruppen an Sechserringen hängen, werden verschiedene Typen an Carotinoiden unterschieden, die auch in ihrer Färbung voneinander abweichen und somit Licht anderer Wellenlängen aufnehmen können; nicht selten nur als Farbstoff vorhanden.
Eingestellt am 23. November 2024
.
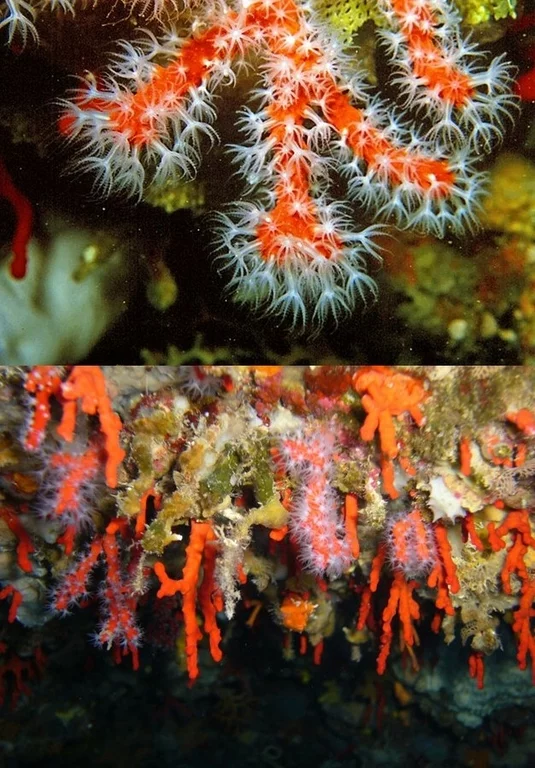
Oben: Edelkoralle, Corallium rubrum
Autor: Géry Parent
Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert
Unten: Edelkoralle, Corallium rubrum
Autor: Yoruno
Lizenz: Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 nicht portiert“; unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
.

Der Scleralcyonacea Rest:
1 Der DNA zuliebe
.
Der DNA zuliebe steh‘n die andern Familien separat von Federkorallen des weiteren Sinnes[1],
Doch alle Familien besitzen deren entscheidendes Merkmal nicht:
Bleiben oberflächlich auf den Substraten sitzen,
Zwangsläufig, weil der Grabfuß[2] ihnen doch fehlt.
Zwei der vielen Familien werden hier nur behandelt,
Eine wegen ungewöhnlicher Bläue, die andere, weil sie uns Menschen besonders interessiert.
.
Fußnoten
[1] Pennatulacea (Scleralcyonacea s. l. – Octocorallia – Anthozoa – Cinidaria – Animalia – …)
[2] Grabfuß: Primärpolypen einiger Korallenstöcke können sich mit Hilfe ihrer verlängerten Basis durch An- und Abschwellen in weiches Substrat eingraben
Eingestellt am 23. November 2024
.

Funiculinidae, Seepeitschen:
1 Seepeitsche
.
Wie eine Peitsche[1], deswegen der Name,
Zwei Meter lang, steckt im Boden noch ein Viertel davon.
Einen Stab aus Kalk bildet die Achse,
Reicht nicht zur Spitze, damit die Peitsche oben biegsam noch bleibt.
.
Obenauf in zwei reihen sitzen der Peitsche Polypen,
Vielleicht verständlich aus des Tierstocks[6] Organisation,
Denn nur wenig ändert sich Funiculinas Größe,
Wenn überhaupt zu oder ab sie nimmt;
Auch die Kanäle[7] sind dünn und nur wenige,
Wozu dann Polypen ernähren, die für die andern kaum etwas tun?
.
Nur einmal im Jahr bildet der Individuen Hälfte Eier,
Die anderen Spermien zuhauf;
Wie auch Polypen dazu im Jahr sich nur einmal entscheiden,
Doch warum diese Beschränkung, ist derzeit nicht klar.
.
Global verbreitet ist Quadrangularis[8],
Geht bis hinauf ins arktische Meer,
Wird bis zu dreieinhalbtausend Meter Tiefe gefunden,
Fühlt sich von einem bis zweiundzwanzig Grad Celsius wohl.
.
Fußnoten
[1] Seepeitsche: Funiculina quadrangularis (Funiculinidae – Pennatulacea – Scleralcyonacea s. l. – Octocorallia – Anthozoa – …)
[2] Schlauchpolypen, Siphonopolypen: (Fast) tentakellose Polypen, die nur der Wasserversorgung und dem Wasseraustausch für Sauerstoffgewinnung dienen
[3] Nährpolypen, Fresspolypen: Typische, mit Fangtentakel versehene, sich mit Beute versorgende Polypen
[4] Fiedern: Seitenstrahlen meist gleicher Gestalt einer gemeinsamen Achse entlang
[5] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[6] Tierstock: Aussehen einer Kolonie, doch sind die einzelnen Individuen über ein gemeinsames Gewebe verbunden, unterscheiden sich darin von Kolonien, die durch dichtes Siedeln einzelner Individuen gekennzeichnet sind.
[7] Kanäle, Hohlräume, der lang ausgezogenen Polypenbasen
[8] Funiculina quadrangularis
Eingestellt am 23. November 2024
.
.

Gorgoniidae, Weichkorallen i.e.S.:
1 Ordentlich
.
Verjüngt an der Basis, weiterwerdend nach oben hin,
Netzartig die Zweige miteinander verflochten oder gefiedert[3]
In der Gestalt eines Blatts.
.
Eine zentrale, proteinhaltige[4] Achse stabilisiert die Koralle
– Als Gorognin[5] unter Fachkreisen bekannt –
Hohl im Innern, Biegestabilität zu erhalten,
Doch Querwände trennen gereihte Kammern ab.
.
Die ihnen – oder daran gebildete Kelche – Rückzug gewähr‘n;
Besetzen die ganze Korallenstockfläche oder sind
Lediglich an zwei Astseiten gereiht.
.
Wohl mit der Achse Stabilität, des Coenenchyms Dünne begründet,
Sparten Gorgoniidae Schlauchpolypen[8] vollkommen ein;
Kein innerer Wasserdruck hält die Polypengemeinschaft aufrecht.
Zur Nahrungsbeschaffung wird alles verpflichtet, was Polyp[9] sich nennt.
.
Abgeflachte Stäbchen nur lassen in den Polypen sich finden,
Gezackt, gelappt oder gekerbt ihr Rand;
Das Coenenchym hingegen bevorzugt räumlich geformte Sclerite[10],
Strahlenförmig sind sie, oder Spindeln mit komplexen Tuberkeln[11], die regelmäßig daran gereiht.
Tragen auffällige Farben bei vielerlei Arten.
.
Der Venusfächer[14] ist seiner Bizarrheit wegen
Aus der Familie besser bekannt:
Wie ein Fächer steht aufrecht er auf festem Boden,
Zusammengesetzt aus ebenem Netz,
In dem einige Hauptstrahlen, basisnah ausgehend,
Halten die Maschen stabil empor.
.
Abgeflacht eckig gestalten sich des Fächers Strahlen;
Anderer Arten Ästchen zeigen sich abgeflacht oder rund.
Weiß, gelblich oder lavendelfarben steht der Venusfächer
Einmeterundfünfzig hoch und breitseits zu Wellen zumeist.
.
Fußnoten
[1] Planar: eben, in einer Ebene
[2] Tierstock: Aussehen einer Kolonie, doch sind die einzelnen Individuen über ein gemeinsames Gewebe verbunden, unterscheiden sich darin von Kolonien, die durch dichtes Siedeln einzelner Individuen gekennzeichnet sind.
[3] Gefiedert: Organ, das Fiedern trägt
[4] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt, das zweite der beiden benachbarten den Aminosäurerest
[5] Gorgonin: Besonders gestaltetes Protein
[6] Nährpolypen, Fresspolypen: Typische, mit Fangtentakel versehene, sich mit Beute versorgende Polypen
[7] Coenenchym: Dicke Gewebeschicht als gemeinsame Lebensbasis von Polypen, ohne im Inneren ein Skelett zu bilden.
[8] Schlauchpolypen, Siphonopolypen: (Fast) tentakellose Polypen, die nur der Wasserversorgung und dem Wasseraustausch für Sauerstoffgewinnung dienen
[9] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet
[10] Sclerite, Scleren, Spicula: Oft nadelförmige Gebilde
[11] Tuberkel: Höckerförmige Erhebung
[12] Zooxanthellen: Endosymbionten in einer Reihe von Lebewesen. Bei den Zooxanthellen handelt es sich meistens um Dinoflagellaten; aber auch um Chrysomonden, Cryptomonaden oder Diatomeen kommen vor
[13] Symbiodinium sp.: Dinophyceae (Dinoflagellata – „Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)
[14] Venusfächer: Gorgonia flabellum (Gorgoniidae – Malacalcyonacea – Octocorallia – Anthozoa – Cnidaria –…)
Eingestellt am 23. November 2024
.
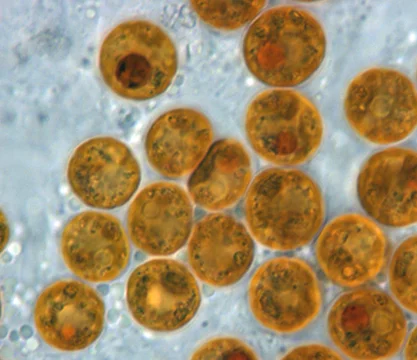
Symbiodinium (eine Zooxanthelle)
Autor: Allisonmlewis
Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
.

Gorgonia flabellum, Venusfächer
Autor: Fernando Herranz Martín
Lizenz: GNU General Public License, unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
.

Helioporidae, Blaukorallen:
1 Immer höher hinauf (TP)
.
Ein Millimeter Durchmesser genügt ihnen selbst dafür,
Belegen es dicht mit Aragonit[3], formen das Ganze zur ebenen Platte;
Stolonen bilden zuvor noch Senker, damit,
Ja, warum wohl? lässt berechtigt sich fragen.
Wo findet sich jemand, der treffende Antwort uns gibt?
.
Nach oben wollen Polypen sich weiterentwickeln,
Fühlen unterhalb sich schon viel zu viel Kalk,
Trennen die Senker, die eigene Röhre,
Mit horizontalen Kalkplatten ab.
.
Bedecken bereits wieder die oberste Lage mit
Dünner Schicht Coenenchym[4] sowie mit Röhren der nächsten Stolonengeneration.
So schieben sie weiter nach oben den dünnen, gemeinsamen Körper,
Immer weiter dem entgegen, was Leben und Nahrung verspricht.
.
Haben die Zwerge Platz und Raum einmal gefunden,
Vielleicht zwischen hochgeschossener Konkurrenz
Auf Korallenriffen, die gerne zur Heimat sie wählen,
Nötigt Lichtbedarf ihrer Zooxanthellen[5],[6] sie dazu,
Nach oben zu kommen; Kalk spielt keine begrenzende Rolle,
Bauen aus Aragonit ein massives Gerüst,
Verbacken nicht bereits geformte individuelle Sklerite[7],
Denn ihr feinporiges Schichtsystem spart Material.
Fünfzig Centimeter dick oft liegt ihr poröses
Blocksystem, das an Rändern mitunter besonders gut wächst.
Gelegentlich entstehen Mikroatolle[8],
Denn Erosionen gaben der Blöcke Zentren zwangsläufig frei.
.
Der Helioporiden Blöcke sind seit der Kreidezeit[9],
Von vor etwa einhundert Millionen Jahren, bekannt.
Möglicherweise hat Heliopora coerulea[10]
Als einzige Art bis heut überlebt.
Auch die Familie ist monotypisch[11];
Die eigene Ordnung[12], die zuvor man ihr gönnte, zog die Wissenschaft ein.
.
Dort, wo sie lebt, ist Eisen wohl keine Mangelware,
Denn Eisensalze sind für die Blaufärbung Grund.
Fasziniert sind Menschen von dieser Farbe;
So fertigen sie, was wunder, aus Helioporid[13] sich Schmuck.
Bei Temperaturen von zweiundzwanzig Grad leben sie bestens;
Unklar ist, ob sie es schert, wenn Meerwasser wärmer wird.
.
Fußnoten
[1] Stolonen: Basale hohle Ausläufer, die benachbarte Polypen miteinander verbinden
[2] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.
[3] Aragonit: [Calciumcarbonat, CaCO3]; Mineral der wasserfreien Carbonate ohne fremde Anionen, kristallisiert im orthorhomischen Kristallsystem mit der chemischen Zusammensetzung Ca[CO3]; https://www.chemie.de/lexikon/Calcit.html; nähere Erklärung dort
[4] Coenenchym: Dicke Gewebeschicht als gemeinsame Lebensbasis von Polypen, ohne im Inneren ein Skelett zu bilden.
[5] Zooxanthellen: Endosymbionten in einer Reihe von Lebewesen. Bei den Zooxanthellen handelt es sich meistens um Dinoflagellaten; aber auch um Chrysomonden, Cryptomonaden oder Diatomeen kommen vor
[6] Dinoflagellaten: Dinophyta („Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)
[7] Sclerite, Scleren, Spicula: Oft nadelförmige Gebilde
[8] Atoll: Aus einem ringförmigen Riff und einer Lagune bestehende Koralleninsel tropischer Meere
[9] Kreide-Zeit: vor ca. 145 – 66 Millionen Jahren
[10] Heliopora coerulea: Blaue Koralle (Helioporidae – Der Scleralcyonacea Rest – Scleralccyoacea s. l. – Octocorallia – Anthozoa – …)
[11] Monotypisch: Nur eine Art im Taxon (Gattung, Familie, etc.)
[12] Helioporida
[13] Helioporid: Skelettmaterial von Heliopora coerulea
Eingestellt am 23. November 2024
.
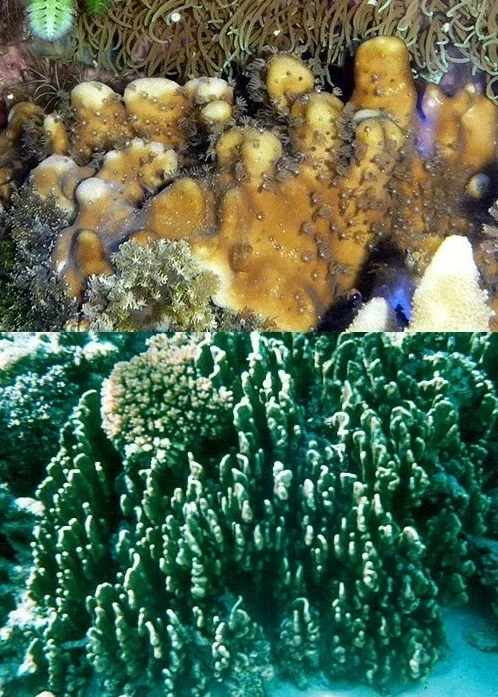
Oben Blaue Koralle (Heliopora coerulea) in einem Aquarium
Autor: Haplochromis
Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert
Unten Blaue Koralle (Heliopora coerulea)
Autor: NPS photo - Doug Cuillard
Lizenz: public domain; unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
.

Hexacorallia, Sechsarmkorallen:
1 Oft ein Vielfaches von Sechs
.
zusammengesetzte Polypen[3];
Sechs Tentakel[4] duplizieren sie zu zwölf oder umstellen den Mund mit gar mit
Vielfachem davon;
Bestimmt eine Strategie, fangende Flächen stark zu vergrößern,
.
Verschiedenste Cnidentypen[7] sind Sechsarmkorallen zu eigen.
Ein Typ aber zeichnet sie allein aus:
Spirocysten[8], Klebkapseln, besonderer Bildungsweise,
Deren umgestülpter Schlauch nach Explosion
Als gerades Stück aus ihr ragt, dem sich spiralig nach
Rückwärts wickelt sein erheblich längerer Teil;
Mit klebriger Masse umgeben, bleibt die Spirocyste
Haften am Opfer, das vergeblich sich wehrt.
.
Der Sechsarmkorallen Keimzellen[9] liegen
Nicht an der Mesenterien[10] unterem Rand,
Finden vielmehr Schutz und Bildung in diesen Scheiden;
Steril oft bleiben Mesenterien der Siphonoglyphen[11],[12] entlang.
.
Fußnoten
[1] Kolonie: Dichte Versammlung von Einzelindividuen
[2] Tierstock: Aussehen einer Kolonie, doch sind die einzelnen Individuen über ein gemeinsames Gewebe verbunden, unterscheiden sich darin von Kolonien, die durch dichtes Siedeln einzelner Individuen gekennzeichnet sind.
[3] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.
[4] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[5] Fiedern: Seitenstrahlen meist gleicher Gestalt einer gemeinsamen Achse entlang
[6] Octocorallia: Achtarmkorallen (Anthozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta – Eukarya)
[7] Cniden: Nesselkapseln
[8] Spirocysten, Klebkapseln: Deren umgestülpter Schlauch nach Explosion als gerades Stück aus der Cnide ragt, dem, spiralig nach rückwärts wickelnd, sich sein erheblich längerer Teil anschließt und mit klebriger Masse umgeben ist
[9] Gonaden: Geschlechtszellen bildende Organe
[10] Mesenterien: Scheidewände im Innern von Polypen, die den Gastralraum aufteilen
[11] Siphonoglyphen: An Winkeln der Mund-Afteröffnung der Polypen beginnende, nach unten in den Magenraum ziehende bewimperte Streifen
[12] Richtungsmesenterien, Richtungssepten: Siphonoglyphenbegleitende Mesenterien
Eingestellt am 23. November 2024
.

Malacalcyonacea, Weichkorallen i.w.S.:
1 Weichkorallen
.
Etwa vierzig Familien brachten DNA-Analysen zu dieser Ordnung zusammen.
Morphologie, der deutsche Name Weichkoralle drückt es schon aus,
Sind sie im Wesentlichen vereint, obwohl auch Scleralcyonacea weiche Korallen umfassen:
Skelettachsen fehlen Weichkorallen oder drücken dort sich in hohem Proteinanteil aus.
.
Eingestellt am 23. November 2024
.

Microsporidia, Mikrosporenbildner:
1 Aufregung im Vereinsheim
.
Frühjahrsversammlung der Imker des Kreises.
Erfahrungsaustausch, auch genveränderter Pollen im Honig, steht im Programm.
Doch ein einziges Thema beherrscht schon anfangs die Runde:
Leere Kästen und Bienensterben[1] rund um den Stock!
.
„Genveränderter Mais[2] mit fliegendem Blütenstaub“,
Behauptet schlichtweg der Erste,
„Ist für mich der einzige Grund!
Ihn sammelten Bienen mit anderem Pollen als Wintervorrat im vorigen Jahr!“
.
Aufgeregt meint ein Zweiter:
„Spritzmittel auf unseren Feldern,
Schon jetzt von den Bauern versprüht,
Rafften meine Bienen dahin!“
.
Der Leiter der Tagung, ein erfahrener, besonnener Mann,
Wiegt nachdenklich den Kopf, bevor er beunruhigt spricht:
„Genveränderter Mais wird noch wenig gesät
Und scheint nach Auskunft der Firmen, ungefährlich für Bienen zu sein,
Habt ihr schon an Varroa[6]-Milben gedacht?“
.
Übereinstimmend ergibt sich ein schlüssiges Bild:
Milben[7] kommen nicht in Betracht.
„Gelbliche Kotstreifen am Flugloch und in der Näh‘
Mit krabbelnden Bienen, wie manche berichten, am Stand,
Ergeben ein anderes Krankheitssyndrom[8];
Auch vollkommen leergeflogene Kästen
Sprechen nicht für Milbenbefall;
Ich denke eher, Noséma ist hierfür der Grund.“
.
Tote Bienen brachten einige mit;
So erfolgte sogleich der Test auf die Seuche.
Mit Daumennagel und Finger zog er den Darm samt Stachel hervor:
Weißlich-glasig, nicht gelblich-bräunlich gefüllt,
Wie der nicht infizierter Bienen,
Weist auf Befall mit Noséma hin. –
.
Millionen winziger Sporen
Findet der Leiter des angefragten Labors;
Untersucht DNA[9] und meldet den Imkern sein Resultat:
Noséma mit zwei verschiedenen Arten:
Noséma apis[10], lang in Europa bekannt,
Und Noséma ceranae[11], eine eingesickerte, östliche Art.
.
Fußnoten
[1] Westliche Honigbiene: Apis mellifera (Aipdae – Aculeata – Apocrita – Hymenoptera – Holometabola –…)
[2] Mais: Zea mays (Panicoideae – BOP-Verwandtschaft – Poaceae – Poineae – Poales – …)
[3] Pestizide: Sammelbegriff für Giftstoffe, die in der Land- und Forstwirtschaft, sowie in der Lagerhaltung gegen tierische Schädlinge, Pilzkrankheiten oder unerwünschtes Unkraut eingesetzt werden.
[4] Pilze: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für heterotrophe, mit Hyphen oder Hefen wachsende Lebewesen
[5] Unkraut: Bezeichnung für Pflanzen, die unerwünscht an von Menschen bereiteten Orten
[6] Varroamilbe: Varroa destructor (Acari – Apulmonata – Lipoctena – Arachnida – Euchelicerata –…)
[7] Milben: Acari (Apulmonata – Lipoctena – Arachnida – Euchelicerata – Chelicerata –…)
[8] Syndrom: Durch das gemeinsame Auftreten bestimmter charakteristischer Symptome gekennzeichnetes Krankheitsbild
[9] DNA (=DNS): Desoxyribonucleinic Acid, Desoxyribonukleinsäure; mit einer reduzierten Ribose; das [–OH] am C2 der Ribose fehlt; Baustein der Erbinformation
[10] Noséma apis: Parasit der Westlichen Honigbiene (Microsporidia – Myxozoa – Cnidaria – Animalia –
Opisthokonta -…)
[11] Noséma ceranae: Parasit der Östlichen Honigbiene (Microsporidia – Myxozoa – Cnidaria – Animalia –
Opisthokonta -…)
Eingestellt am 23. November 2024
.

Microsporidia, Mikrosporenbildner:
2 Unausweichlich (AP)
.
Schwer fiele fliegenden Sammlern, bräunliche Striche
Auf Start- und Landeplätzen zu meiden,
Wüssten sie um die Ansteckungsgefahr
Durch Millionen Sporen im Kot[1] schwerkranker Schwestern.
.
Sechsbeinig tappen geschäftige Scharen
Ohne zu zögern in frisch gesprühte Graffiti;
Entfernen, wenn nötig den Glibber mit haarfeinen Bürstchen;
Ein Mundschutz – oh wie nötig! – ist ihnen fremd.
.
Kleine, rundlich-ovale Partikel landen im Magen,
Wandern zum Darm, kleben sich fest, durchschießen,
Den langen, gewickelten Schlauch, dem haftenden Ende entschleudernd,
Der Epithelzellen[2] hauchzarte Wand.
.
Schieben den Protoplasten[3] nach und nach
Durch das enge Rohr in die Zelle,
Überlassen ihn von nun an dem eigenen Schicksal,
Zieh‘n sich, vollkommen entleert, abfallend zurück.
.
Wie im Schlaraffenland fühlt sich der Eindringling nun!
Schnürt sich, zwei einzelne Zellen erstrebend, mittig entzwei,
Plündert bis zur bitteren Neige den eingenommenen Raum.
.
Bald schon entfernt der Darm
Die kränkelnden Zellen aus dem Verbund,
Schickt sie der Wiederverwertung entgegen. –
Doch welch Ironie! Nosémas[6] Sporen werden damit befreit.
.
Jede, dem eindringenden Vorgänger bis aufs Kleinste gleichend,
Klebt sich wiederum fest,
Extrovertiert, kaum einen Widerstand spürend, den Schlauch
Und stört der verdauenden Zellen Aktivität.
.
Millionen von Sporen pro Zelle überschwemmen den Darm!
Verhindern der eiweißhaltigen[7] Pollen Verdauung,
Der wertvollen Mineralien Extraktion;
Steigern den Mangel darüber hinaus
Durch Abfuhr der hochproblematischen Sporen
Über sie weiterverbreitende Diarrhoe[8].
.
Fußnoten
[1] Kot: Kacke
[2] Epithel: Ein- oder mehrlagige Zellschichten, die alle inneren und äußeren Körperoberflächen von Echten Tieren (Animalia) bedecken
[3] Protoplast: Gesamter Inhalt einer Zelle
[4] Zwillingskern (Myxozoa): Diplokern, zwei Kerne in einer Zelle; ob Dikaryon (?)
[5] Mitose, mitotisch: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstanden Zellen wirken
[6] Noséma apis: Parasit der Westlichen Honigbiene (Microsporidia – Myxozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta -…)
[7] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt, das zweite der beiden benachbarten den Aminosäurerest
[8] Diarrhoe: Durchfall
Eingestellt am 23. November 2024
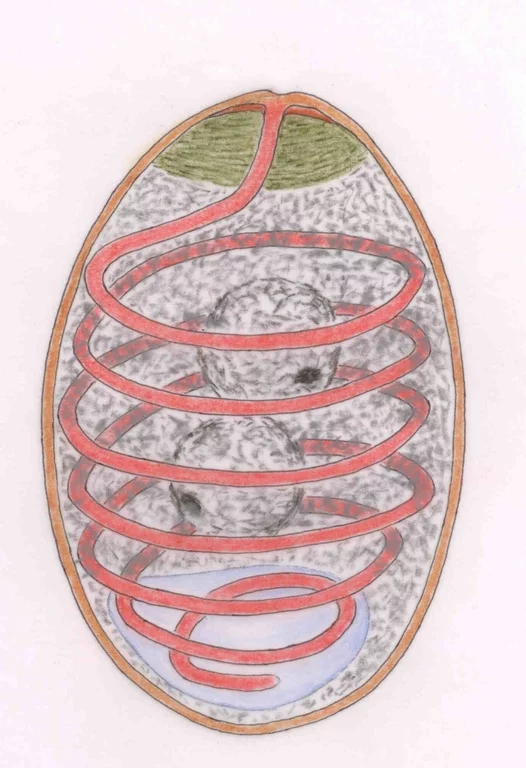
Mikrosporidienspore (Tusche mit Kreide; Reinhard Agerer)
Polschlauch (rot) als Schraube im Cytoplasma (hellgrau) gewickelt, mit zwei Kernen (dunkelkrau strichliert) mit Nucleoli (dunkelgrau), einer basalen Saftvakuole (blau) und einem apikalen Polaroblast (grün), eine auffällige Struktur zusammengelagerter Membranen und dünner Cisternen im vorderen, als die Polschlauchbasis umgebender Bereich; Zellwand (ockerfarben)
Eingestellt am 23. November 2024
.

Microsporidia, Mikrosporenbildner:
3 Einzig- und doch mehrtausendartig (AP)
.
Ein Polschlauch[1], so wegen der Stellung am vorderen Ende der Spore genannt,
Im Innern peripher zur Schraube gelegt,
Mit proteinhaltiger[4] Schicht außen bedeckt,
Ein Kern[5] oder zwei, doch separat, vielleicht zur Einheit verbunden,
Gelten als Zeichen für Mikrosporidienidentität.
.
Einer Waffe gleich wartet die hohllumige Schleuder,
Mit offenem Ende im cytoplasmatischen[12] Raum,
Auf der Zelle Druckerhöhung und stülpt sich,
Das geschlossene Ende durch die offene Basis jagend,
Mit Wucht plötzlich um,
Landet gestreckt mitten im Ziel,
Durchschlägt Zellmembranen[13], Wände,
Mancher Cysten[14] Schutzhüllen sogar.
.
Die Kerne, als Tandem zur Einheit gebracht,
Vereinzeln in etlichen Arten sich,
Ob meiotisch[15] entstanden ist nicht bekannt;
Sporen mit Doppel- oder Einzelkernen treiben ihr grausames Spiel.
.
Noséma wählt den einfachsten Weg,
Hält ihre Kerne ständig gepaart,
Kümmert sich nicht um Meiosen,
Zieht man der Nuclei Zahl in Betracht. –
.
Die beiden Noséma-Arten, der Honigbienen[16] Kreuz,
Lassen anatomisch sich nicht differenzieren,
DNA[17] nur bringt Identität an den Tag;
Auch ihr Krankheitsbild steuert dazu Informationen bei.
.
Apis ceranas[18] todbringende Art,
Noséma ceranae[19],
Schädigt den Bienendarm schwer,
Befällt hauptsächlich ältere, sammelnde Bienen,
Ohne Durchfall zu bringen.
Sterben fern ihrer Heimat:
Der Kasten bleibt leer.
Apis melliferas[20], der Europäischen Honigbiene Tod,
Noséma apis[21],
Bewirkt sehr bald schon schier nicht endende Diarrhoe[22];
Nicht viel Zeit bleibt den Betroff‘nen,
Zu entsorgen, was dazu sie drängt,
Auch wenn es im Stock und in naher Umgebung passiert. –
.
Nosema bombycina[23],
Nimmt zum Nachteil der Züchter
Sich Seidenraupen[24] aufs Korn,
Zerstört mit Nachdruck der Seidenproduzenten Gewinn. –
.
Finden sie meist ihr Zuhause;
Auch Fische, besonders Teleostei[29] verschmähen sie nicht,
.
– Manche Arten verstecken sich in einer Vakuole, andere leben im Cytoplasma direkt –
Ergibt sich zwangsläufig Wirtspezifität mit favorisierten Tieren,
Folglich mit Differenzierung in Hunderte Arten,
Zweitausendeinhundert aus heutiger Sicht.
Diese Zahl erfasst sicher noch zu wenige Arten,
Denn nicht alle Tiere sind schon danach gescreent[37].
.
Fußnoten
[1] Schläuche: Schraubig aufgerollte, schlauchartige, intrazelluläre Strukturen
[2] Zellwand: Eine aus Polymeren aufgebaute Hülle, die Zellen von Pflanzen, Bakterien, Pilzen, Algen und Archäen umgibt
[3] Chitin: Polymer aus N-Acetyl-Glucosamin, entstanden aus 1,4-β-Glucosen, an deren C2 eine [–NHCOCH3]-Gruppe hängt; anders ausgedrückt, an deren C2 eine [–NH2]-Gruppe, eine Aminogruppe, hängt, bei der ein Wasserstoffatom durch ein Acetat [CH3COO–] ersetzt ist. Zellwandpolysaccharid der Fungi (Echte Pilze), einiger Cnidaria (Nesseltiere) und Exoskelett der Arthropoda (Gliederfüßer)
[4] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt, das zweite der beiden benachbarten den Aminosäurerest
[5] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet
[6] Polaroblast (Microsporidia): Eine auffällige Struktur zusammengelagerter Membranen und dünner Cisternen im vorderen, als die Polschlauchbasis umgebender Bereich einer Mikrosporidien-Spore, als deren Aufgabe vermutet wird, beim Ausschleudern des Schlauchs zusätzliches Zellmembranmaterial zu liefern.
[7] Zellmembran: Lipiddoppelmembran (Bacteria, Eukarya) oder Glyceroldiethermembran (Archaea), die das Zellinnere umgibt; bei Plantae als Plasmalemma bezeichnet
[8] Cisternen: Abkömmlinge des endoplasmatischen Retikulums in hohler und oft flacher Form; Zellvesikel auch Zellkerne sind damit umgeben, besitzen den gleichen Grundbau wie die Zellmembran.
[9] Apex: Spitze, Scheitel
[10] Kalotte: Teil eines Kugelkörpers, der durch den Schnitt mit einer Ebene abgetrennt wird
[11] Vakuole: Von Lipiddoppelmembran abgegrenzter Raum der Zelle
[12] Cytoplasma: Flüssiger Zellinhalt mit darin liegendem Cytoskelett
[13] Zellmembran
[14] Cyste: Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, mehrzelliger Gebilde, gar winziger Organismen
[15] Meiose, meiotisch: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne in letztlich vier Zellen liegen
[16] Honigbienen: Apis spp. (Apidae – Aculeata – Apocrita – Hymenoptera – Holometabola –…)
[17] DNA (=DNS): Desoxyribonucleinic Acid, Desoxyribonukleinsäure; mit einer reduzierten Ribose; das [–OH] am C2 der Ribose fehlt; Baustein der Erbinformation
[18] Apis cerana: Östliche Honigbiene (Apidae – Aculeata – Apocrita – Hymenoptera – Holometabola –…)
[19] Noséma ceranae: Parasit der Östlichen Honigbeine (Microsporidia – Myxozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta -…)
[20] Apis mellifera: Europäische Honigbiene (Apidae – Aculeata – Apocrita – Hymenoptera – Holometabola –…)
[21] Noséma apis: Parasit der Westlichen Honigbiene (Microsporidia – Myxozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta –…)
[22] Diarrhoe: Durchfall
[23] Noséma bombycina: Parasit der Seidenraupen (Microsporidia – Myxozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta -…)
[24] Seidenspinner: Bombyx mori (Bombycidae – Bombycoidea – Macrolepidoptera – Ditrysia s.l. – Glossata –…)
[25] Arthropoda: Gliederfüßer (Panarthropoda – Ecdysozoa – Protostomia – Bilateria – Animalia –…)
[26] Insekten: Hexapoda (Tetraconata – Mandibulata – Arthropoda – Panarthropoda – Ecdysozoa –…)
[27] Krebstiere, Krebsartige: Crustacea (Tetraconata – Mandibulata – Arthropoda – Panarthropoda – Ecdysozoa –...)
[28] Spinnentiere: Arachnida (Euchelicerata – Chelicerata – Arthropoda – Panarthropoda – Ecdysozoa –…)
[29] Teleostei: Knochenfische i.e.S. (Actinopterygii – Osteognathostomata – Gnathostomata – Umericingulata – Lacertipinnata –…)
[30] Mammalia: Säugetiere (Cynodontia – Therodontia – Therapsida – Synapsida – Amniota – …)
[31] Nagetiere: Rodentia (Glires – Euaarchontoglires – Boreoeutheria – Placentalia – Theria –…)
[32] Fleischfesser: Carnivora s.l. (Carnivora s.s. – Euarchonta – Euarchontoglires – Boreoeutheria – Placentalia –…)
[33] Moderner Mensch: Homo sapiens (Hominini – Homininae – Hominidae – Hominoidea – Catarrhini –…)
[34] Immunsystem: Abwehrsystem von Organismen gegenüber fremden Substanzen oder Lebewesen
[35] Intrazellulär: In der/einer (fremden) Zelle; innerhalb der Zellmembran
[36] Schmarotzer, Parasit: Ein Organismus lebt auf Kosten eines anderen
[37] Screenen: An einer großen Anzahl von Objekten oder Personen in der gleichen Weise durchgeführte Untersuchung:
Eingestellt am 23. November 2024
.

Microsporidia, Mikrosporenbildner:
4 Weitere Reduktion? (HP, AP)
.
Noch komplizierter, staunt wohl verwundert der Leser,
Kann ein Lebenskreislauf, wie ihn Myxosporidia zeigen, wohl nicht verlaufen und
.
– Doch, zu große Fülle des Lesestoffs zu vermeiden, wurde darauf verzichtet,
Mehr der Microsporidien Entwicklungszyklen zu schildern, die ebenfalls oft komplex,
Mitunter gleichfalls Wirtswechsel[5] vollziehen, nicht nur einen Wirt parasitieren,
Sondern regelmäßig noch einen zweiten miteinbezieh’n. –
.
Wovon jedoch funktionelle Differenzierung bekannt;
Aber kompliziert gebaute, mehrzellige Triactinomyxosporen[8] fehlen,
Vielleicht auch, obwohl Zwillingskerne bei manchen vorhanden, Sexualität[9];
Doch wer weiß, was im Laufe der Mikrosporidiensporenentwicklung dem
Doppelkern nicht alles geschieht.
.
So gesehen sind Noséma[10] und Konsorten tatsächlich Endglied
Mit zwei Zellen, die je eine Polkapsel enthalten;
Erinnern an Tentakelabschnitte mit sechszelligem Cnidom[13] damit
Oder an freiflottierende, noch recht komplexe Cassiosomen[14],
Wie die Mangrovenqualle[15] sie produziert.
.
Ungewöhnlich erscheint, zunächst zumindest, für Animalia[16]
Ein Überdauerungsstadium, wie Myxo-, Triactinomyxo- oder Microsporen, zu sein;
Schon mit chitinöser[19] Hülle Teile des Körpers sich, beziehungsweise rundum.
.
Wirtswechselnde Generationen bedürfen spezieller Methoden
In Organismen einzudringen, zum Beispiel mit Nahrung in ihren Darm
Und – falls von außen sie haften sollen – mit ausgefeilten Hakenstrukturen fürs
Entern schützender Schichten, dazu wirksame Methoden zur Infektion.
Noséma mit fehlendem Wirtswechsel braucht nur in Defäziertem[20] zu warten,
Bis damit sich eine reinliche Arthropode[21] infiziert. –
.
Oder ist doch vielleicht eher andersherum der Evolution Verlauf zu verstehen:
Microsporidien als ursprünglichere Organismen zu seh’n,
Woraus folgend, Myxosporidia sich höherentwickelten,
Womöglich sogar Basis waren für der Nesseltiere[22] Wehr?
.
Dass im Gegensatz zu all diesen Stämmen, Myxozoa[28] nicht
Sich über fortschrittlichst erscheinende Oogamie[29] fortpflanzen!
Wer einmal, so lässt die Evolution wohl berechtigt sich lesen, dieses Stadium erreicht,
Wird entwicklungsgeschichtlich darauf schmerzlich, wenn überhaupt, wieder verzichten,
Denn diese einzigartige sexuelle Fortpflanzungsstrategie
Brachte Organsimen gleichsam auf der Überholspur voran.
– Auch bei Plantae[30] lässt sich Ähnliches finden:
Selbst die höchstevolvierten setzen gleichfalls unbeirrt auf Oogamie. –
.
Freilich, wer parasitisch[31] lebt, vereinfacht oft seine Lebensweise,
Verzichtet dann sogar auf Sexualität.
Doch wo sind Beispiele, wo als Parasiten
Oogame Organismen verloren sie vollständig, ohne Rest? –
.
Eine Auflösung der Verwandtschaftsverhältnisse basaler Animalia,
Auch mit molekularphylogenetischen[32] Studien, liegt derzeit nicht vor.
Zu ursprünglichen Bilaterien und zu Cnidariern besteht womöglich eine Beziehung der Myxozoa,
Doch wo sie abzweigen von dort, ist offensichtlich noch immer ungelöst.
.
So steht zur Diskussion nun folgende Hypothese:
Aus microsporidienähnlichen Vorfahren hätten sich
Cnidaria in ihrer Fülle evolutiv entwickelt
Als einer der Seitenzweige, als Liebling der Evolution,
Der andere wurde zu Myxosporidia mit Wirts- und Kernphasenwechsel.
Basis für beider Sippen Entstehung war der Zelle auszustülpender Schlauch.
.
– Im Vergleich der Polschlauchkapseln von Myxosporidia
Mit der Nesselkapselpalette von Cnidaria,
Lässt sich zudem unschwer erkennen:
Die einfachsten Kapseln kommen bei Myxosporidia und Microsporidia vor,
Die gleichfalls aber der Cnidaria Arsenal bereichern,
Nesselkapselexperten als Isorhizen[33] bekannt.
Auch dies spräche, so ließe mit Recht sich argumentieren,
Vorfahren der Microsporidien hätten als erste entwickelt dieses Patent,
Woraus alle schlauchbestückten Phyla[34] sich hätten entwickelt.
Auch Ctenophora gehören dazu.
Eines aber bleibt zu bedenken:
Zwar mit eigener Wand umgeben, damit zur Kapsel geworden,
Doch immer noch umhüllt von der Cnidocyte[37] mit ihrem Kern.
.
Bei Microsporidien wurde die Zelle selbst zur Polkapsel,
Die einen oder zwei Kerne enthält;
Doch jene der Myxosporidia zeigt eine Möglichkeit,
Wie von Cnidocyten ausgehend, eine Polkapselzelle entstand:
.
Eine feine Wand, die ehemalige Cnidenhülle[38], umgibt die Polkapsel,
Was bei Cnidariern noch vollständige Zelle war,
Nur ein zellwandabgeschotteter Rest bleibt noch erhalten,
Der als Kern der Cnidocyte früher bestand.
.
Viel Vorstellungskraft ist sicherlich jetzt nicht mehr nötig,
Der Kapsel Wand verloren zu seh’n:
So entsteht der Microsporidia Polkapsel als eigenständige Zelle,
Die den gewickelten Schlauch, sowie den eigenen Zellkern enthält.
.
So ließe sich nun die Hypothese präzisieren:
Einmalig entstand als Ausgangspunkt der bedachten dreigliedrigen Verwandtschaft[39] eine
Zelle mit eingeschlossener, cisternenbasierter Polkapsel
Mit umstülpbarem Schlauch als einzigartige Neuerung der Evolution;
Ein sich gabelnder Weg führte zu Cnidaria und Myxosporidia:
Cnidaria behielten die originelle Erfindung,
Bauten der Cnidocyten Form- und Funktionspalette noch aus,
Myxosporidia vereinfachten alles, der Myxosporen und Triactinomyxosporen Kleinheit wegen,
Microsporidia bauten diese Erfindung zur einfachen Polkapselzelle noch um.
– Erinnern wir uns Cassiopea xamachana[40]?
Auch sie spielte mit Verkleinerungen herum! –
.
– Und am Ende drängen gedanklich zu diesen drei
auch Rippenquallen[41] sich noch auf:
Sind Ctenophora nicht gleichfalls auf einen schraubig gewickelten, zellinternen Schlauch verwiesen,
Sollen leimknopfbeklebte Opfer nicht mehr entflieh’n?
Gehören nicht auch sie zu dieser Verwandtschaft,
Deren Ahnen kamen auf dieses Wickelschlauchpatent? –
.
Einmalig aber erscheint uns dieses Patents Entwicklung:
Des zellinternen, auf Druck hin sich umstülpenden Schlauchs.
Schwer vorstellbar, dieses Prinzip hätte konvergent sich zweimal entwickelt,
Dies gälte jedoch, würden Microsporidia, wie so oft vollzogen, zum Reich der Pilze[42] gestellt. –
.
Fußnoten
[1] Nesselkapseln: In Nesselzellen gebildete, kapselartige Gebilde, die bei Reizung der Nesselzellen ihr schlauchartiges Fangorgan hervorschleudern
[2] Bienen: Apis spp. (Apidae – Aculeata – Apocrita – Hymenoptera – Holometabola –…)
[3] Schläuche: Schraubig aufgerollte, schlauchartige, intrazelluläre Strukturen
[4] Zwillingskern (Myxozoa): Diplokern, zwei Kerne in einer Zelle; ob Dikaryon (?)
[5] Wirtswechsel: Im Zuge eines Enwicklungskreislaufes regelmäßiger Wechsel von einem Wirt zum anderen; meist mit Kernphasenwechsel gekoppelt
[6] Propagulen: Allgemeine Bezeichnung für Verbreitungseinheiten
[7] Polkapsel: Umgewandelte Nesselkapsel
[8] Triactinomyxosporen: Zweite, diploide (?), Sporengeneration der Myxosporidia; aufgebaut aus vielkernigem, aus einer einzelnen Zelle entstandenem Plasmodium, drei Polkapseln und drei alles bedeckenden ankerförmigen Kapselzellen
[9] Sexuelle Fortpflanzung: Dafür sind drei Vorgänge miteinander gekoppelt, Meiose (abgekürzt mit R!), Plasmogamie (Zellen vereinen sich, abgekürzt mit P!) und Karyogamie (Kerne verschmelzen, abgekürzt mit K!) verbunden, wobei P! und K!, mit Ausnahme bei Dikaryota, unmittelbar aufeinander folgen. Bei Dikaryota (Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya) sind beide Vorgänge unterschiedlich lang (weit) voneinander getrennt. Da bei Animalia und Plantae P! und K! unmittelbar aufeinander folgen, werden beide Vorgänge häufig zu Befruchtung (B!) zusammengefasst.
[10] Noséma spp.: (Microsporidia – Myxozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta -…)
[11] Reduktive Evolution: Evolutive Weiterentwicklung durch Verlust verschiedener Merkmale
[12] Myxosporen: Erste, haploide, Sporengeneration der Myxosporidia; aufgebaut aus sechs Zellen: zwei Polkapselzellen, zwei Zellen, die zu einer zweikernigen amöboiden Zelle verschmolzen sind und zwei Kapsel(Hüll)-Zellen, die vier anderen umgebend
[13] Cnidom: Gesamtheit der Nesselzellen(typen)
[14] Cassiosomen: Von geißeltragendem Ektoderm und von Cnidocyten umgebene, von Mundarmen abgegebene, frei flottierende, Zooxanthellen und Amoebocyten beinhaltende winzige Gallertkügelchen, die dem Beuteerwerb dienen
[15] Mangrovenqualle: Cassiopea xamachana (Cassiopeidae; nicht behandelt – Discomedusae – Scyphozoa – Medusozoa – Cnidaria –…)
[16] Animalia, Echte Tiere (Opisthokonta - Eukarya)
[17] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.
[18] Podocyste: Mit undifferenzierten Zellen gefülltes, mit chitinöser Hülle versehenes Überdauerungsstadium, aus der ein planulaähnliches Stadium schlüpfen kann
[19] Chitin: Polymer aus N-Acetyl-Glucosamin, entstanden aus 1,4-β-Glucosen, an deren C2 eine [–NHCOCH3]-Gruppe hängt; anders ausgedrückt, an deren C2 eine [–NH2]-Gruppe, eine Aminogruppe, hängt, bei der ein Wasserstoffatom durch ein Acetat [CH3COO–] ersetzt ist. Zellwandpolysaccharid der Fungi (Echte Pilze), einiger Cnidaria (Nesseltiere) und Exoskelett der Arthropoda (Gliederfüßer)
[20] Defäziertes, Faeces: Kot, Kacke
[21] Arthropoda: Gliederfüßer (Panarthropoda – Ecdysozoa – Protostomia – Bilateria – Animalia –…)
[22] Nesseltiere: Cnidaria (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)
[23] Placozoa: Pattentiere (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)
[24] Porifera: Schwämme (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)
[25] Ctenophora: Rippenquallen (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)
[26] Cnidaria: Nesseltiere (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)
[27] Bilateria: Spiegelbildsymmetrische (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)
[28] Myxozoa: Parasitische Nesseltiere (Cnidaria – Animalia – Opisthokonta – Eukarya)
[29] Oogamie: Verschmelzung eines haploiden, beweglichen Spermatozoids mit einer unbeweglichen, nährstoffreichen Eizelle
[30] Plantae: Echte Pflanzen (Eukarya)
[31] Parasit, Schmarotzer: Ein Organismus lebt auf Kosten eines anderen.
[32] Molekularphylogenie: Auf Molekülähnlichkeiten (meistens von DNA, doch mitunter auch von Proteinen) basierende Schlüsse bezüglich Stammesgeschichte bzw. Verwandtschaftslinien von Organismen
[33] Haploneme Anisorhize: Nesselkapseln mit schraubig gedrehtem Schlauch, auch nachdem sie explodiert ist; als Anisorhizen, ist eine Schraubung in diesem Zustand in Seitenansicht kaum mehr erkennbar; Haploneme Isorhize: Nesselkapseln mit schraubig gedrehtem Schlauch in der unentladenen Cnide; entladen ist der Schlauch gerade.
[34] Phylum: Stamm, Abteilung
[35] Cisternen: Abkömmlinge des endoplasmatischen Retikulums in hohler und oft flacher Form; Zellvesikel auch Zellkerne sind damit umgeben, besitzen den gleichen Grundbau wie die Zellmembran.
[36] Organell: Meist lipidmembranumgrenzte Bereiche eigener Funktion; oder als Zelle, weicht sie signifikant in Gestalt und Funktion von anderen ab
[37] Cnidocyten: Nesselkapseln bildende Zellen
[38] Cniden: Nesselkapseln
[39] Cnidaria, Myxosporidia und Microsporidia
[40] Cassiopea xamachana: Mangrovenqualle (Cassiopeidae; nicht behandelt – Discomedusae – Scyphozoa – Medusozoa – Cnidaria –…)
[41] Rippenquallen: Ctenophora (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)
[42] Echte Pilze: Fungi (Opisthokonta – Eukarya)
Eingestellt am 23. November 2024
.
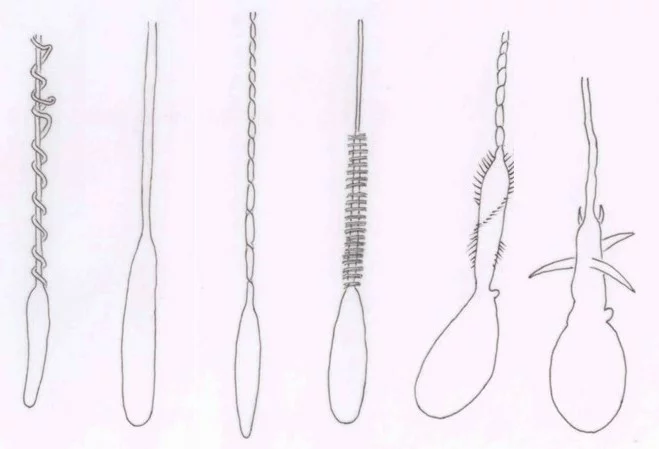
Cniden-Typen: Auswahl (Reinhard Agerer, Tusche)
Von links nach rechts:
Spirocyste, Klebkapsel: Der nach Explosion umgestülpte Schlauch ragt als gerades Stück aus der Cnide, dem, spiralig nach rückwärts wickelnd, sich sein erheblich längerer Teil anschließt und mit klebriger Masse umgeben ist; in der unentladenen Cnide, liegt der Schlauch schraubig um den geraden Teil
Haploneme Isorhize: Der nach Explosion umgestülpte Schlauch ragt als gerades Stück aus der Cnide; in der unentladenen Cnide liegt der Schlauch schraubig
Haploneme Anisorhize: Der nach Explosion umgestülpte Schlauch ragt enggeschraubt Stück aus der Cnide, in Seitenansicht ist die Schraubung kaum mehr erkennbar; in der unentladenen Cnide liegt der Schlauch schraubig
Rhaboide, Mastigophore: Nesselkapseln mit rundum etagiert angeordneten Mastigonemen in der unteren Hälfte des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs; in der unentladenen Cnide, liegt der Schlauch schraubig um den geraden Teil
Eurythele: Nesselkapselschlauch mit zwei unterschiedlichen Bereichen, wenn explodiert: Basal mit kurzem, geradem Anteil, an dem weit spiralig ein Haarkranz emporläuft, an den sich ein engschraubiger Schlauch anschließt, dessen Schraubung in diesem Zustand in Seitenansicht kaum mehr erkennbar ist; in der unentladenen Cnide, liegt der basal gegabelte Schlauch als Rolle
Stenothele: Nesselkapseln mit stilett- oder skalpellartigen, leicht gekrümmten, messerscharfen, oft in zwei Etagen angeordneten Strukturen an der etwas verbreiterten Basis des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs; in der unentladenen Cnide, liegt der basal ungegabelte Schlauch als Rolle
Zeichnung aus Westheide & Rieger, Seite 124, Abb. 193 (Auswahl)
Eingestellt am 23. November 2024
.

Microsporidia, Mikrosporenbildner:
5 Nun, wohin mit all diesen Schlauchbildnern? (HP)
.
Eine recht alte Gruppe dürften Microsporidia sein,
Verloren auf ihrem Wegen durch die Zeit
Organelle Schritt für Schritt:
.
Verzichten aus naheliegenden Gründen
Auf ihre eigene Aktivität,
Brauchen doch nur in die Umgebung zu greifen,
Finden dort alles, auch ATP[4].
.
Echten Pilzen[5] rechnet man heute oft sie zu.
Aus Chitin[6] besteht die innere Hülle,
Umgeben von dünnster Schicht Protein[7],
Die, im Innern sich fortsetzend, auch den Polschlauch[8] umgibt.
.
Obgleich kein Konsens die Szene beherrscht!
Zwei Kerne, zur Diplostruktur Seit‘ an Seite vereint,
Erinnern an fortgeschrittene Echte Pilze
Mit zwei funktionell gekoppelten Kernen[11];
Von diesen stehen sie sicherlich weit entfernt. –
.
DNA lässt die nähere Stellung ein wenig noch offen;
Entlarven Myxosporidia als Teil des Cnidaria Stamms.
.
– Eine Vielzahl einzelliger, eukaryotischer Einzeller
Bildet an der Animalia Basis so etwas wie einen Schwarm
Sich molekularbiologisch[22] wenig unterscheidender Wesen.
So bleibt deswegen ihre Beziehung zu Cnidarieren, auch zu Fungi,
weitgehend noch offen. –
.
Ein ausgefallenes, signifikantes Merkmal hingegen,
Lässt eine alternative Einteilung zu:
Ctenophora[23], Cnidaria und Myxozoa entsprangen gemeinsamer Basis,
Nutzen doch alle den intrazellulär aufgeschraubten, auch dehnbaren Schlauch
Der, wie es scheint, cisternenbegleitet bei allen gebildet,
Bei Ctenophora nur als Angelschnur dient,
Bei Cnidaria, Myxosporidia und Microsporidia jedoch sich umstülpt
Und als Transportröhre von Zellinhalten dient.
.
Ein Organismus mit intrazellulär schraubig gewundenem,
Womöglich dehnbarem Schlauch,
War Ausgangspunkt zweier Entwicklungsrichtungen,
Wobei die eine zu Rippenquallen[24] hatte geführt,
Die zweite zu Ahnen der Cnidaria-Verwandten wurden, mit
Umstülpbarem, beutefangendem, Zellsubstanzen transportierendem Schlauch;
Eine erneute Gabel führt zu gemeinsamen Vorfahren der Cnidaria und Myxosporidia;
Microsporidia leiten demnach von Myxosporidien, wie schon erläutert, sich
ab.
.
Fußnoten
[1] Mitochondrien: Gelten als Kraftwerke der Zellen, da sie Energie für die zellulären Prozesse liefern; es lassen sich Außen- und Innenmembran unterscheiden, wobei die innere Membran auf einen zellwandlos gewordenen Endosymbionten (ein Alpha-Proteobacterium) zurückgeht, während die äußere Membran der Plasmamembran der eukaryotischen Zelle entspricht; prokaryotische Chromosomen weisen ebenfalls auf einen aufgenommenen prokaryotischen Endosymbionten als Ursprung der Mitochondrien hin.
[2] Dictyosom, Netzorganell: Oft tellerförmig anmutende Cisternen treten gern in gestapelter Weise auf, an deren Rändern Vesikel abgeschnürt werden; jedes einzelne Organell der Zelle wird oft als Dictyosom (Netzorganell) bezeichnet, während alle Organelle zusammen als Golgi-Apparat geführt werden.
[3] Parasitär, parasitisch: Schmarotzend leben auf Kosten lebender Organismen
[4] ATP: Adenosin-Tri-Phosphat; bestehend aus Ribose und Adenin; Ribose trägt an seiner nicht in den Zuckerring einbezogenen Kohlenstoffgruppe drei hintereinander liegende Phosphatgruppen. Diese lineare Anordnung der Phosphate hat zur Folge, dass das dritte, äußerste Phosphat, mit seiner ihm dadurch innewohnenden Energie, diese leicht unter Abspaltung auf andere Moleküle übertragen kann
[5] Echte Pilze, Chitinpilze: Fungi (Opisthokonta – Eukarya)
[6] Chitin: Polymer aus N-Acetyl-Glucosamin, entstanden aus 1,4-β-Glucosen, an deren C2 eine [–NHCOCH3]-Gruppe hängt; anders ausgedrückt, an deren C2 eine [–NH2]-Gruppe, eine Aminogruppe, hängt, bei der ein Wasserstoffatom durch ein Acetat [CH3COO–] ersetzt ist. Zellwandpolysaccharid der Fungi (Echte Pilze), einiger Cnidaria (Nesseltiere) und Exoskelett der Arthropoda (Gliederfüßer)
[7] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt, das zweite der beiden benachbarten den Aminosäurerest
[8] Schläuche: Schraubig aufgerollte, schlauchartige, intrazelluläre Strukturen
[9] Tubuligene: Gene für α- und β-Tubulin
[10] Fungi: Echte Pilze, Chitinpilze (Eukarya)
[11] Dikaryon: Zwei zusammengehörende, verträgliche, haploide (n) Kerne bei Taphrinomycotina, Pezizomycotina, Pucciniomycotina, Ustilaginomycotina und Agaricomycotina; sie treten funktionell als Einheit wie ein diploider (2n) Kern auf, sind aber voneinander getrennt (n+n); im Entwicklungskreislauf erfolgte zwar zunächst die Plasmogamie (P!), doch die Karyogamie (K!) zum diploiden (2n) Kern erfolgt erst kurz vor der Meiose.
[12] Myxosporidia (Myxozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta – Eukarya)
[13] Cnidaria: Nesseltiere (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)
[14] Metazoa: entspricht Animalia
[15] Tight junctions: Zellkontakte durch die Epithelzellen aneinandergeheftet sind; umgeben gürtelartig den gesamten Zellumfang und bilden auf diese Weise im Epithelzellverband eine zusammenhängende Diffusionsbarriere
[16] HOX-Gene, Homöobox-Gene: Familie von regulativen Genen. Ihre Genprodukte sind Transkriptionsfaktoren, welche die Aktivität anderer, funktionell zusammenhängender Gene im Verlauf der Individualentwicklung steuern; sind evolutionär hoch konserviert, kommen bei Animalia und Fungi vor; stellen nach heutiger Sicht einen in der Evolution früh entstandenen grundlegenden Regulationsmechanismus dar.
[17] Kollagen: Heterogene Gruppe von Proteinen; der wichtigste Faserbestandteil von Sehnen, Knorpeln, Blutgefäßen und Zähnen; bildet eine linksgängige Schraube, wobei jeweils drei dieser Schrauben in einer rechtsgängigen Superschraube arrangiert sind, dem eigentlichen Kollagen; diese Trippelschraube wird durch Wasserstoffbrücken zwischen den einzelnen Strängen stabilisiert; nur bei Animalia (Echte Tiere) vorkommend.
[18] Nesseltiere: Cnidaria (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)
[19] Spiegelbildsymmetrische: Bilateria (Animalia - Opisthokonta – Eukarya)
[20] Polkapsel: Umgewandelte Nesselkapsel
[21] Cniden: Nesselkapseln
[22] Molekularbiologisch: Anhand von organischen Molekülen Organsimen erforschend; oftmals auf Verwandtschaften anhand Analysen und Vergleichen von Nukleinsäuren und Proteinen bezogen
[23] Ctenophora: Rippenquallen (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)
[24] Rippenquallen: Ctenophora (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)
Eingestellt am 23. November 2024
.
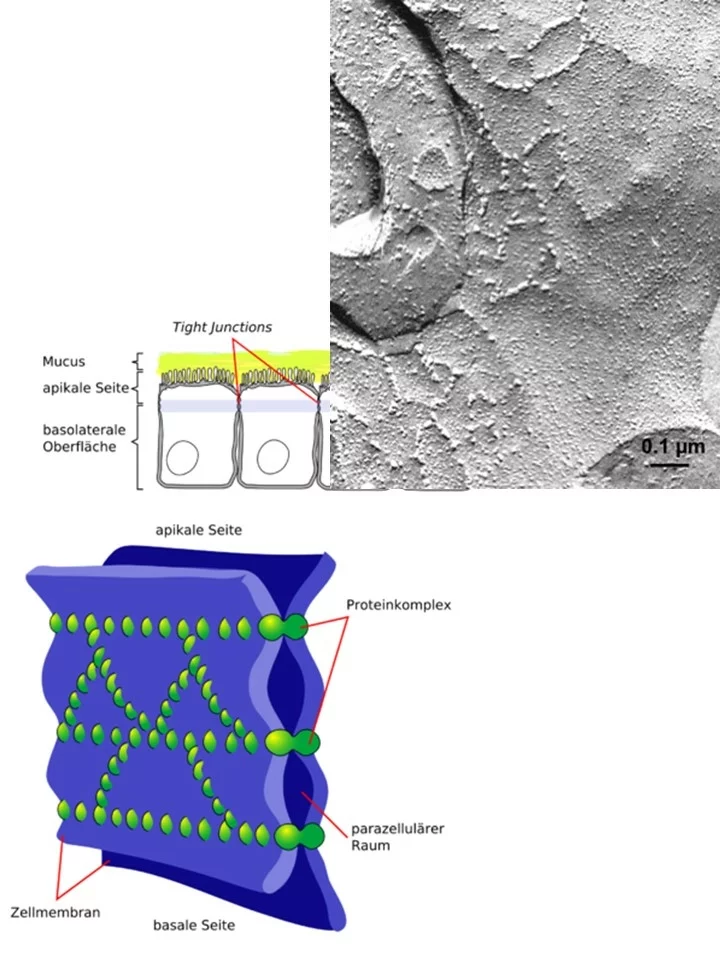
Tight Junctions
Oben: Gefrierbruchmorphologie von Tight-Junctions an der Blut-Hirn-Schranke; elektronenmikroskopisches Bild
Autor: Hartwig Wolburg
Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license; unverändert
Unten: Schematische Darstellung der Tight-Junctions an der Blut-Hirn-Schranke
Autor: Mariana Ruiz
Lizenz: public domain; unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
.

Myxosporidia, Myxosporenbildner:
1 Der Myxosporidia primär infizierende Sporen (AP)
.
Myxosporen, aus sechs Zellen jeweils entstanden,
Bilden sich zur zehn µm[1] langen Linsengestalt
Nach eingefahrenem Plan, nach vorgegebenem Muster,
Enthält zwei Projektile und eine zweikernige, amöboide[2] Zelle für Infektion.
.
Doch der Reihe nach nun, wie sich so alles entwickelt:
Eine haploide[3] Zelle, die später sich teilt,
Umgibt eine andere, aus der vier am Ende entstehen,
Umhüllt dann zu zweit[4] das Vierpaket;
Zwei der vier verschmelzen zur Doppelkernamöbe,
Die anderen beiden differenzieren sich je zu einem Geschoss[5].
.
Eine Polkapsel[6] bilden intern diese beiden
Mit langem, schraubig gewickeltem Schlauch,
Durch die er sich, sowie durch die begrenzende Zellwand, durch Umstülpung schießt,
So Zugang der zwei-Kern amöboiden Zelle
Zur Infektion des Wirtes verschafft. –
Sieht Waffenähnlichkeit und schließt,
Dass auf gleiche Urururahnen sie gehen zurück. –
.
Zweitausendeinhundert Arten etwa dieser Gewebs- und Zellparasiten
Sind insgesamt bekannt.
In limnischen[12] und marinen Fischen,
Doch auch in einem Säuger[16], sind sie nachgewiesen:
Ausnahmsweise leidet der Maulwurf[17] daran.
.
Fußnoten
[1] Mikrometer, µm: Tausendstel Millimeter (10-3 mm); Millionstel Meter (10-6 m)
[2] Amöboid: Wie Amöben, Wechseltierchen, gestaltet, oder sich so beim Bewegen verhaltend
[3] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n
[4] Kapselzellen, Valven: Polkapseln umschließende Zellen
[5] Polkapsel: Umgewandelte Nesselkapsel
[6] Polkapsel
[7] Proximal: Nahe eines vorgegebenen Bezugspunktes; meint z. B. bei festsitzenden Organismen einen der Anheftungsstelle nahen Bereich.
[8] Hier also seiner ursprünglichen Entstehungsstelle
[9] Nesseltiere: Cnidaria (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)
[10] Cnidocyten: Nesselkapseln bildende Zellen
[11] Cniden: Nesselkapseln
[12] Limnisch: In Süßwasser lebend
[13] Plathelminthes: Plattwürmer (Spiralia – Protostomia – Bilateria – Animalia – Opisthokonta -…)
[14] Annelida: Ringelwürmer (Schizocoelia – Spiralia – Protostomia – Bilateria – Animalia –…)
[15] Reptilien, Kriechtiere: Eine verwandtschaftsübergreifende Bezeichnung für überwiegend an Land lebende, schuppentragende, wechselwarme Tiere
[16] Säugetiere: Mammalia (Cynodontia – Therodontia – Therapsida – Synapsida – Amniota –…)
[17] Europäischer Maulwurf: Talpa europaea (Talpidae – Soricomorpha – Lipotyphla – Laurasiatheria – Boreoeutheria -…)
Eingestellt am 23. November 2024
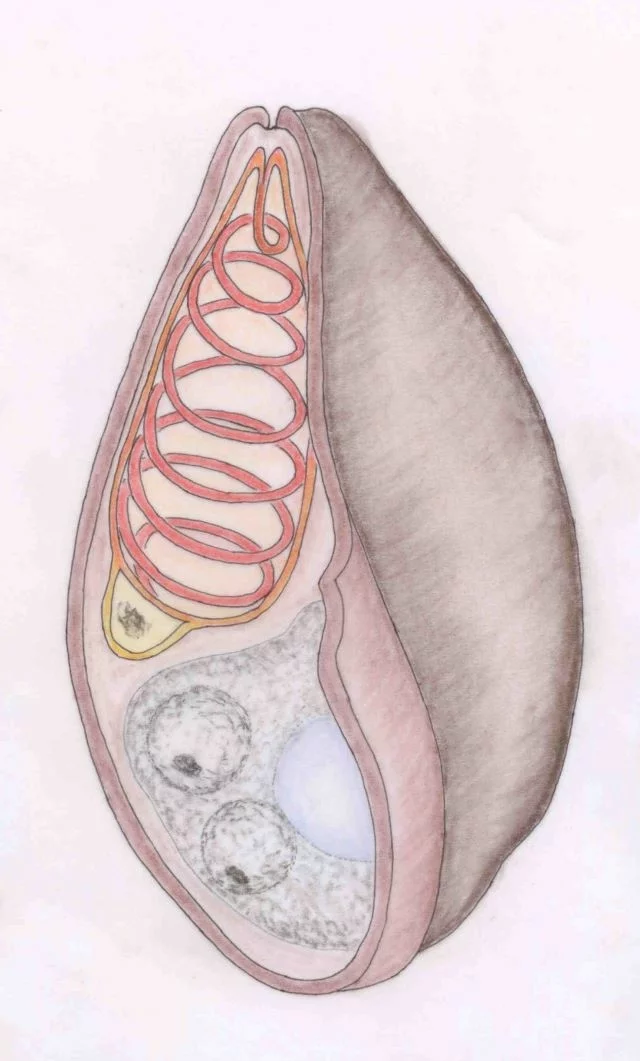
Myxospore (Tusche und Kreide mit Bleistift; Reinhard Agerer)
Längsgeschnittene Myxospore, um eine Polkapsel von zweien im Detail zu zeigen; dazu ist nur eine der beiden Deckzellwände (hellbraun) geöffnet, die andere (dunkelbraun) liegt über der zweiten Polkapsel. Beide Deckzellwände umgeben der Polkapseln und der Amöboidzelle gemeinsamen Raum.
Die Deckzelle (hellbraun) umfasst mit der zweiten zusammen (dunkelbraun) die amöboide, zellwandlose Zelle (grau) mit zwei Zellkernen (dunkelgrau strichliert) und deren Nucleoli (dunkelgrau); es kann nur ein Teil der amöboiden Zelle gezeigt werden; der Rest ist von der zweiten Deckzellwand verdeckt; diese amöboide Zelle entstand durch Verschmelzen zweier einzelner, einkerniger Zellen zur zweikernigen Zelle. Eine Saftvakuole (blau) schließt diese Zelle ein.
Die Polkapsel (orange Wand) umfasst den schraubigen Polschlauch (rot), der an die Öffnung der Polkapsel anschließt, die zur Deckzellwandpore zeigt. Am unteren Ende der Polkapsel liegt ein Rest jener Zelle (Wand gelb), die die Polkapsel gebildet hatte; Polkapselwand und Zellwand der Bildungszelle lassen sich nicht mehr unterscheiden, nur der Zellkernrest (dunkelgrau) der ehemaligen Bildungszelle (gelb) weist noch auf sie hin.
Nach Westheide & Rieger (2013), Seite 156, Abb. 246
Eingestellt am 23. November 2024
.

Myxosporidia, Myxosporenbildner
2 Vorsicht
Der Leser möge nun alles daransetzen, was folgt, zu verstehen.
Der Lebenszyklus,[1] der hier nun wird interpretiert
– Auch wenn der Fassbarkeit halber einiges vereinfacht und
Nicht alles gezeigt und erklärt werden wird –
Ist einer der komplexesten, wenn nicht gar der komplexeste, den jemals Organismen entwarfen;
Doch damit, glaubt der Verfasser, wird deutlich gezeigt,
Dass Myxozoa[2] langer Epochen dafür bedurften, all dies zu entwickeln,
Was als wichtiger Seitenzweig wohl vor den Cnidariern[3] noch entstand.
.
Fußnoten
[1] Entwicklungszyklus, Entwicklungskreislauf, Lebenskreislauf, Lebenszyklus: Ein Kreislauf (eigentlich ist es eine Schraube, weil immer Neues entsteht, das zwar dem Anfänglichen gleicht, doch zeitlich später kommt), in dem sexuelle Fortpflanzung erfolgt. Zusätzlich kann noch in regelmäßigem Wechsel eine Phase der asexuellen Vermehrung eingeschlossen sein
[2] Myxozoa: Parasitische Nesseltiere (Cnidaria – Animalia – Opisthokonta – Eukarya)
[3] Cnidaria: Nesseltiere (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)
Eingestellt am 23. November 2024
.

Myxosporidia, Myxosporenbildner:
3 Des Lebenskreislaufs erster Teil (AP)
.
Eine Myxospore[1] gelangt auf später noch darzustellende Weise
In den Darm von Tubifex tubifex[2],
Der im Schlamm von Teichen und Flüssen Lebensraum findet;
Dort aber bleibt die Spore nicht lange, will mit beiden Kernen ins Wurmepithel.
.
Schleudert einen, vielleicht sogar beide Schläuche[3],
– Mit Druck eine Öffnung zwischen den beiden zuvor noch geschlossenen Schalen[4] erzwingend –
Aus den Kapseln gegen die Zellen hervor;
Sie heften dort sich an, was dem Zwei-Kern-Plasmodium[5] ins Innere Zutritt verschafft.
Den Weg des geringsten Widerstands suchend,
Durchdringt es nicht der Zelle Begrenzung, zwängt sich vielmehr zwischen sie ins Epithel[6].
.
Endlich am Ziel, vermehrt es mehrfach die beiden unterschiedlichen Kerne mitotisch,
Formt ein multinukleäres[7] Plasmodium, das weiter drängt
Und sich am Ende im Innern in
Viele einkernige Zellen zerlegt.
Wohlmerkt: Sie unterscheiden sich genetisch,
Weshalb die Wissenschaft sie mit Namen α- und β-Kern-Zellen belegt.
.
Diese einkernigen haploiden[8] Zellen wandern durch des Wurms Epithelien.
Einige teilen die Kerne erneut mitotisch, werden so polyenergid[9],
Um danach noch mehr haploide Zellen von sich selbst zu bilden: je α- und β-Kern-Zellen,
Mit dieser asexuellen[10] Vermehrungsphase das Infektinspotenzial zu erhöh‘n.
In einer Hülle entstehen diese haploiden, genetisch unterschiedlichen Zellen,
Die von zwei anderen, die mehrfach sich teilten, einschichtig geformt.
.
Sechzehn haploide α- und β-Kern-Zellen werden zueinander finden in diesem Behälter,
Acht Zygoten sind auf diese Weise entstanden.
Sie bereiten den zweiten Teil des Lebenskreislaufes vor.
.
In voluminöser geword‘nem Behälter teilt sich jede Zygote zweimal mitotisch:
Drei Zellen bleiben davon, die vierte umgebend, peripher;
Das Dreiergespann teilt erneut sich mitotisch.
So wirken sieben Zellen zusammen für eine zweite Sporengeneration[13]:
.
Etwas Ankerförmiges mit Handhabe[14] bildet sich um die zentral liegende Zelle,
Die von drei Polkapseln flankiert, sowie
Außenherum von hornartigen Zellen[15],
Zu denen die übrigen drei sich geformt.
.
– Uneinig darüber ist die Wissenschaft noch –
In viele Kerne, ein Plasmodium zu bilden, aus dem viele Einzelzellen später entstehen.
Wir nehmen, der Leser mag dem vielleicht folgen, hier Meiose an.
Können doch Biologen, die sich mit Entwicklungskreisläufen beschäftigen, feststellen,
.
Diese ankerförmigen Sporen,
Triactinomyxosporen genannt,
Wechseln den Wirt, wollen im vorliegenden Fall zu Fischen[21];
Richten dort Verheerendes an.SL
.
Fußnoten
[1] Myxosporen: Erste, haploide, Sporengeneration der Myxosporidia; aufgebaut aus sechs Zellen: zwei Polkapseln, zwei Zellen, die zu einer zweikernigen amöboiden Zelle verschmolzen sind. und zwei Kapsel(Hüll)-Zellen, die vier anderen umgebend
[2] Tubifex tubifex: Gewöhnlicher Schlammröhrenwurm (Tubificidae – Oligochaeta – Clitellata – Annelidae – Schizocoelia –…)
[3] Schläuche: Schraubig aufgerollte, schlauchartige, intrazelluläre Strukturen
[4] Kapselzellen, Valven (Myxozoa): Polkapseln umschließende Zellen
[5] Plasmodium: Masse aus vielkernigem Protoplasten, die durch Kernteilung ohne nachfolgende Zellteilung entsteht
[6] Epithel: Ein- oder mehrlagige Zellschichten, die alle inneren und äußeren Körperoberflächen von Echten Tieren (Animalia) bedecken
[7] Multinucleär, plurinuclear, polyenergid: Vielkernig
[8] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n
[9] Polyenergid: Multinucleär, plurinuclear: Vielkernig
[10] Asexuell: Nur aufgrund von Mitosen gebildet
[11] Plasmogamie: Verschmelzung der Protoplasten zweier Zellen im Zuge sexueller Fortpflanzung; abgekürzt P!
[12] Karyogamie: Verschmelzung zweier haploider Zellkerne; abgekürzt K!
[13] Triactinomyxosporen: Zweite, diploide (?), Sporengeneration der Myxosporidia; aufgebaut aus vielkernigem, aus einer einzelnen Zelle entstandenem Plasmodium, drei Polkapseln und drei alles bedeckenden ankerförmigen Kapselzellen.
[14] Gemeint ist hier der Stiel eines Ankers, an dem, wenn auf Schiffen, ein Seil angeknotet ist
[15] Kapselzellen, Valven: Polkapseln umschließende Zellen
[16] Mitose, mitotisch: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstanden Zellen wirken
[17] Meiose, meiotisch: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne in letztlich vier Zellen liegen.
[18] Kernphasenwechsel: Wechsel des Chromosomenbestands von haploid (n) auf diploid (2n) oder dikaryotisch (n+n) oder von 2n, bzw. n+n auf n
[19] Parasitisch: Schmarotzend leben auf Kosten lebender Organismen
[20] Wirtswechsel: Im Zuge eines Entwicklungskreislaufes regelmäßiger Wechsel von einem Wirt zum anderen; meist mit Kernphasenwechsel gekoppelt
[21] Fische: Teleostei i.e.S. (Actinopterygii – Osteognathostomata – Gnathostomata – Umericingulata – Lacertipinnatae –…)
SL Kent ML, Andree KB, Bartholomew JL, El-Matbouli M, Desser SS, Devlin RH, Feist SW, Hedrick RP, Hoffmann RW, Khattra J, Hallett SL, Lester RJG, Longshaw M, Palenzuela O, Siddall ME, Xiao C (2001) Recent advances in our knowledge of the Myxozoa. J Eukar Microbiol 48(4): 395-413.
Eingestellt am 23. November 2024
.
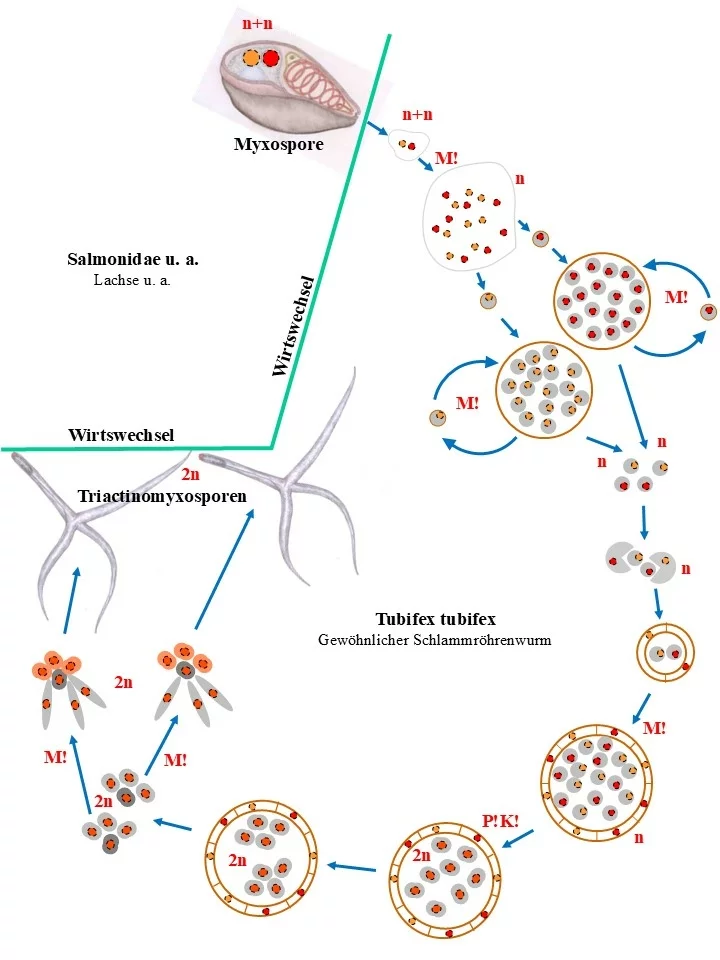
Myxosporidia, Lebenskeislauf 1. Teil (ppt-generiert; Reinhard Agerer)
Erklärung im Text
Nach Kent et al. (2001), Seite 399, Westheide & Rieger (2013), Seite 156 und nach eigenen Schlüssen
Eingestellt am 23. November 2024
.
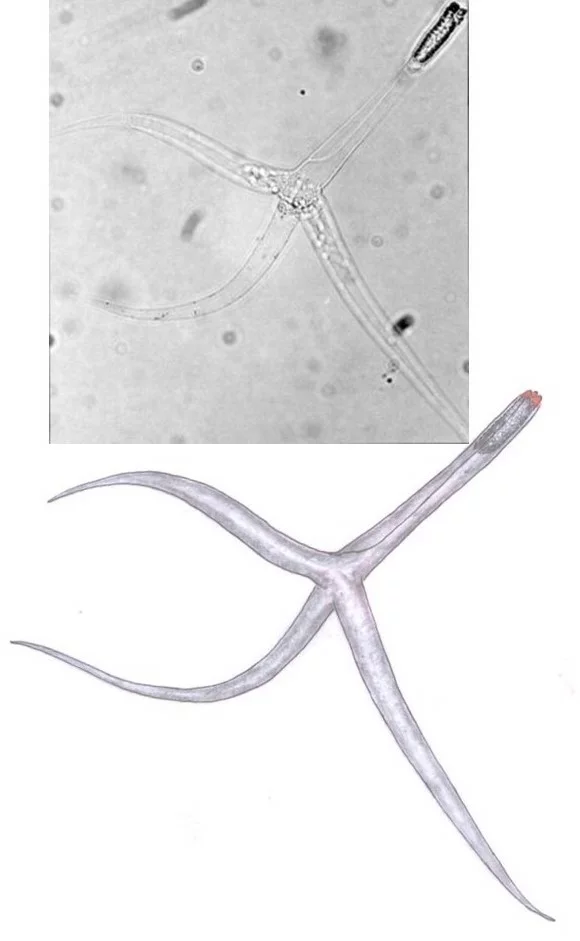
Oben: Triactinomyxospore von Myxobolus cerebralis
Autor: Eastern Ecological Science Center
Lizenz: public domain; unverändert
Unten: Triactinomyxospore von Myxobolus cerebralis (Tusche und Kreide; Reinhard Agerer)
Autor: Eastern Ecological Science Center
Eingestellt am 23. November 2024
.

Myxosporidia, Myxosporenbildner:
4 Des Lebenskreislaufs zweiter Teil (AP)
.
Durch Tod der Schlammröhrenwürmer[1], oder als Beute der Wirte,
Werden acht Triactinomyxosporen[2] aus ihrer Hülle befreit.
Verankern sich mit stark gebogenen Krallen, wenn im Wasser sie schweben,
In eines zweiten Wirts Kiemen[3] oder in schleimbedeckter, schlüpfrigen Haut.
.
So kommt der Stiel des Ankers nahe an eines Fischs Epidermis[4]:
Öffnen der Valven[7] geschlossene Fläche,
So tritt das Sporoplasma[8] hervor, bahnt sich durch den Schleim den Weg,
Dringt wie bei Myxosporen[9] zwischen Epidermiszellen in den Köper des Opfers,
Oder ins Kiemenepithel.
.
Des Sporoplasmas Kerne, die mittlerweile zu Zellen geworden, dringen einzeln
In des Opfers Zellen nun ein,
Formen nach einer Mitose[10] und darauffolgender interner Spaltung
Eine sekundäre Zelle, die von der ersten, der zuvor schon vorhand‘nen, umhüllt;
Sie stellt der sekundären damit einen Behälter, diese drückt der Behüllenden Zellkern zur Seite,
Quetscht ihn zwischen Plasmamembran[11] und eigener Hülle ein.
Der Sekundären anschließenden vielen synchron mitotisch[12] entstandene Töchter,
In der Sekundären Zellwand verbleibend, werden als Doppelkernzellen befreit.
.
Jede der Zellen wiederholt diesen Vorgang,
Erhöht erheblich damit des Schmarotzers[13] Infektionspotenzial.
Etablieren so einen Nebenkreislauf[14],
Der auf schnelle asexuelle Vermehrung[15] zielt.
.
Dringen in weitere, zunächst nur benachbarte Zellen,
Besiedeln gleichfalls jedoch den interzellulären Raum,
Wandern tiefer in Epidermis und Subcutis[16];
Infizieren dort wiederum Zellen, füllen mit Sporenpaketen sie aus.
.
– Etwa vier Tage nach Erstinfektion erreichen sie Nervenstränge,
Der Fische Rückenmark, ihr Gehirn;
Verursachen dadurch Drehkrankheit,
Deformieren das Skelett,
Schädigen Muskelgewebe;
So schwimmen die Opfer nicht mehr gerade, nur noch schraubig dahin. –
.
Ein weiteres Rätsel bleibt der Wissenschaft bislang noch zu lösen:
In die amoboide[19] Zelle der Myxospore?
Besteht doch aus sechs Zellen die Spore zunächst.
Woher Polkapsel bildende Zellen und Valvenzellen stammen, spielt keine weitere Rolle,
Doch der 2-Kern-Zelle Herkunft, aus zwei haploiden[20] Einzelzellen schon.
.
α- und β-Kern-Zellen, nach Meiose[21] entstanden, enthalten die
Sporoplasmen der Triactinomyxosporen gewiss.
Damit treffen sich immer wieder konträrgeschlechtliche Zellen,
Die zusammen mit zwei Polkapseln bildenden werden von zwei Valvenzellen umhüllt.
Der sexuellen Fortpflanzung[24] erster Akt.
So bleiben in Myxosporen 2-Kern-Stadien für einige Zeit bestehen,
Doch dies erfolgt frühestens, wie schon gesehen, im
Ersten Teil des Kreislaufs wieder, in Tubifex tubifex[28], im ersten Wirt.
.
So hat sich der Lebenszyklus[29] geschlossen:
Sterben die Opfer, freu’n sich Tubifex-Würmer,
Nehmen mit Aas[30] als Nahrung auch Myxosporen.
Sie leiden recht wenig darunter, geben später Triactinomyxosporen ab,
Oder werden Beute von hungrigen Fischen[31],
Die nicht merken, was danach ihnen passieren wird. –
.
Wer solch einen Entwicklungskreislauf für sich hat erfunden,
Braucht sicherlich Hunderte Millionen Jahre dafür;
Auch sind damit explosive asexuelle Vermehrungsphasen verbunden,
.
Fußnoten
[1] Gewöhnlicher Schlammröhrenwurm: Tubifex tubifex (Tubificidae – Oligochaeta – Clitellata – Annelidae – Schizocoelia –…)
[2] Triactinomyxosporen (Myxosporidia): Zweite, diploide (?), Sporengeneration der Myxosporidia; aufgebaut aus vielkernigem, aus einer einzelnen Zelle entstandenem Plasmodium, drei Polkapseln und drei alles bedeckenden ankerförmigen Kapselzellen
[3] Kiemen: Spezialisierte Atmungsorgane bei wasserlebenden Tieren
[4] Epidermis: Auch Oberhaut genannt, als äußerste Schicht der Haut, die eigentliche Schutzhülle gegenüber der Umwelt; besteht aus mehrschichtigem, verhornendem Plattenepithel
[5] Polkapsel: Umgewandelte Nesselkapsel
[6] Schläuche: Schraubig aufgerollte, schlauchartige, intrazelluläre Strukturen
[7] Valven, Kapselzellen, (Myxosporidia): Polkapseln umschließende Zellen
[8] Sporoplasma: Vielkerniges Plasmodium in der Basis der Triactinomyxospore
[9] Myxosporen: Erste, haploide, Sporengeneration der Myxosporidia; aufgebaut aus sechs Zellen: zwei Polkapseln, zwei Zellen, die zu einer zweikernigen amöboiden Zelle verschmolzen sind und zwei Kapsel(Hüll)-Zellen, die vier anderen umgebend
[10] Mitose, mitotisch: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstanden Zellen wirken
[11] Plasmamembran, Zellmembran: Lipiddoppelmembran um den Zellinhalt herum
[12] Synchrone Mitosen: Mitotische Teilungen von zwei oder mehreren Kernen, die koordiniert gleichzeitig ablaufen
[13] Schmarotzer, Parasit: Ein Organismus lebt auf Kosten eines anderen
[14] Nebenkreislauf, Nebenfruchtform: Eine asexuelle Vermehrung, die nicht direkt in den Entwicklungkreislauf (Hauptkreislauf, Hauptfruchtform) eingeschaltet ist, sondern für eine seiner Phasen der schnellen, oft explosionsartigen Vermehrung dient
[15] Asexuell (Vermehrung): Nur aufgrund von Mitosen gebildet
[16] Subcutis: Meist aus lockerem Bindegewebe bestehende untere Schicht der Haut
[17] Konträrgeschlechtliche, kompatible Kerne: Für Karyogamie sind zwei sexuell unterschiedliche, konträrgeschlechtliche, damit kompatible Kerne (männlicher und weiblicher Kern oder plus (+)- und minus (–)-Kern oder α- und β-Kern) nötig
[18] α- und β-Kerne: konträrgeschlechtliche, für Karyogamie kompatible Kerne
[19] Amöboid: Wie Amöben, Wechseltierchen, gestaltet, oder sich so beim Bewegen verhaltend
[20] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n
[21] Meiose, meiotisch: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne in letztlich vier Zellen liegen.
[22] Plasmogamie: Verschmelzung der Protoplasten zweier Zellen im Zuge sexuellere Fortpflanzung; abgekürzt P!
[23] Generative Zellen: Gameten
[24] Sexuelle Fortpflanzung: Dafür sind drei Vorgänge miteinander gekoppelt, Meiose (abgekürzt mit R!), Plasmogamie (Zellen vereinen sich, abgekürzt mit P!) und Karyogamie (Kerne verschmelzen, abgekürzt mit K!) verbunden, wobei P! und K!, mit Ausnahme bei Dikaryota, unmittelbar aufeinander folgen. Bei Dikaryota (Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya) sind beide Vorgänge unterschiedlich lang (weit) voneinander getrennt. Da bei Animalia und Plantae P! und K! unmittelbar aufeinander folgen, werden beide Vorgänge häufig zu Befruchtung (B!) zusammengefasst.
[25] Karyogamie: Verschmelzung zweier haploider Zellkerne; abgekürzt K!
[26] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand
[27] Kompatible, konträrgeschlechtliche Kerne: Für Karyogamie sind zwei sexuell unterschiedliche, konträrgeschlechtliche, damit kompatible Kerne (männlicher und weiblicher Kern oder plus (+)- und minus (–)-Kern oder α- und β-Kern) nötig
[28] Tubifex tubifex: Gewöhnlicher Schlammröhrenwurm (Tubificidae – Oligochaeta – Clitellata – Annelida – Schizocoelia –…)
[29] Lebenskreislauf, Lebenszyklus, Entwicklungszyklus, Entwicklungskreislauf: Ein Kreislauf (eigentlich ist es eine Schraube, weil immer Neues entsteht, das zwar dem Anfänglichen gleicht, doch zeitlich später kommt), in dem sexuelle Fortpflanzung erfolgt. Zusätzlich kann noch in regelmäßigem Wechsel eine Phase der asexuellen Vermehrung eingeschlossen sein.
[30] Aas: Tierleiche, Kadaver, Fleisch verendeter Tiere
[31] Fische: Teleostei i.e.S. (Actinopterygii – Osteognathostomata – Gnathostomata – Umericingulata – Lacertipinnatae –…)
[32] Oligochaeta: Wenigborstler (Clitellata – Annelida – Schizocoelia – Spiralia – Protostomia –…)
SL Kent ML, Andree KB, Bartholomew JL, El-Matbouli M, Desser SS, Devlin RH, Feist SW, Hedrick RP, Hoffmann RW, Khattra J, Hallett SL, Lester RJG, Longshaw M, Palenzuela O, Siddall ME, Xiao C (2001) Recent advances in our knowledge of the Myxozoa. J Eukar Microbiol 48(4): 395-413.
Eingestellt am 23. November 2024
.
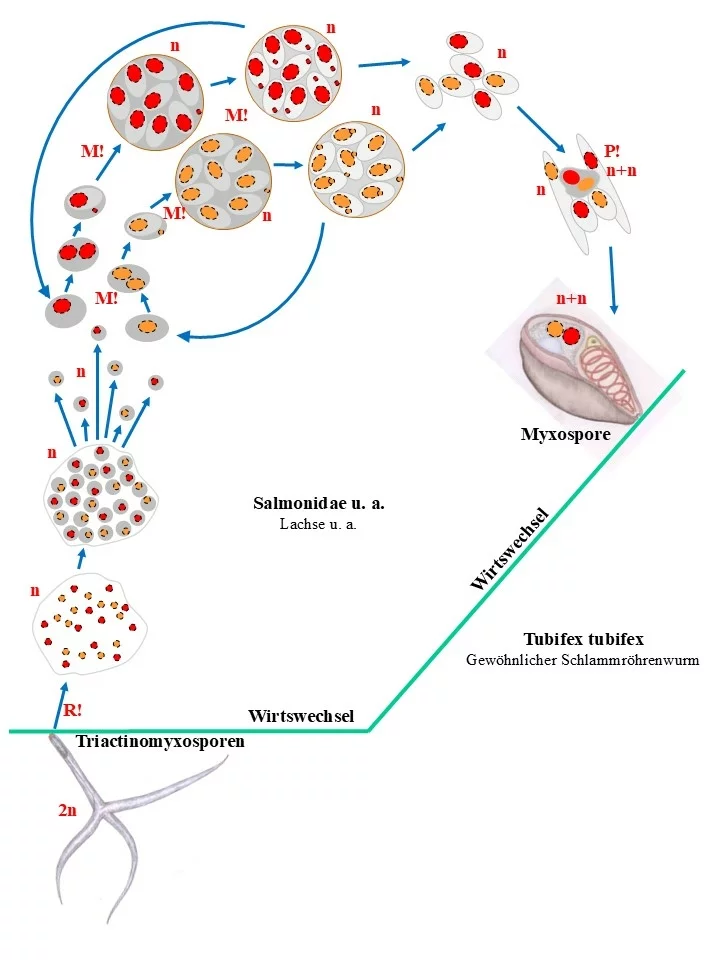
Myxosporidia, Lebenskeislauf 2. Teil (ppt-generiert; Reinhard Agerer)
Erklärung im Text
Nach Kent et al. (2001), Seite 399, Westheide & Rieger (2013), Seite 156 und nach eigenen Schlüssen
Eingestellt am 23. November 2024
.

Myxozoa, Parasitische Nesseltiere:
1 Alles auf den Schlauch gesetzt
.
Als Kapsel in einer Zelle gebildet, gegen die Beute aus,
Jagen Giftsubstanzen, die Beute zu töten, danach zu verzehren,
Aus dem schraubig aufgerollten, sich umstülpenden Schlauch,
So verwenden manche doch auch Leim[3], festzuhalten das Opfer,
Bis sich, was sie gefangen, beruhigt und das Gift wirkt.
.
Erinnern wir uns noch an Magrovenquallen[4],
Jene, die mit Schirmbuckel am Boden fixiert,
Winzige Bällchen, mit Nesselkapseln[5] und ein paar anderen Zellen,
Auch mit Zooxanthellen[6], bestückt, fortschickte als Projektil,
In der Hoffnung kleine Krebstierchen[7] damit zu töten und
Fielen danach tot auf sie herab?
.
Sie selbst aber scheint eher auf Zooxanthellen angewiesen zu sein.
Wer weiß, ob nicht Cassiosomen sich bereits verselbständigten,
Und Jagd und asexuelle Vermehrung[10] ihre alleinigen Aufgaben sind.
.
Auch Ctenophora[11] nutzen aufgeschraubte Schläuche,
Nicht jemand zu paralysieren oder zu töten gar.
Einen großen domförmigen Klebknopf, aus einzelnen Leimportionen
Hängen sie an eine aufgespulte Angelschnur, die innen hohl.
Ermüden damit Beute, lassen sie nicht mehr entkommen,
.
Myxozoen verselbständigten, mehr als Cassiopea dies schon zeigte, Fangapparate,
Verzichten auf alles, was den Quallen[14] so wert,
Stellen Fallen in des Lebenskreislaufes Mitte,
Bauen ihr Leben um sie herum.
.
Fußnoten
[1] Cnidaria: Nesseltiere (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)
[2] Cnidocyten: Nesselkapseln bildende Zellen
[3] Spirocysten, Klebkapseln: Deren umgestülpter Schlauch nach Explosion als gerades Stück aus der Cnide ragt, dem, spiralig nach rückwärts wickelnd, sich sein erheblich längerer Teil anschließt und mit klebriger Masse umgeben ist
[4] Mangrovenqualle: Cassiopea xamachana (Cassiopeidae; nicht behandelt – Discomedusae – Scyphozoa – Medusozoa – Cnidaria –…)
[5] Nesselkapseln: In Nesselzellen gebildete, kapselartige Gebilde, die bei Reizung der Nesselzellen ihr schlauchartiges Fangorgan hervorschleudern
[6] Zooxanthellen: Endosymbionten in einer Reihe von Lebewesen. Bei den Zooxanthellen handelt es sich meistens um Dinoflagellaten; aber auch um Chrysomonden, Cryptomonaden, Chlorococcales oder Diatomeen kommen vor
[7] Krebstiere, Krebsartige: Crustacea (Tetraconata – Mandibulata – Arthropoda – Panarthropoda – Ecdysozoa –...)
[8] Medusen, Quallen: Ein freischwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere
[9] Cassiosomen: Von geißeltragendem Ektoderm und von Cnidocyten umgebene, von Mundarmen abgegebene, frei flottierende, Zooxanthellen und Amoebocyten beinhaltende, winzige Gallertkügelchen, die dem Beuteerwerb dienen
[10] Asexuell: Nur aufgrund von Mitosen gebildet
[11] Ctenophora: Rippenquallen (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)
[12] Tentakel: Lange, bewegliche, filigrane, oft mit Seitenzweigen (Tentillen) versehene, Klebfallen tragende Fangarme
[13] Mund-After-Öffnung: Körperöffnung, die zugleich als Mund und After verwendet wird
[14] Quallen: Schirm- oder glockenförmige Nesseltiere
Eingestellt am 23. November 2024
.

Octocorallia, Achtarmkorallen:
1. Was sie zusammenhält
.
Acht Fiedertentakel[1] führen mit Hohlräumen
Nach innen zu bleiben die Taschen selbstredend offen,
Ermöglicht wird Zu- und Abfuhr des Wassers damit.
.
Nur ein Nesselkapseltyp[4] ist ihnen gegeben,
Nicht der schlachtende, der das Opfer mit Stiletten durchschlägt[5],
Sondern der, der in Etagen feine Haare[6] trägt, wenn ein- und ausgestülpt das Ende;
Wirkt wie eine Flaschenbürste mit oben herausstehendem Draht[7].
.
Was Molekularbiologen[8] ohne Zweifel erheblich verwundert,
Das nur Blumentiere[11] besitzen,
Bislang von keinem anderen Tier ist bekannt.
.
Aller Blumentiere Ordnungen Skelette vergleichend betrachtet,
Zeigt zunehmende, als Höherentwicklung anzunehmende Komplexität:
Die anderen werden zum anastomosierenden[14] Netz, das
Fortschrittliche zur durchgehenden Platte vereinen,
Die basal mit kalkigem Außenskelett sich umgibt.
.
Andere evolutive Linien erfanden ein gemeinsames Gewebe[15],
Anfangs nur mit Skleriten[16] verstärkt,
Werden diese, wenn weiterentwickelt, zur festen zentral gelegenen Achse,
Die ein kompaktes, zentrales Skelett schließlich ergibt.
.
Mit wenigen Ausnahmen nur bilden sie mehrköpfige Tierstöcke[17] mit
Coenenchym oder mit sehr komplexem Stolonengeflecht.
.
Nicht durch Einstülpung, nicht durch typische Gastrulation[26].
.
Die lange nur morphologisch beschriebenen Gruppen, wie Lederkorallen[27],
Hauptsächlich aus molekularphylogenetischen[33] Gründen
Zu lediglich zwei morphologisch weit differierenden Ordnungen zusammengefasst.
.
Fußnoten
[1] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[2] Mesenterien: Scheidewände im Innern von Polypen, die den Gastralraum aufteilen
[3] Gastralraum: Großraum in den alle wasserführenden Taschen und Kanäle münden
[4] Nesselkapseln: In Nesselzellen gebildete, kapselartige Gebilde, die bei Reizung der Nesselzellen ihr schlauchartiges Fangorgan hervorschleudern
[5] Stenotelen: Nesselkapseln mit stilett- oder skalpellartigen, leicht gekrümmten, messerscharfen, oft in zwei Etagen angeordneten Strukturen an der etwas verbreiterten Basis des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs
[6] Mastigonemen (allgemein): Dünnste Härchen an einer mikroskopisch kleinen Struktur
[7] Mastigophoren, Rhabdoiden: Nesselkapseln mit rundum etagiert angeordneten Mastigonemen in der unteren Hälfte des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs
[8] Molekularbiologen: Beschäftigen sich hauptsächlich mit verschiedensten organischen Molekülen, um Organismen zu erforschen
[9] Mitochondrial: Von/in/durch Mitochondrien
[10] Reparaturgen: Gen dessen Produkte Gendefekte beseitigen und die ursprüngliche Basensequenz wiederherstellen
[11] Blumentiere: Anthozoa (Cnidaria – Animalia – Opisthokonta – Eukarya)
[12] Stolonen: Basale, hohle Ausläufer, die benachbarte Polypen miteinander verbinden
[13] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.
[14] Anastomosieren: Sekundäre Verbindungen herstellen zwischen Röhren oder hohlen Trichomen
[15] Coenenchym: Dicke Gewebeschicht als gemeinsame Lebensbasis von Polypen, ohne im Inneren ein Skelett zu bilden.
[16] Sclerite, Scleren, Spicula: Meist nadelförmige Gebilde
[17] Tierstock: Aussehen einer Kolonie, doch sind die einzelnen Individuen über ein gemeinsames Gewebe verbunden, unterscheiden sich darin von Kolonien, die durch dichtes Siedeln einzelner Individuen gekennzeichnet sind.
[18] Gonaden: Geschlechtszellen bildende Organe
[19] Dotterreiche Eier: Eier, die viel Dotter, Ansammlungen von Reservestoffen in Form von Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten, besonders Glycogen enthalten
[20] Total-äquale Furchung: Die Zygote und deren Abkömmlinge hin zur Blastula teilen sich vollkommen, und gleichzellig, es bleiben keine Partien ungeteilt; Teilungsweise dotterarmer Eier (Zygoten)
[21] Partiell-superfizielle Furchung: Aus dem Zellkern der Zygote entstehen durch viele synchrone und schnell aufeinanderfolgende Kernteilungen ohne nachfolgende Zellteilungen viele weitere Zellkerne. Anschließend wandern die meisten Kerne in die Peripherie und dann stülpt sich zwischen benachbarten Kernen die Plasmamembran ein (superfiziell, also oberflächlich), so dass jeder Kern in einer zum innen liegenden Dotter hin offene Verbindung behält.
[22] Getrenntgeschlechtlich: Weibliches und männliches Geschlecht sind auf zwei verschiedene Individuen verteilt
[23] Ovipar: Eizellen oder Zygoten verlassen das Mutterzoon
[24] Delamination: Entodermbildung erfolgt durch Ablösung der inneren Lage einer zweischichtig gewordenen Blastula
[25] Blastula: Einzellschichtiges Hohlkugelstadium während der Ontogenese von Animalia
[26] Gastrulation: Vorgang der Gastrulabildung, dabei stülpt sich im typischen Fall die Blastula zur Gastrula ein, bildet dadurch ein zweizellschichtiges Stadium
[27] Lederkorallen: Alcyonacea (ehemals eigene Ordnung der Anthozoa)
[28] Kalkachsenkorallen: Scleraxonia (ehemals eigene Ordnung der Anthozoa)
[29] Hornkorallen: Holaxonia (ehemals eigene Ordnung der Anthozoa)
[30] Federkorallen: Pennatulacea (ehemals eigene Ordnung der Anthozoa)
[31] Stolonenkorallen: Stolonifera (ehemals eigene Ordnung der Anthozoa)
[32] Blaue Korallen: Helloporida (ehemals eigene Ordnung der Anthozoa)
[33] Molekularphylogenie: Auf Molekülähnlichkeiten (meistens von DNA, doch mitunter auch von Proteinen) basierende Schlüsse bezüglich Stammesgeschichte bzw. Verwandtschaftslinien von Organismen
Eingestellt am 23. November 2024
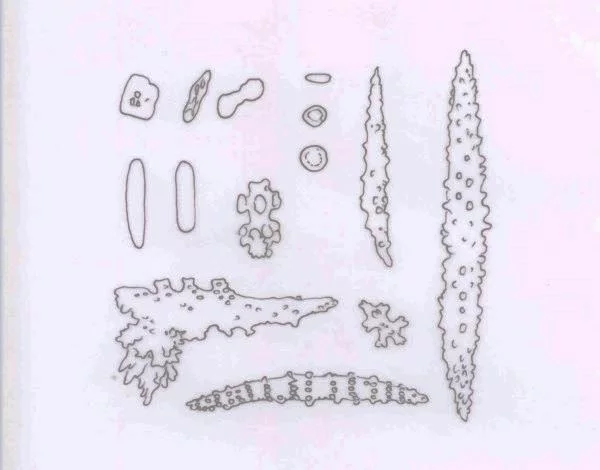
Kalkspicula der Octocorallia (Tusche, Reinhard Agerer)
Nach Grzimek B, Herausg. (1979) Tierleben 1, Niedere Tiere, Seite 246
Eingestellt am 23. November 2024
.

Pennatulacea, Seefederartige:
1 Gemeinsames
.
Stab- oder federförmig wächst ihr Stock[1] auf festem,
Nicht zu hartem, noch gut durchdringbarem Grund,
In dem er mit grabendem Fuß sich Halt will verschaffen,
Polypen[2] dem Meer zu exponieren im oberen Teil.
.
Eine Larve[3] begann die grabende Arbeit,
Streckt sich zunächst als Stammpolyp[4],
Sich seitlich steil zu verzweigen, Platz zu geben weiteren Köpfen[5],
Sich zu entwickeln zum Pennatulacea-Stock.
.
Eingesenkt sitzen Polypen auf einfachem, unverzweigtem,
Oder auf federartig zerteiltem Stamm.
Ein horniges Achsenskelett entsteht mit der Zeit in des Tierstockes Zentrum,
Auch Kalknadeln[6] im Gewebe tragen zur Festigkeit bei.
.
In dem zweierlei Polypen ihr Zuhause sich bilden:
Siphonopolypen[9], die keine oder rudimentäre Tentakel nur tragen,
Deren Wasseraufnahme den Tierstock zum Schwellen bringt.
.
Nicht nur der junge, der Stammpolyp, gräbt sich ein in den Boden,
Auch Tierstöcke mitunter bewegen sich etwas vom Ort;
Verlieren den Halt sie einmal doch, kommen sie unglücklicherweise zu liegen,
Müh’n sie sich kräftig, geben nicht auf:
.
Krümmen im rechten Winkel den Grabfuß nach unten,
Schaffen im Grund durch An- und Abschwellen einen winzigen Raum,
Senken nach und nach ihn immer weiter nach unten,
Dann hebt sich ein wenig schon der Kiel nach oben empor,
Sinkt jedoch wieder, weil zu wenig tief noch die Grube;
Doch Aufgeben gibt es nicht für sie!
Immer steiler wird zur Unterlage der Winkel,
Steht schließlich aufrecht wie schon zuvor.
.
Wer in die grabenden Federn ein bisschen sich eindenkt,
Nimmt sofort berechtigterweise an,
Sie entledigen sich all ihres Wassers in Hohlräumen,
Schrumpfen zusammen, sind nur ein Zehntel dann groß.
.
Vier Familien werden wir kurz nur behandeln, der
Beinahe zwanzig, die derzeit geführt.
.
Fußnoten
[1] Tierstock: Aussehen einer Kolonie, doch sind die einzelnen Individuen über ein gemeinsames Gewebe verbunden, unterscheiden sich darin von Kolonien, die durch dichtes Siedeln einzelner Individuen gekennzeichnet sind.
[2] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.
[3] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria
[4] Stammpolyp, Primärpolyp: Polyp, der sich als erster ansiedelt, um nach und nach sich verzweigend, sich mit weiteren Polypen zu versehen
[5] Polypen
[6] Sclerite, Scleren, Spicula: Oft nadelförmige Gebilde
[7] Nährpolypen, Fresspolypen: Typische, mit Fangtentakel versehene, sich mit Beute versorgende Polypen
[8] Tentakel (Nesseltiere): Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[9] Siphonopolypen: (Fast) tentakellose Polypen, die nur der Wasserversorgung und dem Wasseraustausch für Sauerstoffgewinnung dienen
Eingestellt am 23. November 2024
.

Pennatulidae, Echte Seefedern:
1 Wie eine Feder
.
In der Tat, wie eine Feder ist Pennatula rubra[1]
Mit etwa zwei Dutzend leicht gekrümmten, dünnen Fiedern[2] der Achse entlang,
Die untern, wie die oberen, bedeutend kleiner,
Sitzen, gebogen etwas, dicht dem Kiel oberseits an.
.
Achsenskelett stabilisiert die Feder;
Sicherlich nötig, weil kopflastig sie uns erscheint.
Eng gereiht, obenauf sitzen den Fiedern Nährpolypen[3],
Schlauchpolypen[4] zwischen den Fiedern am Stamm,
Bedecken gleichfalls die Oberseite,
Nur in der Mitte bleibt ein dünner Streifen frei.
.
Kalkstacheln sitzen am Rande der Fiedern,
Geben wohl Polypen nötigen Schutz.
Will ein hungriges Tier daran zupfen, so
Stechen den Frechen sie, der umkehrt und flieht.
.
Im Mittelmeer und Ostatlantik ist die Rote Feder verbreitet,
Liebt es mit knapp siebzehn Grad Celsius recht kühl,
Wächst bis zu vierzig Centimeter in Höhe,
Nischt[5] zwischen zwanzig und sechshundert Meter Tiefe sich ein.
.
Fußnoten
[1] Pennatula rubra: Rote Seefeder (Pennatulaceae – Pennatulacea – Scleralcyonacea s. l. – Octocorallia – Anthozoa – …)
[2] Fiedern: Seitenstrahlen meist gleicher Gestalt einer gemeinsamen Achse entlang
[3] Nährpolypen, Fresspolypen: Typische, mit Fangtentakel versehene, sich mit Beute versorgende Polypen
[4] Schlauchpolypen, Siphonopolypen: (Fast) tentakellose Polypen, die nur der Wasserversorgung und dem Wasseraustausch für Sauerstoffgewinnung dienen
[5] Einnischen: Ein Organismus, der sich allmählich in einer neuen ökologischen Nische ausbreitet
Eingestellt am 23. November 2024

Pennatula rubra, Rote Seefeder
Autor: Pino Bucca
Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
.

Renillidae, Blattseefedern:
1 Meerstiefmütterchen
.
Flach liegt das Meerstiefmütterchen[1] mit
Herz- oder nierenförmigem Coenenchym[2] auf dem Grund,
Festgehalten nur mit Stiel des Stammpolypen[3],
.
Der Schlauchpolypen weißer Mund ziert mit
Weißen Punkten das purpurne, oft violette Blatt;
Nährpolypen ragen mit Tentakelköpfchen[6] über die Ebene:
Ein herrliches Bild für den Taucher, liegen Hunderte Blüten vor ihm.
.
Wurzelgleich hält sie der Grabfuß im sandigen Boden;
Ob er die Stellung wechselt, ist nicht bekannt.
Mit einigem Recht lässt dies sich aber vermuten,
Scheiden Schleim die Polypen doch aus,
Plankton und Kleinstgetier einzufangen,
Das schließlich Tentakel bringen zum Mund[7].
.
Denn Sand liegt gelegentlich auf des Stiefmütterchens Fläche.
Ihn wieder loszuwerden, bestünde jeglicher Grund,
Den Ankerfuß zu dehnen, das Blatt zur Seite zu kippen;
Wenn Polypen in ihre Höhlung geschlüpft,
Könnte Schleim der schwere Sand mit sich ziehen,
Dann wäre des Blattes Oberfläche gleich wieder rein;
Keine feste Achse würde den Vorgang behindern.
.
Das nierenförmige Seestiefmütterchen
Warnt, falls gereizt, wenn jemand naht:
Leuchtet plötzlich grünlich nach oben,
Produziert Licht durch Biolumineszenz[11].
.
Wer diese Stiefmütterchen selbst will betrachten,
Tauche den Küsten North Carolinas, Floridas und Mexikos hinab;
Tief muss er nicht blicken, denn schon auf Meereshöhe sind sie zu finden,
Geh’n aber bis siebenhundertundsiebzig Meter hinab.
.
Fußnoten
[1] Meerstiefmütterchen, Seestiefmütterchen: Renilla reniformis (Renillidae – Pennatulacea – Scleralcyonacea s. l. – Octocorallia – Anthozoa – …)
[2] Coenenchym: Dicke Gewebeschicht als gemeinsame Lebensbasis von Polypen, ohne im Inneren ein Skelett zu bilden.
[3] Stammpolyp, Primärpolyp: Polyp, der sich als erster ansiedelt, um nach und nach sich verzweigend, sich mit weiteren Polypen zu versehen
[4] Nährpolypen, Fresspolypen: Typische, mit Fangtentakel versehene, sich mit Beute versorgende Polypen
[5] Schlauchpolypen, Siphonopolypen: (Fast) tentakellose Polypen, die nur der Wasserversorgung und dem Wasseraustausch für Sauerstoffgewinnung dienen
[6] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria
[7] Mund-After-Öffnung: Körperöffnung, die zugleich als Mund und After verwendet wird
[8] Renilla reniformis
[9] Carotinoide: Carotinoide sind lineare Kohlenwasserstoffe mit vielen konjugierten Doppelbindungen (= benachbarte Kohlenstoffatome sind in wechselnder Abfolge mit einer einfachen und einer Doppel-bindung miteinander verknüpft), an deren beiden Enden jeweils ein Kohlenstoffring aus sechs Atomen hängt. Je nach Lage einer Doppelbindung in diesen Sechserringen und ob eine Hydroxylgruppe [–OH] oder andere zusätzliche Gruppen an Sechserringen hängen, werden verschiedene Typen an Carotinoiden unterschieden, die auch in ihrer Färbung voneinander abweichen und somit Licht anderer Wellenlängen aufnehmen können; nicht selten nur als Farbstoff vorhanden.
[10] Sclerite, Scleren, Spicula: Oft nadelförmige Gebilde
[11] Biolumineszenz: Emission kalten, sichtbaren Lichts eines Lebewesens
Eingestellt am 23. November 2024
.

Meerstiefmütterchen, Renilla reniformis
Autor: en:user:Job
Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert
Eingestellt am 23. November 2024
.

.