Eukarya Texte
zum Glossar über:

Eukarya, Echtzellkerner
1 Innovativ (HP,SP)
.
Sitzen auch fest an diversen Substraten.
Widerstandsfähig mit Wand umhüllt,
Bleibt ihre Form wie anfangs sie war.
.
Bleibt flexibel, passt dem porigen Felsen an.
Nahrhaften Inhalt von Spalten und Rissen begehrt sie, zwängt sich gewaltsam,
Sich ständig verformend, in tiefergründige Engen hinein.
.
Optimiert zukunftsstrategisch innovativ Syntheseaktionen.
Nutzt es besser zu schnellem Transport
Zu ihrer Substanzen Verarbeitungsort.
.
Nicht Flagellin[7] liegt am Ende des chemischen Weges. Actin ist die Zukunft!
Solide und zugfest, am Rande der Zelle vernetzt,
Stabilisiert es als feine Fibrillen des Bionten[8] Gestalt,
Erlaubt zudem Verjüngen in klammenge Ritzen hinein.
.
Verknüpfen und Lösen aktiver Fibrillen, myosinvermittelt[9]
Unter Hilfe von Adenosintriphosphat[10],
Hält Zellen beweglich, ermöglicht Wandern
Zu organischer Quellen nahrhaftem Grund.
.
Beulen Membranen nach außen,
Andere dellen sie einwärts, stülpen nach innen kleinere Höhlungen:
Schon umgeben, gefängnisgleich drohend, Lipide den nahrhaften Fang.
.
Membranen, eng in Kontakt, geh‘n neue Verbindungen ein:
Knospen nach innen als runde Vesikel[13],
Umschließen Nahrung, sie zu zerlegen in nutzbare Happen.
Verdauungsenzyme liegen am arbeitsbezogenen Ort.
.
Gezieltes Verdauen organischer Masse
Enthebt Bionten ständiger Suche nach löslichem Gut.
Amöbengleich[14] wandernd, erbeuten sie höhere Mengen energiereicher Nahrung.
Nehmen erheblich an Größe und Reichweite zu, noch erbärmlich aber bleibt die Infrastruktur.
.
Fußnoten
[1] Archäen, Archaea: Bilden zusammen mit Bakterien die sog. Prokaryo(n)ten, die noch keinen echten Zellkern und keine komplex gebauten Chromosomen besitzen. Sie unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Deshalb wurden die Archäen in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts als eigene Organismen-Domäne der Domäne der Bakterien gegenübergestellt
[2] Bakterien, Bacteria: Bilden zusammen mit Archäen die sog. Prokaryo(n)ten, die noch keinen echten Zellkern und keine komplex gebauten Chromosomen besitzen. Sie unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Deshalb wurden die Archäen in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts als eigene Organismen-Domäne der Domäne der Bakterien gegenübergestellt
[3] Echtzellkerner, Eukarya: Die evolutiv jüngste, fortgeschrittenste der drei bekannten Domänen sind die Eukarya mit echten Zellkernen, mit interner Kompartimentierung aus unterschiedlich gestalteten Zisternen und Vesikeln, sowie hochkomplexen Chromosomen
[4] Zellwand: Eine aus Polymeren aufgebaute Hülle, die die Zellen von Pflanzen, Bakterien, Pilzen, Algen und Archäen umgibt
[5] Actin, Fädiges Actin: Actin ist ein häufiger Bestandteil des Cytoskeletts und kommt besonders in Muskelzellen vor; zu Fäden polymerisiert (F-Actin), dient es der Stabilisierung der äußeren Zellform sowie der Ausbildung von Zellfortsätzen, intrazellulären Verlagerungen und gerichteten intrazellulären Bewegungen
[6] Flagellum, Archäengeißel: Aus vielen globulären Proteinen zusammengesetzte nichthohle Peitsche;
Bakteriengeißel: Aus vielen globulären Flagellinproteinen zusammengesetzte Hohlröhre. Geißeln der Eukarya sind vollkommen anders gebaut.
[7] Flagellin: Globuläres Protein, das sich zu vielen selbst zu einem Hohlzylinder anordnet und im westlichen das Flagellum der Prokaryoten (Bakterien und Archäen) bildet
[8] Bionten: Allgemeine Bezeichnung für Lebewesen
[9] Myosin: Eine Familie von Motorproteinen eukaryotischer Zellen. Kooperiert mit anderen Motorproteinen wie Kinesin und Dynein wesentlich am intrazellulären Transport von Biomakromolekülen, Vesikeln und Zellorganellen längs des Cytoskeletts; ist aber allein an Actinfilamenten tätig.
[10] ATP: Adenosin-Tri-Phosphat; bestehend aus Ribose und Adenin; Ribose trägt an seiner nicht in den Zuckerring einbezogenen Kohlenstoffgruppe drei hintereinander liegende Phosphatgruppen. Diese lineare Anordnung der Phosphate hat zur Folge, dass das dritte, äußerste Phosphat, mit seiner ihm dadurch innewohnenden Energie, diese leicht unter Abspaltung auf andere Moleküle übertragen kann
[11] Cholin [(CH3)3N+CH2CH2OH]: ist ein Amin und bildet zusammen mit dem daran gebundenen Phosphat die hydrophile Gruppe des Phospholipids, der Hauptkomponente der Lipidmembranen
[12] Lipidmembran (Bacteria, Eukarya): Lipide, bestehend aus einem mit drei Hydroxylgruppen [–OH] versehenen Glycerinmolekül, an dem zwei Fettsäuren und ein Cholin unter Wasserabspaltung angeknüpft sind, zeigen einen hydrophilen Kopf (Glycerin und Cholin) und den hydrophoben Fettsäureschwanz; nach dem Motto Gleich zu Gleich gesellt sich gern, ordnen sich die hydrophilen Köpfe zum einen und die hydrophoben Schwänze zum anderen nebeneinander an und bilden eine geschlossene Schicht; eine Doppelmembran entsteht dann, wenn sich zwei solcher Schichten, hydrophobe Schwänze zueinander gereckt, aneinanderlegen
[13] Vesikel (Zellvesikel): Kleine, abgegliederte, rundliche, doppelmembranumhüllte Behälter.
[14] Amöben, Wechseltierchen: Verändern ständig ihre Form, weil zellwandlos, stülpen Fortsätze des Protoplasten aus, umfließen Nahrung, um Nahrungsvakuolen (Endosomen) zu bilden, ihren Fang zu verdauen. Amöben kommen in verschiedenen Organismenreichen vor; repräsentieren also keine Verwandtschaft, sondern nur eine Lebensstrategie; ein Organismenreich (Amoebozoa) umfasst jedoch nur Amöben
Eingestellt am 6. Juli 2024
.
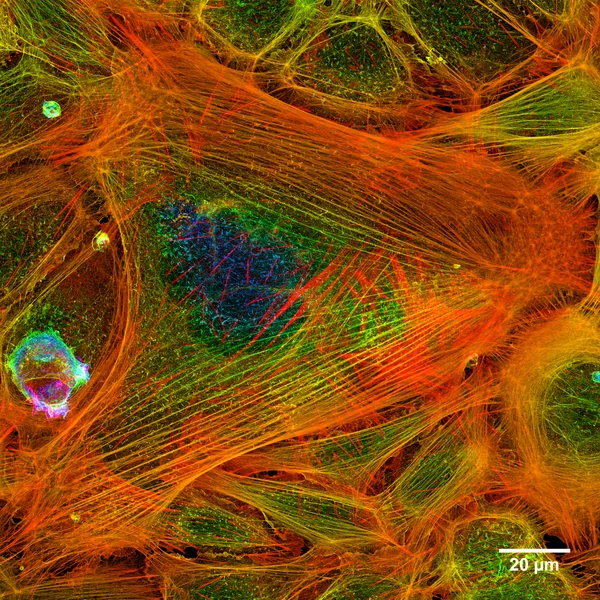
Actinfilamente einer eukaryotischen Zelle
Ein zusammengefügter Stapel Konfokaler Aufnahmen zeigt Actin-Filamente einer Zelle.
Autor: Howard Vidin
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
Eingestellt am 6. Juli 2024
.

Eukarya, Echtzellkerner
2 Transportschienen (SP,pJP)
.
Verdauungsvesikel[1] bereiten benötigte Hauptmoleküle,
Je auf bestimmte Substanzen fixiert,
.
Verdauungsprodukte verbleiben zunächst am Rande der Zelle,
Wären im Innern bedeutsam jedoch für funktionelle Prozesse.
Effektive Transportmechanismen für Vesikel[7] besteh‘n aber noch nicht,
Wären jedoch dringend geboten für des Lebens Funktion.
.
Kaum Engpässe in der Ernährung verspüren die neuen Bionten[8]!
Woraus, zu Dimeren[13] vereint, letztlich Fäden entsteh‘n.
.
Zwölf oder dreizehn, manchmal auch vierzehn und fünfzehn
Verbinden sich Seite an Seite zur englumigen Röhre.
Bauen, wenn nötig, Dimere am Hinterpol ab,
Verlängern damit den andern, so zügig wachsenden Pol. –
.
Die Röhren bewegen sich nicht,
Durch Ab- und Anbau jedoch erreichen sie jeglichen Ort. –
.
Schienen sind sie für den Transport von Vesikeln.
Nur Vehikel fehlen für den Verkehr! Ja nicht verzagt!
Schon konstruieren Enzyme neue Modelle:
.
Huckepack nehmen die beiden je ein Vesikel,
Beschreiten auf doppelten Füßchen die Mikrotubuliröhren[16],
Verwenden Schritt für Schritt als Treibstoff ATP[17].
Kinesin liefert nach vorne, Dynein wandert zum hinteren Ende hin.
.
Schienen und Bahnen verlaufen bald kreuz und quer,
Doch Amöbium[18] gibt die Hauptrichtung vor,
Schickt baustoffbeladne Vesikel an seinen unruhigen Rand,
Lappige Füßchen zu bilden, um auf Wanderschaft damit zu geh‘n.
.
Vesikel integrieren sogleich ihre Hülle[19]
Ins Plasmalemma[20] der Zelle:
Stülpen dabei wie von selbst
Frachtgut fürs Gleiten in des Bionten benachbarten Raum.
.
Der Transport in die Außenwelt wird Exocytose[21] genannt,
Steht mit Endocytose[22] im Wechselspiel.
Fürs Gleiten vielfach verknüpftes Glucosegerüst
Lagert von außen dicht der Schicht aus Lipiden schützend[23] sich an.
.
Fußnoten
[1] Verdauungsvesikel, Verdauungsvakuolen: Mikrobenumschließende Vesikel, entstanden aus Zellmembraneinstülpungen
[2] Lipidmembran (Bacteria, Eukarya): Lipide, bestehend aus einem mit drei Hydroxylgruppen [–OH] versehenen Glycerinmolekül, an dem zwei Fettsäuren und ein Cholin unter Wasserabspaltung angeknüpft sind, zeigen einen hydrophilen Kopf (Glycerin und Cholin) und den hydrophoben Fettsäureschwanz; nach dem Motto Gleich zu Gleich gesellt sich gern, ordnen sich die hydrophilen Köpfe zum einen und die hydrophoben Schwänze zum anderen nebeneinander an und bilden eine geschlossene Schicht; eine Doppelmembran entsteht dann, wenn sich zwei solcher Schichten, hydrophobe Schwänze zueinander gereckt, aneinanderlegen
[3] Enzym: Protein, das, an spezielle Moleküle angepasst, die Synthese katalysiert. Meistens werden mehrere Enzyme zu einem Komplex verbunden, um eine räumliche Nähe zwischen den einzelnen, aufeinanderfolgenden Syntheseschritten herzustellen
[4] Zucker: Kohlenstoffverbindungen mit einem doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] am Ende der Kette, wenn in offener Form dargestellt, oder als Ringform mit einem einfachgebundenen Sauerstoff im Ring, und einer oder mehreren [–OH]-Gruppen; Summenformel meist [Cn(H2O)n]
[5] Aminosäuren: Organische Säuren mit einer Amino-[–NH2] Seitengruppe. Biologisch bedeutend sind hauptsächlich jene Aminosäuren, die an dem der Säuregruppe benachbarten Kohlenstoffatom diese Gruppe besitzen
[6] Nucleotide: Die Nucleotide Desoxyribonucleotid- bzw. Ribonucleotidtriphosphate (ATP, TTP, CTP, GTP, UTP) werden als Einzelbausteine unter Abspaltung von zwei Phosphaten zu DNA bzw. zu RNA
[7] Vesikel (Zellvesikel): Kleine, abgegliederte, rundliche, doppelmembranumhüllte Behälter
[8] Bionten: Allgemeine Bezeichnung für Lebewesen
[9] Peptide: Kurze Ketten aus (verschiedenen) Aminosäuren.
[10] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt, das zweite der beiden benachbarten den Aminosäurerest
[11] Katalysator (katalysieren): Substanz, die einer Reaktion Aktivierungsenergie herabsetzt. Enzyme bewirken beispielsweise, dass eine Reaktion schon bei umweltgegebenen oder bei Körpertemperaturen ablaufen
[12] Alpha-Tubulin und Beta-Tubulin: α- und β-Tubuline (je aus etwa 450 Aminosäuren bestehend) polymerisieren zu Mikrotubuli, einem Hauptbestandteil des eukaryotischen Cytoskeletts. Die Tubuline unterschiedlicher Organismen sind nicht identisch, dadurch variieren die Durchmesser der Mikrotubuli zwischen 20 und 30 Nanometer.
[13] Dimere: Molekül oder ein Molekülverbund, der aus zwei oft identischen Untereinheiten, den Monomeren, besteht
[14] Dynein: Ein zur Gruppe der Motorproteine gehörendes Molekül in eukaryotischen Zellen, das dem Transport von Vesikeln und anderen Transport- und Bewegungsvorgängen dient. Das Dynein-Protein besteht aus einer Kopfregion, die an Mikrotubuli bindet, sowie einem Schwanzteil, der mit anderen Proteinen interagieren kann. Dyneinkomplexe binden ein zu transportierendes Molekül an sich und „laufen“ dann entlang eines Mikrotubulus. Der Transport erfolgt gerichtet, da Dynein auf dem Mikrotubulus nur in Richtung des sogenannten minus-Endes wandern kann. Dyneine transportieren also ihre Fracht von der Peripherie in Richtung Mikrotubuliorganisationscentren, MTOCs.
[15] Kinesin: Bezeichnet eine Gruppe von Motorproteinen in eukaryotischen Zellen. In Kooperation mit anderen Motorproteinen, wie Myosin und Dynein ist Kinesin wesentlich am intrazellulären Transport von biologischen Lasten entlang der Mikrotubuli beteiligt. Der Kinesinkomplex besteht aus zwei schweren und zwei leichten Proteinketten. Das Kinesin-Protein selbst besteht aus einer Kopfregion, die an Mikrotubuli binden kann und die katalytische Domäne enthält, einem Hals, einem langen Stiel, sowie einem Schwanzteil, der mit anderen Proteinen über eine Vielzahl von Verbindungsproteinen interagieren kann. Durch ATP-Hydrolyse am aktiven Zentrum verändert sich die Konformation des Kopfes und des Halses, ein 8 nm langer Schritt über ein Tubulindimer folgt damit. Kinesinkomplexe binden ein zu transportierendes Molekül an sich und 'laufen' dann entlang einem Mikrotubulus vom Minus- zum Plus-Ende.
[16] Mikrotubuli: Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende.
[17] ATP: Adenosin-Tri-Phosphat; bestehend aus Ribose und Adenin; Ribose trägt an seiner nicht in den Zuckerring einbezogenen Kohlenstoffgruppe drei hintereinander liegende Phosphatgruppen. Diese lineare Anordnung der Phosphate hat zur Folge, dass das dritte, äußerste Phosphat, mit seiner ihm dadurch innewohnenden Energie, diese leicht unter Abspaltung auf andere Moleküle übertragen kann
[18] Amoebium: Hypothetischer Vorfahr der Eukarya; wird hier als ursprünglichster Eukaryot angenommen
[19] Lipidmembran (Bacteria, Eukarya): Lipide, bestehend aus einem mit drei Hydroxylgruppen [–OH] versehenen Glycerinmolekül, an dem zwei Fettsäuren und ein Cholin unter Wasserabspaltung angeknüpft sind, zeigen einen hydrophilen Kopf (Glycerin und Cholin) und den hydrophoben Fettsäureschwanz; nach dem Motto Gleich zu Gleich gesellt sich gern, ordnen sich die hydrophilen Köpfe zum einen und die hydrophoben Schwänze zum anderen nebeneinander an und bilden eine geschlossene Schicht; eine Doppelmembran entsteht dann, wenn sich zwei solcher Schichten, hydrophobe Schwänze zueinander gereckt, aneinanderlegen
[20] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen mit starrer Zellwand; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt; für Bakterien und Animalia kein gebräuchlicher Begriff.
[21] Exocytose: Ausscheiden eines Partikels aus der Zelle mit Hilfe eines sich in die Zellmembran integrierenden Vesikels; der Partikel wird damit durch Ausstülpung ausgeschieden
[22] Endocytose: Aufnahme eines Partikels aus der Zellumgebung mit Hilfe eines aus der Zellmembran durch Einstülpung entstandenen Vesikels
[23] Lipiddoppelmembran
Eingestellt am 6. Juli 2024
.
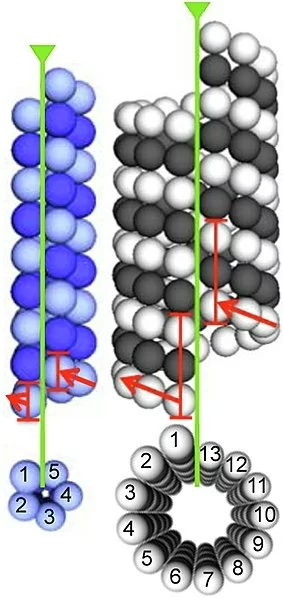
Bakterielle und Eukaryotische Mikrotubuli
Schematische Darstellung der vorgeschlagenen Architekturen von Mikrotubuli aus 5 Protofilamenten von Bakterien (links) und 13 Protofilamenten von Eukaryoten (rechts). BtubA und BtubB (Bakterielle Tubuline A und B) werden in Dunkel- bzw. Hellblau dargestellt. α- und β-Tubulin (eukaryotische Tubuline α und β) sind in Weiß (minus-Ende, unten) bzw. Schwarz (plus-Ende, oben) dargestellt. Nähte sind grün und Starthelices rot dargestellt.
Autoren: Pilhofer, M., Ladinsky, MS, McDowall, AW, Petroni, G., Jensen, GJ
Lizensiert unter Creative Commons Attribution 4.0 International-Lizenz
Eingestellt am 6. Juli 2024
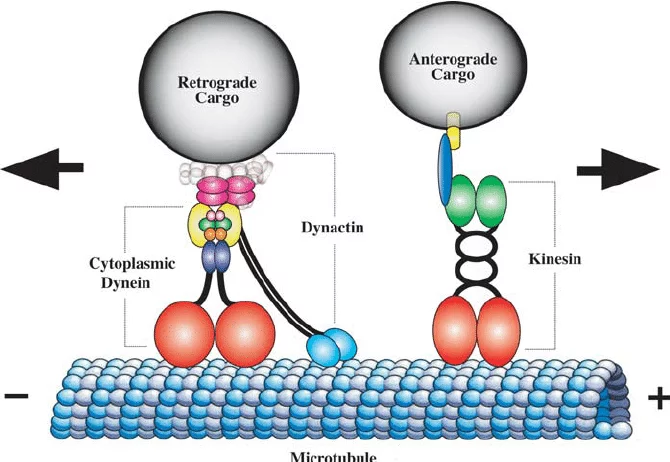
Cytoplasmic Dynein and Kinesin Power Axonal Transport. Schematic diagram of the microtubule motor proteins cytoplasmic dynein and kinesin.
Cytoplasmic dynein transports cargo in the retrograde direction toward the minus ends of microtubules whereas kinesin transports cargo in the anterograde direction toward the plus ends. Cytoplasmic dynein is a large multimeric protein complex comprising two heavy chain subunits (red) that possess microtubule binding and ATPase activity, two intermediate chains (yellow), two light intermediate chains (indigo), and an assortment of light chains (light pink, green, orange) (reviewed in [7]). Dynactin, a large multisubunit protein complex of comparable size to cytoplasmic dynein, is proposed to link the dynein motor to cargo and/or increases its processivity. The largest dynactin subunit, p150 Glued (turquoise), forms an elongated dimer that interacts with the dynein intermediate chain and binds to microtubules via a highly conserved CAP-Gly motif at the tip of globular heads. The dynactin subunit p50 (dark pink) occupies a central position linking p150 Glued to cargo. The conventional kinesin holoenzyme, also known as kinesin-1, is a heterotetramer comprising two Khc subunits (red) with microtubule binding and ATPase domains, a central coiled stalk, and a tail domain that interacts with two Klc subunits (green). Klcs may mediate cargo- binding via an intermediate scaffold protein (blue) that binds a cargo transmembrane protein (yellow).
Autoren: Duncan J, Goldstein LSB
Eingestellt am 6. Juli 2024
.

Eukarya, Echtzellkerner
3 Nochmal gutgegangen (AP, HP)
.
Auf ihrem Weg durch Gegend und Zeit
Erfolgreich um Nahrung und Lebensraum
Beenden behende leicht gleitend, so machen bakteriellen Lebenstraum.
.
Tote Bakterien, tote Archäen, zersetzte Substanzen,
Mitunter gelingen besondere Fänge,
Dann landen auch lebende Zellen in der Amöbe Verdauungsraum.
.
Gnadenlos werden auch sie verdaut!
Knacken leicht mit molekülspezifischen Scheren
Den sonst sie schützenden Sack.
.
Erfolgreich erwehrte sich einst ein Sauerstoff zehrndes Alpha-Proteobacterium[9].
Tappte ungeschickt mitten hinein in die vesikuläre, fließende Falle.
Die Außenlipidschicht[10] mitsamt darunter liegendem Murein
Wurden ihm – ohne wirklichen Aufwand – genommen.
Erst als es direkt ans Leben ihm ging,
Wehrte es glücklich den lüsternen Zudringling ab.
.
Fußnoten
[1] Bionten: Allgemeine Bezeichnung für Lebewesen
[2] Bakterien: Bilden zusammen mit Archäen die sog. Prokaryo(n)ten, die noch keinen echten Zellkern und keine komplex gebauten Chromosomen besitzen. Sie unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Deshalb wurden die Archäen in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts als eigene Organismen-Domäne der Domäne der Bakterien gegenübergestellt
[3] Archäen: Bilden zusammen mit Bakterien die sog. Prokaryo(n)ten, die noch keinen echten Zellkern und keine komplex gebauten Chromosomen besitzen. Sie unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Deshalb wurden die Archäen in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts als eigene Organismen-Domäne der Domäne der Bakterien gegenübergestellt
[4] Amöben, Wechseltierchen: Verändern ständig ihre Form, weil zellwandlos, stülpen Fortsätze des Protoplasten aus, umfließen Nahrung, um Nahrungsvakuolen (Endosomen) zu bilden, ihren Fang zu verdauen. Amöben kommen in verschiedenen Organismenreichen vor; repräsentieren also keine Verwandtschaft, sondern nur eine Lebensstrategie; ein Organismenreich (Amoebozoa) umfasst jedoch nur Amöben
[5] Verdauungsvesikel, Verdauungsvakuolen: Mikrobenumschließende Vesikel, entstanden aus Zellmembraneinstülpungen
[6] Murein: Zellwand fast aller Bakterien; an kettenförmig verbundenen Zuckermolekülen, hängen Ammoniumgruppen (–NH2) und diese sind wieder mit verschiedenen Molekülen verknüpft. Charakteristisch dafür ist die N-Acetyl-Muraminsäure. Diese Ketten werden noch durch kurze Folgen von Aminosäuren verbunden und ergeben so einen sehr stabilen Sack um die Zelle.
[7] Pseudomurein: Archaea bilden in ihren Zellwänden kein Murein sondern Pseudomurein. Zwei Ketten aus N-Acetyl-Glucosamin und N-Acetýl-Tálasamínurónsäure in regelmäßigem Wechsel verbinden die Aminosäuren Glutamin, Alanin und Lysin in geregelter Weise N-Acetýl-Tálasamínurónsäure kommt in Bacteria nicht vor.
[8] Enzym: Protein, das, an spezielle Moleküle angepasst, die Synthese katalysiert. Meistens werden mehrere Enzyme zu einem Komplex verbunden, um eine räumliche Nähe zwischen den einzelnen, aufeinanderfolgenden Syntheseschritten herzustellen
[9] Alpha-Proteobacteria (Gramnegative – Bacteria)
[10] Hüllmembran: Lipiddoppelmembran um gramnegative Bakterien und um verschiedene Viren
Eingestellt am 6. Juli 2024
.

Eukarya, Echtzellkerner
4 Kraftwerke (TP, SP)
.
Gefangen ist das fast schon hüllenlose Bakterium[1].
Verdaut wird es nicht, doch Freiheit liegt ihm weit in der Ferne.
Knapp vor dem physischen Ende bekommt es noch Nahrung
Von der wohlwollenden Zelle, die es umgibt.
.
Zucker[2] im Übermaß wirkt als Trost.
Das Zuviel konvertiert es in ATP[3].
Doch lange schon liegt energiehungrig ihr Wärter auf Lauer:
Nutzt sein ATP für eignen Bedarf.
.
Genug Energie und Glucose bleiben freilich zurück,
Das eigene, eingesperrte Leben zu fristen.
Zum Vorteil wird sein Gefängnis sogar,
Wird es doch nun immer umsorgt und umhegt.
Vermehrung und Teilung sind gerne gesehen,
.
Die gefang‘nen Bakterien stimmen sich ein auf die fremde Umgebung,
Passen sich, ohne zu zögern, den neuen Bedingungen an.
Kraftwerke sind sie der Zelle geworden;
Nennen Mitochondrien[6] sich nun.
.
Die Membranen zweierlei Herkunft[7]
Behalten gebührenden Abstand, berühren sich nicht:
Die umgebende, vesikuläre Amöbenmembran
Und seine eigene, innere, die erhalten ihm blieb.
.
Diese beiden, analogen, Membranen charakterisieren für immer
Mitochondriums doppelte Hülle, des Bionten neuentstandenen Zellorganells.
.
Was anfangs als wohlfeile Beute verschlungen,
Ist längst Antrieb der Evolution.
Das Mitochondrium, durch Endocytose[8] eines Bakteriums zunächst gewonnen,
Gab Anlass für die allbekannte Endosymbiontentheorie[9].
.
Fußnoten
[1] Alpha-Proteobacterium (Gramnegative – Bacteria)
[2] Glucose, Traubenzucker: Ringförmiger Zucker mit sechs [C]-Atomen [C6H12O6]; der Ring besteht aus fünf [C]-Atomen und einem Sauerstoffatom; das restliche [C]-Atom hängt als [–CH2OH]-Gruppe an einem dem Sauerstoff benachbarten [C]-Atom; vier [–OH]-Gruppen stehen an [C]-Atomen des Rings, wobei [–CH2OH] und die dem Sauerstoff benachbarte [–OH]-Gruppe in gleicher Richtung stehen, alle anderen wechseln sich richtungsmäßig ab
[3] ATP: Adenosin-Tri-Phosphat; bestehend aus Ribose und Adenin; Ribose trägt an seiner nicht in den Zuckerring einbezogenen Kohlenstoffgruppe drei hintereinander liegende Phosphatgruppen. Diese lineare Anordnung der Phosphate hat zur Folge, dass das dritte, äußerste Phosphat, mit seiner ihm dadurch innewohnenden Energie, diese leicht unter Abspaltung auf andere Moleküle übertragen kann
[4] Amöben, Wechseltierchen: Verändern ständig ihre Form, weil zellwandlos, stülpen Fortsätze des Protoplasten aus, umfließen Nahrung, um Nahrungsvakuolen (Endosomen) zu bilden, ihren Fang zu verdauen. Amöben kommen in verschiedenen Organismenreichen vor; repräsentieren also keine Verwandtschaft, sondern nur eine Lebensstrategie; ein Organismenreich (Amoebozoa) umfasst jedoch nur Amöben
[5] Endosom: Mikrobenumschließendes Vesikel, entstanden aus einer Zellmembraneinstülpung
[6] Mitochondrien: Gelten als Kraftwerke der Zellen, da sie Energie für die zellulären Prozesse liefern; es lassen sich Außen- und Innenmembran unterscheiden, wobei die innere Membran auf einen zellwandlos gewordenen Endosymbionten (ein Alpha-Proteobakterium) zurückgeht, während die äußere Membran der Plasmamembran der Zelle entspricht; prokaryotische Chromosomen weisen ebenfalls auf einen aufgenommenen prokaryotischen Endosymbionten als Ursprung der Mitochondrien hin.
[7] Membranen zweierlei Herkunft: Wobei die innere Membran auf den zellwandlos gewordenen Endosymbionten (ein Alpha-Proteobakterium) zurückgeht, während die äußere Membran der Plasmamembran der Zelle entspricht
[8] Endocytose: Aufnahme eines Partikels aus der Zellumgebung mit Hilfe eines aus der Zellmembran durch Einstülpung entstandenen Vesikels
[9] Endosymbiontentheorie: Eine heute allgemein akzeptierte Theorie, die mehrfach gut begründet davon ausgeht, Mitochondrien und Chloroplasten eukaryotischer Zellen seien auf Endocytose eines einzelligen, nicht vollkommen verdauten Organismus‘ zurückzuführen. Für Mitochondrienorganelle kommen dafür Alpha-Proteobakterien in Frage.
Eingestellt am 6. Juli 2024
.

Eukarya, Echtzellkerner
5 Kraftwerkstypen
Wohl noch andern Alpha-Proteobakterien[1] wurde dieses Schicksal zuteil.
Auch sie wurden wehrlos verschlungen, ihrer Zellwand beraubt!
Doch unterschieden sich die Einverleibten in ihrer Innenstruktur,
.
Eingestülpt, von vielen schlanken Fingern bestanden,
Vergrößert seine innere Fläche der Tubuli-Typ[4].
Der Cristae-Typ[5] dehnt nutzbringenden Innenbereich
Mit zungenförmigen Scheiden,
Stieltellerförmige Bildungen
Wählt hingegen der Discus-Typ[6].
.
Waren Amöben[7] einmal beim Kapern erfolgreich,
Blieb dies bestimmt kein einzelner Fall:
Fanden womöglich Bakterien vielerlei Plasmalemmastrukturen[8]
Mit dicht geordnetem, hochspezialisiertem ATPase-Enzym[9].
.
War es ein und dieselbe Amöbenart, die raubend Bakterien fing,
Unvergleichlichen Schatz in sich barg,
Dann zu sortieren begann
Und Nachkommen nur reine Linien zum Wirtschaften gab?
.
Oder war es doch nur ein unwiederholter Event,
Eine Diversifizierung der Innenmembran,
Die das Mitochondrium dann erst ersann
Und Einstülpungsformen nur in Gefangenschaft schuf?
.
Oder wurden gleich zu Beginn nur je eine einzige Zelle entführt
Und zum Sklaven genommen?
Drei Mal hätten somit Amöben
Verschied‘ne Bakterien ergriffen und sich ihrer bedient.
.
Entscheidende Fragen der Evolution!
Drei Integrationen wären somit die Basis für
Drei unabhängig entstandene Reiche.
Später geformte, identische Merkmale gälten dann nur als analog[10].
.
Energie konsumierende Lebensvorgänge
Verlangen effizientes Gewinnen kontinuierlich benötigter Kraft.
Nicht erst Schwimmen, schon Kriechen fordert dies ein.
Mitochondrienkraftwerke waren für frühe Entwicklung sicherlich Sine Qua Non.
.
Kennt jemand die Gründe?
Nennt jemand die Lösung?
Bringt jemand den Nachweis?
Lenkt Jemand das Werden?
.
Fußnoten
[1] Alpha-Proteobacteria (Gramnegative – Bacteria)
[2] Endosymbiont: Aufgenommener, womöglich etwas abgewandelter Organismus, der zu seinem und zum Vorteil des Herberggebers in einer fremden Zelle lebt
[3] Zellmembran: Lipiddoppelmembran (Bacteria, Eukarya), die das Zellinnere umgibt
[4] Tubuli-Mitochondrien: Des Mitochondriums innere, seine eigentlich eigene Zellmembran, stülpt zur Oberflächenvergrößerung fingerförmige Strukturen ein.
[5] Cristae-Mitochondrien: Des Mitochondriums innere, seine eigentlich eigene Zellmembran, stülpt zur Oberflächenvergrößerung scheidenförmige Strukturen ein.
[6] Diskus- oder Stielscheibentyp-Mitochondrien: Des Mitochondriums innere, seine eigentlich eigene Zellmembran, stülpt zur Oberflächenvergrößerung scheibenförmige (diskusförmige) Strukturen ein.
[7] Amöben, Wechseltierchen: Verändern ständig ihre Form, weil zellwandlos, stülpen Fortsätze des Protoplasten aus, umfließen Nahrung, um Nahrungsvakuolen (Endosomen) zu bilden, ihren Fang zu verdauen. Amöben kommen in verschiedenen Organismenreichen vor; repräsentieren also keine Verwandtschaft, sondern nur eine Lebensstrategie; ein Organismenreich (Amoebozoa) umfasst jedoch nur Amöben
[8] Zellmembran
[9] ATPase: Enzym, das ATP unter Energieweitergabe in ADP und P spaltet; die Endung -ase kennzeichnet ein Protein als Enzym
[10] Analog: So werden Merkmale bezeichnet, die von unterschiedlichen Ausgangspunkten (Strukturen, Organen) gleiches Aussehen oder gleiche Funktionen entwickelten
Eingestellt am 6. Juli 2024
.

Verschiedene Mitochondrien-Typen (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer)
Mitochondrium mit Tubuli, fingerförmigen Einstülpungen, Tubuli-Typ (links); Mitochondrium mit scheidenförmigen Einstülpungen, Cristae-Typ (Mitte); Mitochondrium mit scheibenförmigen, stieltellerförmigen Einstülpungen, Discus-Typ (rechts).
Einstülpungen im Schnitt und in unterschiedlichen Ansichten. Ocker-orange innere Mitochondrienmembran (Zellmembran des ehemaligen Bakteriums); rot Lipidoppelmembran des Endosoms der aufnehmenden Zelle, entstanden aus der Zellmembran durch Invagination, das Verdauungsvesikel (Endosom) zu bilden.
Eingestellt am 6. Juli 2024
.

Eukarya, Echtzellkerner
6 Infrastruktur (HP)
.
Kraftwerksverstärkte Amöben[1] vergrößern sich zehnfach und mehr!
Enzyme synthetisieren unentwegt
Erhebliche Mengen Ausgangsprodukte für weithin verstreute,
Nicht logisch geordnete Arbeitsmodule.
.
Vornehmlich auswärts gerichteter Schienenverkehr
Verzögert erheblich
Lieferung dringendst im Innern benötigter Ware.
Zu unpünktlich kommen die Sendungen an!
.
Vermengte, verwechselte Arbeitsaufträge behindern
Fabrikation von Enzymen erlesener Qualität.
Allein strikt voneinander durch Wände getrennte Bearbeitungsorte
Separierten erfolgreich Wege der Produktion.
.
Kompartimentieren[2] heißt die Devise:
Zusammengehörende Arbeitsmodule belegen gemeinsame Räume;
Strategisch gelenkter Verkehr an Tubuli
Koppelt Module[3] zusammen.
.
Leicht zu beschaffende, trennende Wände besorgen Cisternen
Aus flächigen, vesikulären Endocytosemembranen.
Lücken, durchbrochene Platten, ermöglichen Mikrotubulischienen[4]
Gezielte und rasche Transporte zur nächsten Station.
.
Enzyme belagern in Gruppen Cisternen des endoplasmatischen Netzes[5].
Arbeitsaufträge für neue Produkte.
Mitochondrien arbeiten parallel mit 70S Ribosomen[8].
.
Trotz allen Fließens der unruhig gleitenden Zelle
Verbleiben Ringchromosomen, in mehrfach verdoppelter Zahl
– Beinahe im Zentrum – von Cisternenkalotten[9] umgeben,
Als Kernstück der Kommunikation.
.
Entstanden ist die kompartimentierende Kernhülle[10],
Des eukaryotischen Informationszentrums Grenze. –
.
Arbeitsteilung und Differenzierung,
Zwei Grundprinzipien der Evolution,
Werden in eukaryotischen Zellen konsequent verwirklicht!
So existieren Sine qua non[11] Organelle, je mit Lipidoppelmembran umgrenzt,
Vorderster Stelle steh’n.
.
Fußnoten
[1] Amöben, Wechseltierchen: Verändern ständig ihre Form, weil zellwandlos, stülpen Fortsätze des Protoplasten aus, umfließen Nahrung, um Nahrungsvakuolen (Endosomen) zu bilden, ihren Fang zu verdauen. Amöben kommen in verschiedenen Organismenreichen vor; repräsentieren also keine
Verwandtschaft, sondern nur eine Lebensstrategie; ein Organismenreich (Amoebozoa) umfasst jedoch nur Amöben
[2] Kompartimentieren (Zelle): In eigenständige Räume unterteilen, um von außen möglichst ungestört Arbeitsaufträge zu erfüllen
[3] Module (Zelle): Separate Arbeitsräume für spezielle Arbeitsschritte
[4] Mikrotubulischienen: Wie Eisenbahnschienen wirken Mikrotubuli auf denen Dynein und Kinesin ihre Ware transportieren
[5] Endoplasmatisches Retikulum, ER: Intrazelluläres Membransystem aller eukaryotischen Zellen; besteht aus lipiddoppelmembranumschlossenen Hohlräumen, die ein zusammenhängendes System bilden, und das mit der Kernhülle in Verbindung steht
[6] 80S Ribosomen: Die Abkürzung S ist die Sedimentationskonstante beim Zentrifugieren von Teilchen, hier von Ribosomen. Je größer die Konstante, umso schwerer sind sie. Die eukaryotischen Ribosomen, aus zwei ungleichgroßen Untereinheiten zusammengesetzt, 60S und 40S, sind mit 80S schwerer als die separierten Teile. Dass die Summe der beiden Untereinheiten 80 und nicht 100 ergibt, liegt an der größeren relativen Oberfläche der Einzelteile im Vergleich zur Doppelstruktur
[7] Rauhes ER, rauhes Endoplasmatisches Retikulum: ER-Cisternen sind außen dicht mit Ribosomen belegt
[8] 70S-Ribosomen: Die Abkürzung S ist die Sedimentationskonstante beim Zentrifugieren von Teilchen, hier von Ribosomen. Je größer die Konstante, umso schwerer sind sie. Die bakteriellen Ribosomen, aus zwei ungleichgroßen Untereinheiten zusammengesetzt, 50S und 30S, sind mit 70S schwerer als die separierten Teile. Dass die Summe der beiden Untereinheiten 70 und nicht 80 ergibt, liegt an der größeren relativen Oberfläche der Einzelteile im Vergleich zur Doppelstruktur
[9] Cisternenkalotten: Der Zellkern als runde Struktur wird, seinen Inhalt nachbildend, von schalenförmiger Cisternen umgeben; die, evolutiv gesehen, anfängliche Abgrenzung des Zellkerns lässt sich aus einzelnen Schalen zusammengesetzt (Kalotten) vorstellen, wie dies auch geschieht, wenn vom Cytoplasma zeitweise unabgegrenzte Kerne (bei Kernteilungen) wieder mit einer Kernhülle versehen werden.
[10] Kernhülle: Der Eukarya Zellkern ist von einer Kernhülle umgeben, die sich aus Cisternen, als Abkömmlinge des Endoplasmatischen Retikulums, zusammensetzt. Dazwischen bleiben nicht wenige Poren mit speziellem Bau.
[11] Sine qua non: ohne sie geht nichts; unabdingbare Voraussetzung
[12] Lysosomen: Von einer Membran umschlossene kugelförmige Zellorganellen von Eukaryoten; enthalten hydrolytische Enzyme und Phosphatasen, mit denen sie Fremdstoffe oder körpereigene Stoffe abbauen
[13] Dictyosom, Netzorganell: Oft tellerförmig anmutende Cisternen treten gern in gestapelter Weise auf, an deren Rändern Vesikel abgeschnürt werden; jedes einzelne Organell der Zelle wird oft als Dictyosom (Netzorganell) bezeichnet, während alle Organelle zusammen als Golgi-Apparat geführt werden.
Eingestellt am 6. Juli 2024
.

Bau einer tierischen Zelle (Schema)
1 Nucleolus; 2 Zellkern (Nucleus) mit Kernhülle; 3 Ribosomen (Punkte auf rauhem Endoplasmatischen Retikulum); 4 Vesikel; 5 Rauhes Endoplasmatisches Retikulum; 6 Dictyosom; 7 Cytoskelett; 8 Glattes Endoplasmatisches Retikulum; 9 Mitochondrien; 10 Vakuole; 11 Cytosol; 12 Lysosom; 13 Centriolen; 14 Zellmembran
Autor: Kelvinsong
Lizensiert unter: Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Eingestellt am 6. Juli 2024
.

Eukarya, Echtzellkerner
7 Gordischer Knoten (SP, pJP)
.
Groß ist der Anspruch der wandernden, Füßchen bildenden Zellen!
Fordern präzise, zielgerichtete Koordination
Zentraler Befehls- und Verteilungsstellen,
Um Mengen, Transporte, zeitliche Abstimmung, passgenau wirken zu sehen.
.
Voluminösere, feinstrukturierte Amöben[1]
Verlangen grundsätzlich höhere Dichten an Datentransfer:
Hunderte Ringe DNA[2] drängen, sich hakend, auf knappbemessenem Raum.
Ordnung zu wahren, den Plan[3] an der richtigen Stelle zu halten, ist erstes Gebot.
.
Schlingernde Schleifen, verdichtet im Zentrum,
Verknäueln bedenklich zu wirren Verbünden.
Defekte Kopien als Folge der Enge
Behindern Transfer und Funktion, schließlich die Evolution.
.
Längere Stränge anstelle unzähliger Ringe
Verhinderten dann nur unlösbare Verwicklung,
Verankerten Kernmembranen[4] offene Enden der Fäden. –
Geregeltes Aufrollen wäre die passende Alternative.
.
Nicht Alternativen, denn beide Prinzipien werden verwirklicht!
Der Arbeitskern[5] hängt seine Fäden der Kernhülle an:
Für Replikation, zu ihrer Verdopplung,
Und Bildung der Messenger-RNA[6].
.
Kommt es zur Segregation verdoppelter Stränge,
Umwickelt die Helix[7] in kürzerem Abstand
In zweifacher Windung Pakete von
Acht Proteinen, Histone[8] genannt.
.
Ein Verrutschen und Gleiten der Wicklung vom Stapel,
Katastrophales Verheddern wertvoller Fäden
Verhindern Proteine[9], wie Klammern gestaltet.
Wie Locken auf Wicklern gedreht,
Komponieren Millionen Histonaggregate
Gekonnt ein je einzelnes, nun komplexes Chromosom.
.
Fußnoten
[1] Amöben, Wechseltierchen: Verändern ständig ihre Form, weil zellwandlos; stülpen Fortsätze des Protoplasten aus, umfließen Nahrung, um Nahrungsvakuolen (Endosomen) zu bilden, ihren Fang zu verdauen. Amöben kommen in verschiedenen Organismenreichen vor; repräsentieren also keine Verwandtschaft, sondern nur eine Lebensstrategie; ein Organismenreich (Amoebozoa) umfasst jedoch nur Amöben
[2] DNA (=DNS): Desoxyribonucleinic Acid, Desoxyribonukleinsäure; mit einer reduzierten Ribose; das [–OH] am C2 der Ribose fehlt; Baustein der Erbinformation
[3] Chromosom: Genetische Informationseinheit aus unterschiedlichen Mengen DNA (oder selten RNA bei Viren) diverser Basensequenzen
[4] Kernhülle: Der Eukarya Zellkern ist von einer Kernhülle umgeben, die sich aus Cisternen, als Abkömmlinge des Endoplasmatischen Retikulums, zusammensetzt. Dazwischen bleiben nicht wenige Poren mit speziellem Bau.
[5] Arbeitskern: Im Arbeitskern ist die während Mitose und Meiose engst kondensierte, zusammengefasste, DNA maximal gelockert, und zwar so, dass die DNA in mRNA transkribiert und auch repliziert werden kann. Die vielen eng zusammengebundenen Schleifen gehen an ihren proteinverknüpften Bindungsstellen (Condensine) voneinander und liegen zum Ablesen frei.
[6] mRNA, messenger RNA, Boten RNA: Übersetzt den genetischen Code der DNA (gelegentlich von RNA) in für tRNAs ablesbare Matrizen.
[7] Doppelhelix: DNA liegt als Doppelhelix vor, also in zwei parallelen Strängen, die sich schraubig umlaufen
[8] Histone: Histone sind eine Klasse von basischen Kernproteinen der Eukarya, die die Verpackung der DNA zum Chromatin bilden und aufgrund von posttranslationalen Modifikationen auch regulatorisch in die Genexpression eingreifen. Sie werden in insgesamt 5 Hauptgruppen eingeteilt, nämlich H1, H2A, H2B, H3 und H4. Papillomaviridae besitzen davon H2A, H2B, H3 und H4
[9] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt, das zweite der beiden benachbarten den Aminosäurerest
Eingestellt am 6. Juli 2024
.
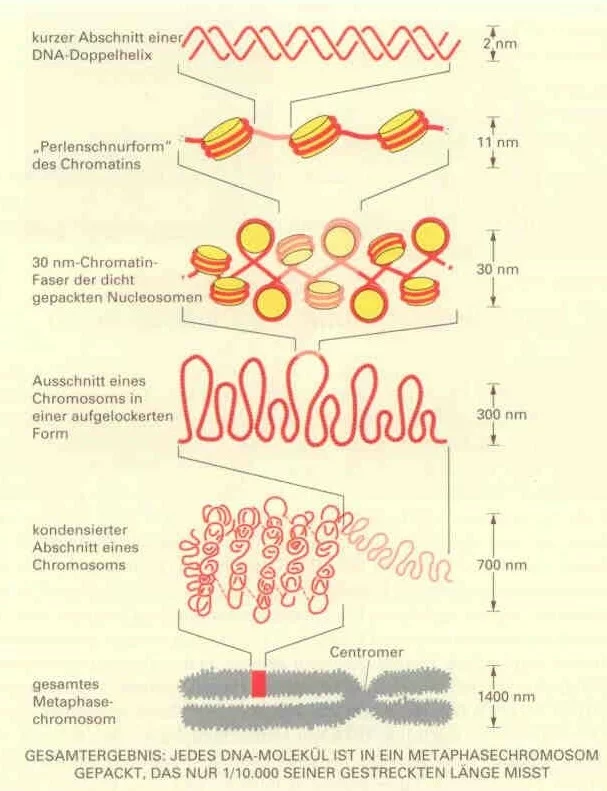
Chromatinpackung und Chromosomenfeinbau
Schematische Darstellung einiger der wichtigsten Ordnungsprinzipien der Chromatinpackung und der Entstehung eines hochgradig kondensierten mitotischen Chromosoms.
Aus: Lüttge U, Kluge M, Thiel G (2010) Botanik. Die umfassende Biologie der Pflanzen. 1. Auflage. Copyright WLEY-VCH GmbH, S. 446. [Aus Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Keith R, Walter P (2004) Molekularbiologie der Zelle. 4. Auflage, Wiley-VCH, Weinheim.]. Reproduced with permission.
Eingestellt am 6. Juli 2024
.
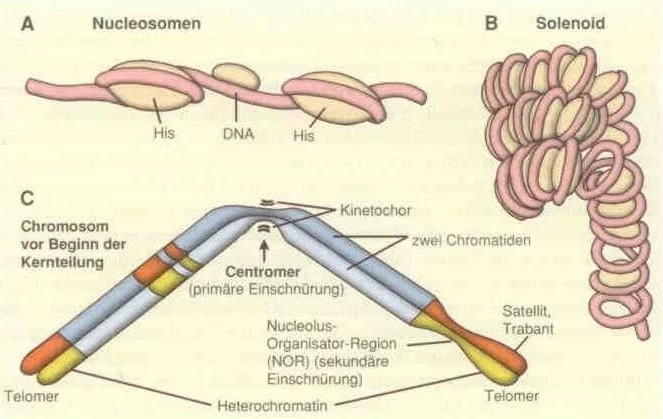
Chromatinpackung und Chromosomenfeinbau, Fortsetzung
Organisation des Chromatins und der Chromosomen mit den zur Beschreibung notwendigen Begriffen.
Centromer: DNA-Abschnitt, der häufig im Zentrum der Chromosomen zu finden ist und als zentrale Verbindungsstelle der beiden Chromatiden vor der mitotischen Teilung gelten. Obwohl seine Rolle bei fast allen Pflanzen und Tieren die gleiche ist, unterscheiden sich Centromere verschiedener Arten überraschend stark in Größe und Struktur. An den sich am Centromer ausbildenden Proteinkomplexen, den Kinetochoren, setzen dann die Fasern des Spindelapparates an und ziehen die nun getrennten zwei Chromatiden je zu entgegengesetzten Zellpolen.
Heterochromatin: Enge Kondensation des DNA-Fadens und besonders starke Anfärbbarkeit durch die DNA-Konzentrierung; bleibt auch im Interphasekern kondensiert. Nicht so stark anfärbbare Bereiche werden hingegen als Euchromatin bezeichnet.
His, Histone: Eine Klasse von basischen Kernproteinen der Eukarya, die die Verpackung der DNA zum Chromatin bilden und aufgrund von posttranslationalen Modifikationen auch regulatorisch in die Genexpression eingreifen. Sie werden in insgesamt 5 Hauptgruppen eingeteilt, nämlich H1, H2A, H2B, H3 und H4.
Kinetochor: Proteinkomplexe an Chromosomen, an Chromatiden, an denen die Spindelfasern ansetzen, bevor sie die Chromosomen Richtung Spindelpol ziehen.
NOR; Nucleolus-Organisator: Sekundäre Einschnürung an der der Satellit sitzt. Die nucleosomfreie DNA dieser Dünnstelle bildet den Nucleolus aus, wenn das Chromosom von der Transportform in die Funktionsform (im Arbeitskern) übergeht. Die Anzahl der Nucleoli in einem Zellkern entspricht daher meist der Anzahl der Satelliten, bei Pflanzen meist nur 1 pro einfachem Chromosomensatz (Lüttge et al. 2010).
Nucleosom: Aggregate aus Histonen, um die sich der DNA-Doppelstrang windet. (Lüttge et al. 2010).
Satellit, Trabant: Chromosomenteil aus Heterochromatin nach einer Dünnstelle des Chromosoms (Lüttge et al. 2010).
Solenoid: Röhrenartige Surpastruktur mit helikaler Anordnung von Nucleosomen.
Telomer: DNA-Sequenzen an den Enden der Chromosomen, die der Stabilisierung dienen.
Aus: Lüttge U, Kluge M, Thiel G (2010) Botanik. Die umfassende Biologie der Pflanzen. 1. Auflage. Copyright WLEY-VCH GmbH, S. 446. Reproduced with permission.
Eingestellt am 6. Juli 2024
.
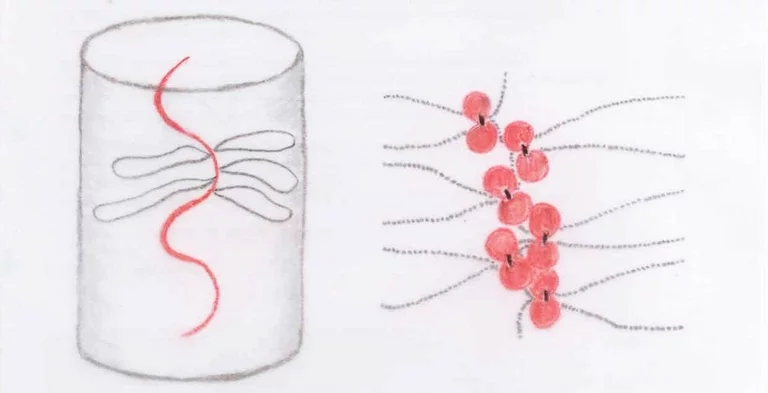

Chromosomenfeinbau: Prophase (oben) und Prometaphase (unten); (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer)
Zwei Condensine sind für den Feinbau der Chromosomen verantwortlich: Condensin I (rot) und Condensin II (blau). Die DNA wird, wie in der ersten Abbildung unter „Eukarya, 7 Gordischer Knoten“ dargestellt, über „Histonrollen“ zur „Perlschnurform“ des Chromatins zusammengefasst und zu dicht gepackten Nucleosomen zusammengestellt. Diese Nucleosomen werden, wie in der zweiten Abbildung unter „Eukarya, 7 Gordischer Knoten“ gezeigt, zu Solenoiden geschraubt, die nacheinander gereiht, stark kondensierte Abschnitte des Chromosoms ergeben. Diese kondensierten Fäden aus Nucleosomen und Solenoiden sind in der vorliegenden Abbildung als Perlschüre (grau) dargestellt. Diese Perlschnüre werden in der Prophase durch Condensin I (rot) zu größeren Schleifen zusammengefasst, durch Condensin II (blau) nochmals, weiter außen, zu sekundären Schleifen gebunden. Hiermit wird verhindert, dass diese „Perlschnüre“ sich verheddern, oder gar mit solchen benachbarter Chromosomenbereiche sich unlösbar verknoten. Auf diese Weise können individuelle, kürzere Abschnitte des Chromosoms im Arbeitskern (Interphasekern) für Transkription freigelegt und aktiviert werden.
Das Zylindermodell der Prophase zeigt die schraubige Anordnung von Condensin I (rot) im Chromosom; an dieser Schraube hängen die anfangs gebundenen Schleifen. Der Detailausschnitt (rechts) zeigt nur die unmittelbar basalen Teile der Perlschnurschleifen. Das Zylindermodell der Prometaphase verdeutlicht den nächsten Schritt: Condensin II (blau) vollzog bereits die zweite Stufe der Schleifenbildung und somit nähern sich die blauen Bereiche der Condesin-I-Schraube (rot). Die zunächst noch lockere Schraube wurde bedeutend gestaucht (Verkürzung des Chromosoms), so dass die Schraube im Raum hier augenfällig zutage tritt. Auch dieser Detailausschnitt (rechts) zeigt nur die unmittelbar basalen Teile der Perlschnurschleifen.
So können in Meiosen, wenn es zur Segregation homologer Chromosomen kommt, um den diploiden Satz in zwei haploide Sätzen zu reduzieren, sog. Crossovers entstehen, wobei an den Überlappungsstellen meist ein exaktes Übernehmen und Übergeben eines Teils des einen Chromosoms vom andern und umgekehrt erfolgen kann. Der geschilderte Feinbau der Chromosomen zeigt die nötigen Voraussetzungen für diesen früher nicht verstandenen Vorgang des Austausches bei Crossingover.
Nach: Gibcus JH, Samejima K, Goloborodko A, Samejima I, Naumova N, Nuebler J, Kanemaki MT, Xie L, Paulson JR, Earnshaw WC, Mirny LA, Dekker J (2018) A pathway for mitotic chromosome formation. Science 359: 1-12
Eingestellt am 6. Juli 2024
.

Eukarya, Echtzellkerner
8 Die große Trennung (HP,SP)
Zügig und ausdauernd treibt die Amöbe[1] den winzigen Körper voran.
Ununterbrochen entspringen breitlobige Füßchen dem vorderen Rande,
Gelegentlich herrscht aber Uneinigkeit über die Richtung des Wegs:
Das wandernde Wesen zerteilt sich in ungleiche Portionen.
.
Nur eine der beiden wird gleitend die Zeit erleben,
Denn ausschließlich sie rekrutierte den Zellkern[2] für sich.
Der befehlszentrumlos dahinirrende Rest
Wird begehrte Beute für wettbewerbstüchtige Mitkonkurrenten.
.
Gelänge die Teilung des Eukaryoten
In Hälften mit je einem sorgenden Kern,
Begänne danach die doppelte Zahl, neuen Raum zu erobern:
Und zählten nach zwanzig Generation schon über eine Million. –
.
Komplementär sich ergänzenden Stränge der DNA;
Produzieren genaue Kopien mit kaum einem Fehler
Wickeln neu entstandene Leitern zu je einem Paar zusammengelagerter Neuchromosomen[5].
.
Nicht nur ein Chromosom[6] ist verdoppelt, mitunter auch vier oder mehr;
Liegen dicht aneinander und warten darauf, die identischen Zwillinge
Schnellstens zu trennen, um im rechten Moment
Dem nur scheinbar verlorenen Part auch einen Kern mit auf den Weg zu geben.
.
Nur ein winziger Punkt noch hält die Chromatiden zusammen,
Schon kontaktieren zweier Mikrotubuli[7] Enden klebend die letzte Gemeinsamkeit.
Dyneine[8] ergreifen je eine der kaum noch verbundenen Schwestern und
Zieh‘n sie polwärts den Schienen entlang, versammeln sie neu zu je einem Kern. –
.
Mitotische Teilung[9] der Chromosomen
Benennen Biologen ein solches Gescheh‘n. –
.
Weitere Mikrotubuli spreizen die Kerne noch mehr auseinander und
Mittig dazwischen verschmelzen Cisternen[10] zur trennenden Scheide.
Entzweien den zuvor noch verbundenen Körper
Geben die Zwillinge frei für entbundenes Wandern, Ernähren und Leben.
.
Ein weit sich erstreckendes Feld der Freiheit
Lässt die Amöben fast ungehemmt schwärmen.
Erreichen die dichtesten Rasen der Prokaryoten[11],
Verwüstende Spuren gefräßigen Gleitens in sie zu graben. –
.
Was ist denn Freiheit, wird ausschließlich
Bäuchlings am Boden gekrochen?!
Freiheit braucht Raum, um die Welt zu erobern!
Lasst uns doch schwimmen wie viele Bakterien schon!
.
Fußnoten
[1] Amöben, Wechseltierchen: Verändern ständig ihre Form, weil zellwandlos, stülpen Fortsätze des Protoplasten aus, umfließen Nahrung, um Nahrungsvakuolen (Endosomen) zu bilden, ihren Fang zu verdauen. Amöben kommen in verschiedenen Organismenreichen vor; repräsentieren also keine Verwandtschaft, sondern nur eine Lebensstrategie; ein Organismenreich (Amoebozoa) umfasst jedoch nur Amöben
[2] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose die Verdoppelung der Chromosomen stattfindet
[3] DNA-Polymerasen: Enzyme, welche die Synthese von DNA aus Nucleotidtriphosphaten (Desoxyribose als Zucker in TTP, ATP, GTP und CTP als Nucleotide) als monomere Vorstufen (Einzelvorstufen) katalysieren
[4] DNA-Polymerasen: Enzyme, welche die Synthese von DNA aus Nucleotidtriphosphaten (Desoxyribose als Zucker in TTP, ATP, GTP und CTP als Nucleotide) als monomere Vorstufen (Einzelvorstufen) katalysieren
[5] Kondensiertes Chromosom, Transport-Chromosom: Für Kern- und Zellteilung wird das Chromatin platzsparend in höchster Kondensation engst verpackt, damit es im Zuge der Chromosomenverteilung möglichst ohne Komplikationen separiert werden kann
[6] Chromosom: Genetische Informationseinheit aus unterschiedlichen Mengen DNA (oder selten RNA bei Viren) diverser Basensequenzen
[7] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.
[8] Dynein: Ein zur Gruppe der Motorproteine gehörendes Molekül, das dem Transport von Vesikeln und anderen Transport- und Bewegungsvorgängen dient. Das Dynein-Protein besteht aus einer Kopfregion, die an Mikrotubuli binden, sowie einem Schwanzteil, der mit anderen Proteinen interagieren kann. Dyneinkomplexe binden ein zu transportierendes Molekül an sich und „laufen“ dann entlang eines Mikrotubulus. Der Transport erfolgt gerichtet, da Dynein auf dem Mikrotubulus nur in Richtung des sogenannten minus-Endes wandern kann. Dyneine transportieren also ihre Fracht von der Peripherie in Richtung Mikrotubuliorganisationscentren, MTOCs.
[9] Mitose: Zuvor verdoppelte, danach kondensierte Zwillingschromosomen (auch Chromatiden genannt, solange sie noch zusammenhängen), werden im Zuge der Mitose vereinzelt, wobei jeder neu zu bildende Tochterkern identische Chromosomen in identischer Zahl erhält
[10] Cisternen (Zelle): Abkömmlinge des endoplasmatischen Retikulums in hohler und oft flacher Form; Zellvesikel auch Zellkerne sind damit umgeben, besitzen den gleichen Grundbau wie die Zellmembran.
[11] Prokaro(n)t: Organismus, der keinen echten Zellkern besitzt, sondern einfache, meist ringförmige Chromosomen frei in einem zentralen Bereich liegen hat
Eingestellt am 6. Juli 2024
.
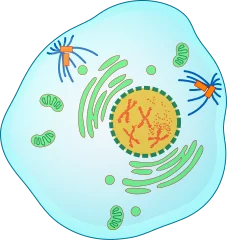
Mitose, Prophase
In der Prophase trennen sich die Mikrotubuliorganisationszentren (MTOC) und sind Ausgangspunkte für die Bildung der Mitosespindel. Verwandtschaftsbezogen sind diese MOTCs von unterschiedlicher Gestalt. Die Chromosomen kondensieren, werden damit lichtmikroskopisch sichtbar. Da die Chromosomen bereits zuvor in der Interphase verdoppelt wurden, bestehen sie aus je zwei identischen Schwester-Chromatiden, die noch am Centromer zusammenhängen. Das Ende der Prophase ist erreicht, wenn die Kondensation der Chromosomen abgeschlossen ist.
Autor: MITOSIS_cells_secuence.svg: LadyofHats
Lizenz: Gemeinfrei; unverändert
Eingestellt am 6. Juli 2024
.
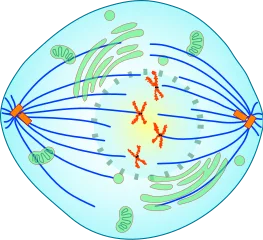
Mitose, Prometaphase
In der Prometaphase dringen die Spindelfasern des Spindelapparats von beiden Polen her in den Bereich des Karyoplasmas ein. Von den sternförmig ausgehenden astralen Mikrotubuli und den überlappend verbindenden polaren Mikrotubuli werden die Kinetochor-Mikrotubuli unterschieden, die im Bereich des Centromers ansetzen. Die Chromosomen können nun mittels der anhaftenden Mikrotubuli bewegt, ausgerichtet und angeordnet werden.
Autor: MITOSIS_cells_secuence.svg: LadyofHats
Lizenz: Gemeinfrei; unverändert
Eingestellt am 6. Juli 2024
.
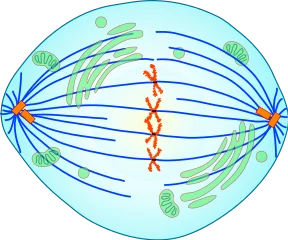
Mitose, Metaphase
In der Metaphase werden die stark kondensierten Metaphase-Chromosomen durch die Mikrotubuli als Spindelfasern zwischen den Spindelpolen in der Äquatorialebene ausgerichtet. Die Metaphase ist abgeschlossen, wenn alle Chromosomen in dieser Metaphase-Platte angekommen, aufgereiht und ihre Kinetochoren von beiden Polen her mit Mikrotubuli verbunden sind.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mitotic_Metaphase.svg
Autor: MITOSIS_cells_secuence.svg: LadyofHats
Lizenz: Gemeinfrei; unverändert
Eingestellt am 6. Juli 2024
.
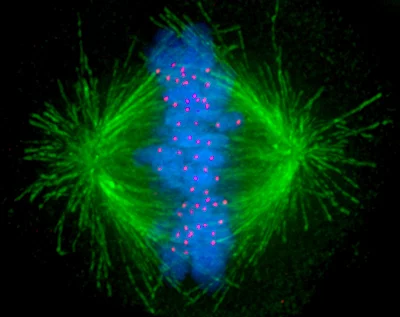
Mitose, mikroskopische Aufnahme während der Metaphase, differentielle Färbung
Die verschiedenen Mikrotubuli des Spindelapparates sind grün dargestellt, kondensierte Chromosomen blau, Kinetochoren rosa. Astrale Mikrotubuli (ins Cytoplasma ragend) und polare Mikrotubuli (zu den Chromosomen hin gerichtet) deutlich zu erkennen.
Autor: Afunguy in der englischen Wikipedia
Lizenz: Gemeinfrei; unverändert
Eingestellt am 6. Juli 2024
.
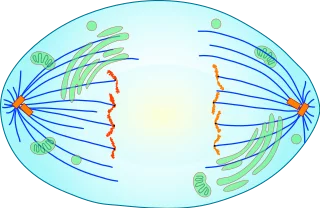
Mitose, Anaphase
In der Anaphase werden die beiden Chromatiden eines Chromosoms getrennt und längs der Spindelfasern jeweils mit dem Centromer voran in entgegengesetzter Richtung zu den Spindelpolen hin auseinandergezogen. So sammelt sich an jedem Pol ein vollständiger Satz an Chromatiden bzw. Tochterchromosomen. Damit ist die Basis für die zwei Tochterkerne geschaffen. Die Anaphase gilt als beendet, wenn sich die Chromosomen der beiden zukünftigen Tochterkerne nicht mehr weiter auseinanderbewegen.
Lizenz: Gemeinfrei; unverändert
Eingestellt am 6. Juli 2024
.
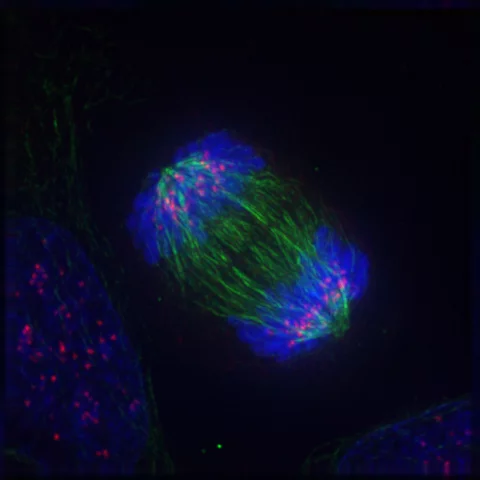
Mitose, Anaphase, mikroskopische Aufnahme, differentielle Färbung
Entlang der grün dargestellten Mikrotubuli des Spindelapparates werden die an den Kinetochoren (rosa) angehefteten kondensierten Chromosomen (blau) zu den Spindelpolen transportiert.
Autor: Roy van Heesbeen
Lizenz: Gemeinfrei; unverändert
Eingestellt am 6. Juli 2024
.
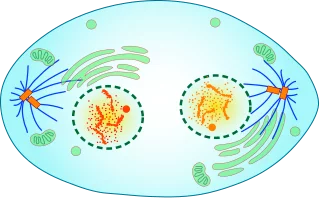
Mitose, Telophase
Als Telophase wird die letzte Phase der Mitose bezeichnet. Sie folgt übergangslos auf die vorausgegangene Anaphase. Die Kinetochorfasern (Mikrotubuli) depolymerisieren, die Chromosomen dekondensieren (lockern sich auf). Nach Abschluss der Auflockerung können die Gene wieder abgelesen werden, der Kern hat wieder die Arbeitsform (Arbeitskern).
Lizenz: Gemeinfrei; unverändert
Eingestellt am 6. Juli 2024
.
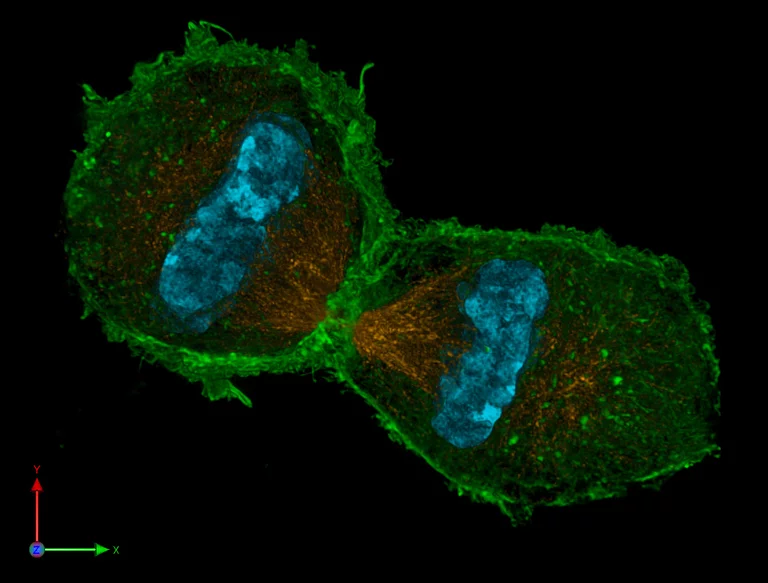
Mitose, Telophase, mikroskopische Aufnahme, differenzielle Färbung
Darstellung zweier Tochterzellen in der Telophase. Zu sehen ist der Spindelapparat (anti-Tubulin-Immunfärbung; orange), das Actin-Cytoskelett (Phallolidinfärbung; grün) und das Chromatin (DAPI-Färbung; cyan).
Autor: Lothar Schermelleh
Lizensiert unter Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported; unverändert
Eingestellt am 6. Juli 2024
.
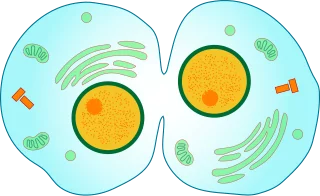
Mitose, Cytokinese
Die Tochterkerne sind nun die Kerne zweier Tochterzellen. Aber schon mit der Anaphase ist die Mitose abgeschlossen.
Autor: MITOSIS_cells_secuence.svg: LadyofHats
Lizenz: Gemeinfrei; unverändert
Eigestellt am 6. Juli 2024
.

Eukarya, Echtzellkerner
9 Das Wiedersehen (HP)
Trennung um Trennung vermehrt die Amöben[1],
Klonieren sich dauernd, bleiben beinahe identisch,
Schlagen sich durch über Strecken und Zeit,
Verweilen an kaum einem Ort.
.
Wagen so manchen gefährlichen Ausflug,
Sauerstoffführende Schichten des Wassers zu finden,
Nähern sich UV[2] durchfluteten Zonen –
Achten des Risikos nicht!
.
Wasser durchdringende Strahlung und Radioaktivität[3]
Irritieren Basenabfolgen verschiedenster Gene.
Verändern der Enzyme Code –
Nicht wenige Eukaryoten für ewig vernichtend.
.
Bewirken aber mitunter
Anpassungsfördernde Merkmale;
Bieten so den kommenden Generationen Chancen,
.
Am Grunde des winzigen Kraters,
Sein Boden bedeckt mit Bakterienrasen,
Weidet gemächlichen Schrittes Amölobus[6]
Zelle für Zelle mit Ausdauer ab.
.
Da gleitet von oben herab Lobamöbus[7]
Direkt – die Gefahr nicht erkennend – auf Amölobus zu.
Kein Zurück mehr ist möglich, denn schon vereinen sich
Beider Membranen zum nicht mehr trennbaren Produkt.
.
Was nützt schon die doppelte Zahl fast identischer Kerne?
Vergrößerte Räume bedürfen auch mehr Information,
Um gleichzeitig alle Bereiche kontrollieren, Befehle erteilen zu können.
Doch welchem der beiden gebührt die finale Gewalt?
.
Zwei konkurrierende Arbeits- und Informationsstrategien
Können nicht parallel für identische Aufgaben zuständig sein.
Auch die räumliche Trennung bringt Reibungsverluste.
So bleibt nur ein einziger Weg, Synergien zu erreichen: Zellkerne[8] verschmelzen!
.
Chromosomen[9] in doppelter Zahl liegen eng beieinander.
Die Paare ergänzen sich prächtig und
Gleichen des Partners Defekte fast vollkommen aus:
Kompensieren gekonnt durch Strahlung entstandene Schäden.
.
Verdoppelte Gene, Allele[10],
Überdecken verderbliche Eingriffe in das Genom,
Stabilisieren den Phänotyp[11],
Konservieren aufs Erste hemmend scheinenden Wandel.
.
So für die Zukunft gewappnet, erwartet der in sich verdoppelte,
Jetzt diploide Eukaryot:
Ökologisches Neuland, klimatische Höhen und Tiefen und –
Innovative Schritte der Evolution.
.
Fußnoten
[1] Amöben, Wechseltierchen: Verändern ständig ihre Form, weil zellwandlos, stülpen Fortsätze des Protoplasten aus, umfließen Nahrung, um Nahrungsvakuolen (Endosomen) zu bilden, ihren Fang zu verdauen. Amöben kommen in verschiedenen Organismenreichen vor; repräsentieren also keine Verwandtschaft, sondern nur eine Lebensstrategie; ein Organismenreich (Amoebozoa) umfasst jedoch nur Amöben
[2] Hartes ultraviolettes Licht: Ultraviolette Strahlung (UV-A-Strahlung) zwischen 380 und 315 Nanometer Wellenlänge
[3] Radioaktivität: Eigenschaft instabiler Atomkerne, spontan ionisierende, auf Organismen oft mutagen wirkende Strahlung auszusenden
[4] Adaptive Radiation (Ausbreitung mit/durch Anpassung): Ein Prozess, bei dem sich Organismen von einer ursprünglichen Art schnell zu einer Vielzahl neuer Formen entwickeln, insbesondere wenn Veränderungen der Umwelt neue Ressourcen verfügbar machen, biotische Interaktionen sich verändern oder sich neue ökologische Nischen öffnen. Ausgehend von einem einzigen Vorfahren führt dieser Prozess zur Artbildung und phänotypischen Anpassung einer Reihe von Arten mit unterschiedlichen morphologischen und physiologischen Merkmalen. Ein bekannteres Beispiel ist die Adaptive Radiation bei Darwinfinken. Die Gattung Argyranthemum auf Teneriffa hat sich, so wird angenommen, stark diversifiziert durch Einnischung in unterschiedlichste klimatische, höhenlagenanhängige Vegetationszonen.
[5] Ökologische Nischen: Meist kleine Gebiete, Habitate, mit relativ einheitlichen Lebensbedingungen
[6] Amölobus: Name für einen hypothetischen Vorfahren
[7] Lobamöbus: Name für einen hypothetischen Vorfahren
[8] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose die Verdoppelung der Chromosomen stattfindet
[9] Chromosom: Genetische Informationseinheit aus unterschiedlichen Mengen DNA (oder selten RNA bei Viren) diverser Basensequenzen
[10] Allele: Unterschiedliche Varianten eines Gens an einer bestimmten Stelle (Genort) eines Chromosoms
[11] Phänotyp: Erscheinungsbild, Aussehen, eines Organismus‘ oder einer Organismenkolonie
Eingestellt am 6. Juli 2024
.

Eukarya, Echtzellkerner
10 Reduktion (HP,SP)
.
Chaos herrscht allüberall in Amöbenkolonien!
Verschmilzt doch jede Amöbe[1] mit jeder, vermehren Chromosomenbestände fast gleicher Struktur.
Aber Nachrichtenwirrwarr stört den Versand von
Molekülen und Information.
.
Als ‚Gewonnen und wieder zerronnen’
Erwiese sich folglich der Vorteil diploider[2] Kerne,
Prägte der doppelte Satz Chromosomen
Nicht der Zelloberfläche brandneue Kennzeichen ein.
.
Proteine mit Zuckern verknüpft[3]
Geben Amöben ein deutliches Zeichen:
Hier war schon ein Fusionskonkurrent.
Vergeblich bleibt ein Versuch!
.
Lectine[4] signalisieren Individuen
Mit sich ergänzenden, spezifischen Glycoproteinen,
Zukunft versprechendes Werben
Um den verschmelzungsbereiten Partner.
.
Konstant diploide Amöben, gepuffert durch Genorte zweifacher Zahl,
Trotzen nun wirksam der ständig sich ändernden Umwelt,
Passen in vielerlei Weise oft sich wohlgezielt an.
Wo aber bleiben geeignete Partner?
.
Eine Sackgasse, möchte man meinen,
Verharrte die Zelle diploid.
Sich uurch Partnerwahl genetisch zu regenerieren?
.
Erneut wird die Zelle sich teilen, doch nicht in mitotischer Form.
Chromosomen versuchen, Zwillingen ähnelnden Paaren,
Zur Mitte des Kerns, zum Äquator[7], zu kommen:
Finden einander, homologe[8] steh’n sich gepaart gegenüber.
.
Bilden zwei dicht aneinander gelagerte Ebenen,
Achteten nicht auf Herkunft der beiden je gleichen:
Zusammengewürfelt in je einem Plan
.
Formen Chromosomengemeinschaften neuester Kombination.
Zügig die Zelle geteilt, entstehen haploide Bionten,
Die bereit, kompatible[13] Amöben zu suchen.
.
Haploide, meiotisch[14] entstandene Zellen
Verschmelzen erneut zu diploiden,
Wandeln neu sich zu haploiden Gameten[15]:
Geregelte Wechsel von haplo- zu diploid
Treiben durch Sexualität[16] der Arten Evolution. –
.
Was war Triebfeder, sich meiotisch zu geben?
Die gleiche, wie heute noch:
Der Chromosomen Durchmischung, des Genoms Variabilität zu gewinnen!
Weitergereichter nur mitotisch gebildeter Genbestand
Würde Anfälligkeit gegen Schmarotzer[17] nur bringen,
Vorschub leisten Gefahren, dass eine Art, kaum entstanden, wieder erlischt.
.
So waren Eukaryoten, die diploide Chromosomenbestände auf haploid reduzierten,
Eindeutig im Vorteil, Gewinner im Kampf ums Überleben, Lieblingswesen der Evolution.
Denn, wer ausschließlich diploid oder haploid sein Leben gestaltete,
War auf Glücksfälle verwiesen, Nischen zu finden, die niemand sonst fand,
Oder, auch dies wäre möglich gewesen, doch fehlten Voraussetzungen ihnen dafür,
Sich übermäßig zu mehren und zugleich sich weit zu zerstreu’n.
.
Fußnoten
[1] Amöben, Wechseltierchen: Verändern ständig ihre Form, weil zellwandlos, stülpen Fortsätze des Protoplasten aus, umfließen Nahrung, um Nahrungsvakuolen (Endosomen) zu bilden, ihren Fang zu verdauen. Amöben kommen in verschiedenen Organismenreichen vor; repräsentieren also keine Verwandtschaft, sondern nur eine Lebensstrategie; ein Organismenreich (Amoebozoa) umfasst jedoch nur Amöben
[2] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer Chromosomen; ausgedrückt mit 2n
[3] Glycoproteine: Substanzen aus Zuckern und Proteinen
[4] Lectine: Glycoproteine der Zelloberflächen, die ein passendes Gegenstück auf einer anderen Zelle besitzen; nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip finden sich so zueinanderpassende Zellen.
[5] Bionten: Allgemeine Bezeichnung für Lebewesen
[6] Haploid: Zellkerne mit einem einfachen Chromosomensatz; ausgedrückt als n
[7] Äquatorialebene, Metaphasenplatte (Kernteilung): Wenn Chromosomen in der Mitte zwischen den Polen in einer Ebene angeordnet sind
[8] Homologe Chromosomen: Gleichartige, von zwei Partnern stammende Chromosomen, die sich hinsichtlich Form, Struktur und Abfolge der Genorte genau entsprechen.
[9] Amölobus: Name für einen hypothetischen Vorfahren
[10] Lobamöbus: Name für einen hypothetischen Vorfahren
[11] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.
[12] Metaphasenplatte, Äquatorialebene (Kernteilung): Wenn Chromosomen in der Mitte zwischen den Polen in einer Ebene angeordnet sind
[13] Kompatibel: zueinanderpassend; sexuell verträglich
[14] Meiose, meiotisch: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende, homologe Chromosomen, im Kern sich mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne in letztlich vier Zellen liegen.
[15] Gameten: Für sexuelle Fortpflanzung vorgesehene haploide Zellen
[16] Sexuelle Fortpflanzung: Dafür sind drei Vorgänge miteinander gekoppelt, Meiose (abgekürzt mit R!), Plasmogamie (Zellen vereinen sich, abgekürzt mit P!) und Karyogamie (Kerne verschmelzen, abgekürzt mit K!) verbunden, wobei P! und K! mit Ausnahme bei Dikaryota unmittelbar aufeinander folgen. Bei Dikaryota
(Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya) sind beide Vorgänge unterschiedlich lang (weit) voneinander getrennt. Da bei Animalia und Plantae P! und K! unmittelbar aufeinander folgen, werden beide Vorgänge häufig zu Befruchtung (B!) zusammengefasst.
[17] Schmarotzer, Parasit: Ein Organismus lebt auf Kosten eines anderen.
Eingestellt am 6. Juli 2024
.
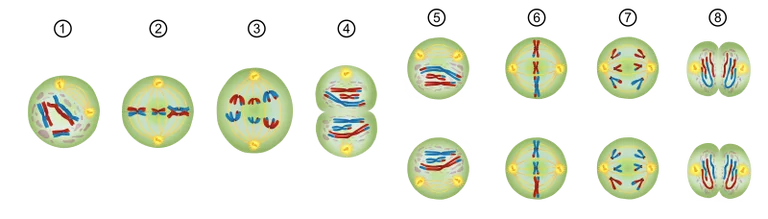
Diagram der Meioseschritte
Schema der Meiose. In diesem Beispiel sind drei Paare homologer Chromosomen mit je zwei Chromatiden dargestellt und deren Anteile je blau bzw. rot gekennzeichnet nach dem Elternteil, von dem sie geerbt wurden. Außerdem sind Mikrotubuli und Centrosomen (beide gelb-orange) dargestellt, um die Phasen der Teilungen besser unterscheiden zu können.
Die Phaseneinteilung entspricht im Wesentlichen jener der Mitose: Auf (1) Prophase I (hier dargestellt in der Unterphase der Diakinese, der letzten Phase der Prophase I), (2) Metaphase I, (3) Anaphase I, (4) Telophase I der ersten meiotischen Teilung, der Reduktionsteilung; nach einer hier nicht dargestellten Zwischenphase der Interkinese (gewisses Ruhestadium) folgt die zweite meiotische Teilung als Mitose mit (5) Prophase II, (6) Metaphase II, (7) Anaphase II, (8) Telophase II.
In (3) und (4) sind die Ergebnisse des Crossovers zu sehen, bei dem rote und blaue Abschnitte die Chromosomen wechselten.
Autor: Ali Zifan
Eingestellt am 6. Juli 2024
.

Eukarya, Echtzellkerner
11 Polwanderung
.
Tubuli[1] spielen entscheidende Rollen im Kernteilungsverlauf.
Ohne ihr Wirken blieben Chromosomen
Im Zentrum des Kerns, am Äquator[2]:
Könnten nicht separate Zellkerne bilden.
.
Wachsen, sacht tastend, Tubulipärchen geschwind sich entgegen[5],
Berühren, umklammern sich fest
Vergrößern, sich streckend, den Abstand von Pol[6] zu Pol.
.
Dazwischen verlängern und schieben sich,
Sich durch Abbau von Tubulinmolekülen[9] ständig verkürzend,
Ziehen sie, Zwillingsschwestern rasch trennend, je eine zum jeweils näheren Pol.
.
Ist ihr Auftrag erfüllt,
Bleibt dem Kern, nach Verschwinden seines nun einzigen Pols,
Nur Hoffnung auf Wiederkehr,
Rufen Chromosomen erneut nach einer Aktion. –
.
Weitere Arten der Separation
Unterstützen die Teilung der Kerne:
Beständig verfügbare Spindelpolkörper[10] im Innern des Kerns
Oder meist dicht seiner Außenseite angefügt.
.
Auch eine seltsame Kernteilungsweise ist möglich:
Pole verbindende Tubuli verformen Kerne wie Hanteln und
Zieh‘n der Kernmembran anhaftende
Chromatiden[11] entzwei.
.
Fußnoten
[1] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.
[2] Äquatorialebene, Metaphasenplatte (Kernteilung): Wenn Chromosomen in der Mitte zwischen den Polen in einer Ebene angeordnet sind
[3] Centriol als Mikrotubuliorganisationszentrum: Zylinderförmige Struktur im Doppelpack nahe der Kernhülle, die sich in vielen lebenden Zellen befindet. Centriolen haben eine Größe von etwa 170 × 500 Nanometern; sind an der Bildung des Mikrotubuliorganisationszentrums beteiligt, das die Mikrotubulispindel für die Chromosomen-, bzw. Kernteilung bildet. Centriolen kommen in den meisten tierischen Zellen vor, sowie in
Pflanzen, nicht jedoch bei Magnoliatae, Bedecktsamer; auch nicht bei Unbegeißelten Chitinpilzen. Charakteristisch ist ihr spezieller Bau aus 9 x 3 Mikrotubuli.
[4] Astrale Mikrotubuli: gehen von den MTOCs Richtung Cytoplasma
[5] Polare Mikrotubuli: gehen von den MTOCs Richtung Chromosomen
[6] Kernteilungspol: Mikrotubuliorganisationszentrum
[7] Centromere: DNA-Abschnitte, die häufig im Zentrum der Chromosomen zu finden sind, gelten als zentrale Verbindungsstelle der beiden Chromatiden vor der mitotischen Teilung. Obwohl ihre Rolle bei fast allen Pflanzen und Tieren die gleiche ist, unterscheiden sich Centromere verschiedener Arten überraschend stark in Größe und Struktur. An den sich am Centromer ausbildenden Proteinkomplexen, den Kinetochoren, setzen dann die Fasern des Spindelapparates an und ziehen die nun getrennten zwei Chromatiden je zu den entgegengesetzten Zellpolen.
[8] Kinetochor-Mikrotubuli: gehen von den MTOCs Richtung Chromosomen und setzen am Centromer an
[9] Alpha-Tubulin und Beta-Tubulin: α- und β-Tubuline (je aus etwa 450 Aminosäuren bestehend) polymerisieren zu Mikrotubuli, einem Hauptbestandteil des eukaryotischen Cytoskeletts. Die Tubuline unterschiedlicher Organismen sind nicht identisch, dadurch variieren die Durchmesser der Mikrotubuli zwischen 20 und 30 Nanometer.
[10] Spindelpolkörper als Mikrotubuliorganisationszentrum: Elektronendichte Körper besonderen Baus, dienen bei Geißellosen Chitinpilzen der Kernteilung; an ihnen setzt die Kernteilungsspindel an, um Chromosomen in die Tochterkerne zu ziehen
[11] Chromatid: Einer der beiden identischen Teile, in die ein Chromosom während der mitotischen Prophase dupliziert wird und am Centromer noch zusammenhängen
Eingestellt am 6. Juli 2024
.

Eukarya, Echtzellkerner
12 Sprachlos (pJP)
.
Kaum ein Phänomen fordert Biologen stärker heraus
Als der komplexen eukaryotischen Geißeln Evolution!
Nicht eine einzige, unwidersprochen gebliebene Deutung
Erklärt die Entstehung dieses äußerst innovativen Organs.
.
Und die eigne Beweglichkeit den zuvor nur gleitenden Zellen verliehen.
Ein Fremdantrieb, wäre zu folgern, begründet die geißelgetriebene Freiheit!
.
Nicht nur einen gewaltigen Nachteil hat der Gedanke:
Spirochätenflagellen, einander entgegengesetzt orientiert, bilden keine harmonische Einheit;
Doch differierende Gene für diese Bewegungsorgane falsifizieren Margulis’[11] Idee!
Wird es jemals gelingen, die Bildung der Geißeln komplett ohne Dich zu versteh‘n?
.
Fußnoten
[1] Mitochondrien: Gelten als Kraftwerke der Zellen, da sie Energie für die zellulären Prozesse liefern; es lassen sich Außen- und Innenmembran unterscheiden, wobei die innere Membran auf einen zellwandlos gewordenen Endosymbionten (ein Alpha-Proteobacterium) zurückgeht, während die äußere Membran der Plasmamembran der Zelle entspricht; prokaryotische Chromosomen weisen ebenfalls auf einen aufgenommenen prokaryotischen Endosymbionten als Ursprung der Mitochondrien hin.
[2] Endocytose: Aufnahme eines Partikels aus der Zellumgebung mit Hilfe eines aus der Zellmembran durch Einstülpung entstandenen Vesikels
[3] Spirochäten: Spirochaeta (Bacteria)
[4] Flagellum, Geißel (Bakteriengeißel): Aus vielen globulären Flagellinproteinen zusammengesetzte Hohlröhre
[5] Zellmembran: Lipiddoppelmembran (Bacteria, Eukarya) oder Glyceroldiethermembran (Archaea), die das Zellinnere umgibt
[6] Alpha-Tubulin und Beta-Tubulin: α- und β-Tubuline (je aus etwa 450 Aminosäuren bestehend) polymerisieren zu Mikrotubuli, einem Hauptbestandteil des eukaryotischen Cytoskeletts. Die Tubuline unterschiedlicher Organismen sind nicht identisch, dadurch variieren die Durchmesser der Mikrotubuli zwischen 20 und 30 Nanometer.
[7] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.
[8] Flagellin: Globuläres Protein, das sich zu vielen selbst zu einem Hohlzylinder anordnet und im westlichen das Flagellum der Prokaryoten (Bakterien und Archäen) bildet
[9] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.
[10] Flagellum, Geißel (Archäengeißel): Aus vielen globulären Proteinen zusammengesetzte nichthohle Peitsche
[11] Margulis, Lynn (1938 – 2011): Amerikanische Biologin und Hochschullehrerin
Eingestellt am 6. Juli 2024
.
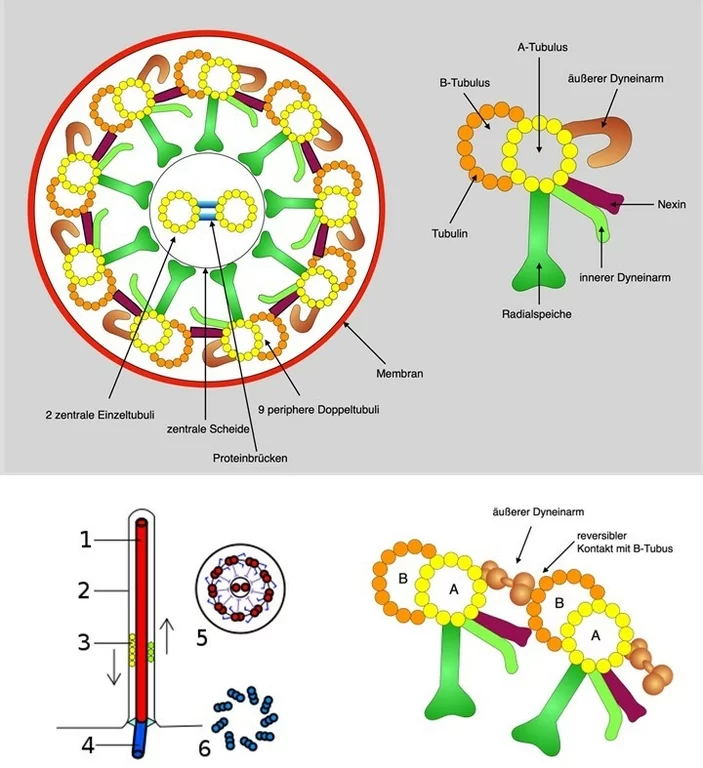
Bau der Eukaryoten-Geißel
Bild links oben: Der immer nur kurz 9+2 (9 periphere Doppeltubuli und zwei zentrale einzelne) genannte Bau der Eukaryoten-Geißel, wird hier in allem Detail dargestellt. Bild rechts oben und rechts unten in funktionellen Details gezeigt.
Autor der Bilder und von Teilen des Textes: Ulrich Helmich
Die Doppeltubuli sind nicht beide als vollständige Tubuli aus 13 Tubulinfilamenten aufgebaut, vielmehr ist nur ein Mikrotubulus (A) vollständig, an den sich ein unvollständiger mit nur 11 (nicht 10, wie hier dargestellt) Filamenten halbmondförmig anschließt (B). Zwei Dyneinarme, Motorproteine, heften an den vollständigen Mikrotobulus sich an, wobei der äußere Dyneinarm die Verbindung zum benachbarten unvollständigen Mikrotubulus herstellt. Er ist mit seiner Basis am Mikrotubulus A befestigt, und mit seinem Kopf kann er Kontakt mit dem Tubulus B des benachbarten Doppeltubulus aufnehmen.
Wenn ATP anwesend ist, werden die Dyneinköpfchen gelöst, unter Spaltung von ATP um ca. 45 º bewegt und dann neu mit dem B-Tubus verbunden, wobei ADP und Phosphat freigesetzt werden. Dabei nehmen die Dyneinköpfchen wieder ihre Ausgangsposition ein. Die Folge dieser Aktion ist eine kleine Verschiebung der benachbarten Doppelmikrotubuli.
Doppeltubuli sind durch die Nexin-Brücken miteinander starr verbunden. Eine Verschiebung benachbarter Doppeltubuli kann daher nicht stattfinden, so dass sich die Gesamtstruktur verbiegt und sich damit auch die Geißeln verbiegen.
Bild links unten: Schema einer Eukaryoten-Geißel
1 – Axonem, 2 – Zellmembran, 3 – Stofftransport innerhalb der Geißel, 4 – Basalapparat; 5 – Querschnitt durch die Geißel außerhalb der Zelle, 6 – Querschnitt durch den Basalapparat innerhalb der Zelle
Autor: Franciscosp2
Eingestellt am 6. Juli 2024
.

Eukarya, Echtzellkerner
13 Vom Gleiten zum Hybridantrieb (HP)
.
Parallel aneinandergeschmiegt,
Wohl mehrfach verbunden mit Armen Dyneins[1],
Überbrücken Dubletten von Tubuli[2]
Zentrifugal der Amöbe[3] plasmatischen Raum.
.
Intensiver Kontakt lässt so manches der Pärchen
Zum ungleich gestalteten Zwilling verschmelzen,
Denn einer der beiden verwendet gleich vier Tubulinfilamente[4] des andern,
Spart zwei dafür der eigenen ein.
.
Eine doppelte Röhre mit rundem und sichelmondförmigem Querschnitt
Gibt nebeneinander laufenden Dyneinen genügend Distanz,
Übergroße Vesikel[5]
Synchron gemeinsam zu zieh‘n.
.
– Imponierend erscheint zunächst die Idee
Konzertierter Aktion.
Doch hätte ein solche Konzept
Nicht bis heute Bestand? –
.
Abbauen, für immer entsorgen, oder für andere Zwecke verwenden?
Radial in ein schmales, vielleicht verlängertes Füßchen verschoben,
Versammeln sich Bündel von Paaren im flachzylindrischen Raum,
Belegen peripher die verlängerte, bodenverhaftete Extremität.
.
Pärchen um Pärchen verbinden gegabelte Arme Dyneins,
In einziger Reihe dem Dreizehner Tubulus[6] aufgesetzt,
Konstruieren so flugs eine Röhre
Aus neun etwas schräg orientierten, zu Tandems gepaarten Tubuli.
.
Zerrend und ziehend verschieben Motore die Zwillingstubuli
Rückwärts und vorwärts bis einmal reifengleich Bindeproteine, den
Röhrenverbund zementierend, die Paare streng parallel halten
Und dazu der Länge nach abgestimmt.
.
Tausend Motoren und mehr können nur dann funktionieren,
Wird nachhaltig Treibstoff[7] geliefert,
Der dem hohen Bedarf der beständig aktiven Maschinen genügt,
Sofern die Infrastruktur für kontinuierlichen Nachschub entspricht.
.
Eng ist der Raum in dem Röhrenversteiften Füßchen für ausschließlich
Passiven Transports dringend benötigten Adenosintriphosphats.
In Vesikeln verpackt, transportieren Motorproteine aktiv es entlang der Röhre
Des Füßchens Membran entlang.
.
Katzengleich strecken sich Dyneine,
Krallen sich oberhalb wieder am Tubulus fest,
Verbiegen so, zunächst noch ohne Koordination, die gesamten neun doppelten Tubuli,
Den vormals im Querschnitt runden Schlauch nun gänzlich verformend.
.
Die Stabilität der Struktur zu erhöhen,
Verankern Speichen, dem inneren Rand des Zylinders entspringend,
Das Rad an die mittigen Tubuli;
Halten so der verklammerten Zwillinge Stellung im Rund.
.
Zwangsläufig nimmt die armierte Extremität
Gleichfalls Zylinderform an.
Sacht sich bewegend, erzeugt sie kaum merklichen Druck oder Zug noch
Auf das Ende der Zelle.
.
Unregelmäßig verteilte, weit voneinander entfernte Dyneine erschweren
Arbeitsabläufe zu koordinieren und zu synchronisieren.
Gesteigerte Mengen Transportproteine brauchen zudem mehr Energie,
Die Geißel weit schneller zu schwingen.
.
Außergewöhnlich komplex und präzise bestimmt
Sind die einzelnen Schritte für Planung und Bau der Akteure
Bis es gelingt, was Bakterien lange schon möglich,
Sich frei hinaus in die Welt zu bewegen: Noch aber fehlt die befreiende Lösung. –
.
Erklärungsversuche für kaum Erklärbares von
Evolutionsbiologen mit
Rudimentär nur vorhandenem Glauben?
Doch so oder so ist Glaube gefordert!
.
Fußnoten
[1] Dynein: Ein zur Gruppe der Motorproteine gehörendes Molekül, das dem Transport von Vesikeln und anderen Transport- und Bewegungsvorgängen dient. Das Dynein-Protein besteht aus einer Kopfregion, die an Mikrotubuli binden, sowie einem Schwanzteil, der mit anderen Proteinen interagieren kann. Dyneinkomplexe binden ein zu transportierendes Molekül an sich und „laufen“ dann entlang eines Mikrotubulus. Der Transport erfolgt gerichtet, da Dynein auf dem Mikrotubulus nur in Richtung des sogenannten minus-Endes wandern kann. Dyneine transportieren also ihre Fracht von der Peripherie in Richtung Mikrotubuliorganisationscentren, MTOCs.
[2] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.
[3] Amöben, Wechseltierchen: Verändern ständig ihre Form, weil zellwandlos, stülpen Fortsätze des Protoplasten aus, umfließen Nahrung, um Nahrungsvakuolen (Endosomen) zu bilden, ihren Fang zu verdauen. Amöben kommen in verschiedenen Organismenreichen vor; repräsentieren also keine Verwandtschaft, sondern nur eine Lebensstrategie; ein Organismenreich (Amoebozoa) umfasst jedoch nur Amöben
[4] Tubulinfilamente: Hintereinander in regelmäßigem Wechsel stehende α- und β-Tubuline bilden Tubulinfilamente, die zu dreizehnt im Rund den Mikrotubulus formen. α- und β-Tubuline stehen in nebeneinanderliegenden Filamenten etwas versetzt zueinander, so dass der Eindruck entsteht, jedes der beiden Tubuline wäre durch seine schraubige Anordnung für den Bau der Mikrotubuli verantwortlich.
[5] Vesikel (Zellvesikel): Kleine, abgegliederte, rundliche, doppelmembranumhüllte Behälter.
[6] Mikrotubulus
[7] ATP: Adenosin-Tri-Phosphat; bestehend aus Ribose und Adenin; Ribose trägt an seiner nicht in den Zuckerring einbezogenen Kohlenstoffgruppe drei hintereinander liegende Phosphatgruppen. Diese lineare Anordnung der Phosphate hat zur Folge, dass das dritte, äußerste Phosphat, mit seiner ihm dadurch innewohnenden Energie, diese leicht unter Abspaltung auf andere Moleküle übertragen kann
Eingestellt am 6. Juli 2024
.
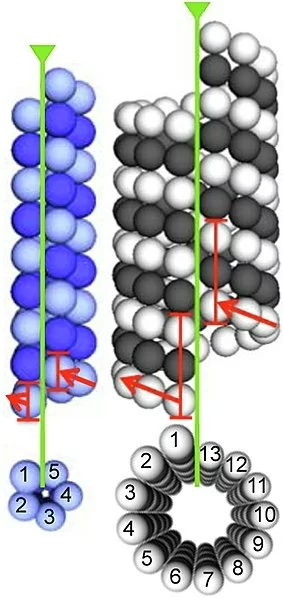
Bakterielle und Eukaryotische Mikrotubuli
Schematische Darstellung der vorgeschlagenen Architekturen von Mikrotubuli aus 5 Protofilamenten von Bakterien (links) und 13 Protofilamenten von Eukaryoten (rechts). BtubA und BtubB (Bakterielle Tubuline A und B) werden in Dunkel- bzw. Hellblau dargestellt. α- und β-Tubulin (eukaryotische Tubuline α und β) sind in Weiß (minus-Ende, unten) bzw. Schwarz (plus-Ende, oben) dargestellt. Nähte sind grün und Starthelices rot dargestellt.
Autoren: Pilhofer, M., Ladinsky, MS, McDowall, AW, Petroni, G., Jensen, GJ
Lizensiert unter Creative Commons Attribution 4.0 International-Lizenz
Eingestellt am 6. Juli 2024
.

Eukarya, Echtzellkerner
14 Energieeffizienz
.
Modische Mobilität konsumiert ausgesprochen viel Energie!
Unerschlossene Quellen zu finden, für diese Mengen ATP[1]
Ist entscheidend für Nutzung und volle Funktion von Bewegungsverläufen.
.
Pyruvat[4] abzubauen, erschlösse noch zusätzlich Power,
Viel mehr als Glucosezerteilung in zwei Mal Pyruvat!
Das Acetyl-Co-Enzym A[5] darf dann sich jedoch nicht sogleich zur Essigsäure spalten!
Gebunden an weitere Träger beliefert es Stufe um Stufe Motoren mit Treibenergie.
.
Acetyl[6], geknüpft ans schwefelbeladene Coenzym,
Befreit sich im Kreislauf von zwei CO2,
Produziert 10 ATP und noch drei NADH2[9] dazu.
.
Ein Molekül Glucose beliefert so
Synthesen mit dreißig plus vier ATP!
Die gleiche Zahl Dyneine verbiegen damit
In der Geißel benachbarte Tubuli[10].
.
Zehntausend Glucoseringe könnten genügen,
Die Geißel einmal kurz von links dann wieder nach rechts zu schwingen.
Doch woher die Mengen Treibstoff zur schwirrenden Geißelbewegung
Ohne Mangelerscheinungen nehmen?
.
Nahrungsvesikel[11] bilden noch immer die Basis
Für geißelbedingte Bewegung,
Nicht nur für amöboides Gebaren.
Glucose allein jedoch speichert zu wenig kompakt Energie!
.
Fußnoten
[1] ATP: Adenosin-Tri-Phosphat; bestehend aus Ribose und Adenin; Ribose trägt an seiner nicht in den Zuckerring einbezogenen Kohlenstoffgruppe drei hintereinander liegende Phosphatgruppen. Diese lineare Anordnung der Phosphate hat zur Folge, dass das dritte, äußerste Phosphat, mit seiner ihm dadurch innewohnenden Energie, diese leicht unter Abspaltung auf andere Moleküle übertragen kann
[2] Glucose, Traubenzucker: Ringförmiger Zucker mit sechs [C]-Atomen [C6H12O6]; der Ring besteht aus fünf [C]-Atomen und einem Sauerstoffatom; das restliche [C]-Atom hängt als [–CH2OH]-Gruppe an einem dem Sauerstoff benachbarten [C]-Atom; vier [–OH]-Gruppen stehen an [C]-Atomen des Rings, wobei [–CH2OH] und die dem Sauerstoff benachbarte [–OH]-Gruppe in gleicher Richtung stehen, alle anderen wechseln sich richtungsmäßig ab
[3] Dynein: Ein zur Gruppe der Motorproteine gehörendes Molekül, das dem Transport von Vesikeln und anderen Transport- und Bewegungsvorgängen dient. Das Dynein-Protein besteht aus einer Kopfregion, die an
Mikrotubuli binden, sowie einem Schwanzteil, der mit anderen Proteinen interagieren kann. Dyneinkomplexe
binden ein zu transportierendes Molekül an sich und „laufen“ dann entlang eines Mikrotubulus. Der Transport erfolgt gerichtet, da Dynein auf dem Mikrotubulus nur in Richtung des sogenannten minus-Endes wandern kann. Dyneine transportieren also ihre Fracht von der Peripherie in Richtung Mikrotubuliorganisationscentren, MTOCs.
[4] Pyruvat, Brenztraubensäureion: [CH3COCOO− + H+]; durch sog. Glycolyse aus Glucose gewonnen, verliert unter ATP-Gewinn ein CO2, übrig bleibt ein Acetyl (=Essigsäurerest) mit zwei Kohlenstoffatomen und Formiat, das anschließend ohne Energiegewinn in CO2 und H2 zerfällt. Das Acetyl könnte aber auch alternativ unter weiterem Energiegewinn zu Wasser und CO2 abgebaut werden
[5] Acetyl-Coenzym A: Coenzym A, beladen mit Acetylrest
[6] Acetylrest: [–CHCOOH]
[7] Oxalacetat: [COOHCOCH2COO− + H+]
[8] Citrat: [COOHCH2C(OH)(COOH)CH2COO− + H+]
[9] NADH2 (=NADH + H+): Nicotinamid-Adenin-Di-Nucleotid mit zusätzlichem Wasserstoff und einem damit gekoppelten Proton (H+). Anstelle eines dritten Phosphats, wie am ATP, wird hier das zweite Phosphat mit einer Ribose verknüpft, die als Seitenkette ein Nikotinamid trägt. Dieses NADH + H+ kann zum einen verwendet werden, den Wasserstoff auf andere Moleküle zu übertragen, um sie zu reduzieren; damit werden diese energiereicher. Zum anderen kann es aber auch dazu dienen, meist drei ATPs aufzubauen (ein drittes Phosphat wird dabei an ADP angehängt); es selbst ändert sich zum NAD, das wiederum zum NADH + H+ regeneriert werden kann
[10] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.
[11] Nahrungsvesikel: Durch Endocytose entstandene Verdaungsvesikel, die tote Partikel oder Organismen enthalten können; verdaut wird, was verfügbar (Proteine, Fette, Zucker, Nucleinsäuren, Cellulose, etc.)
Eingestellt am 6. Juli 2024
.
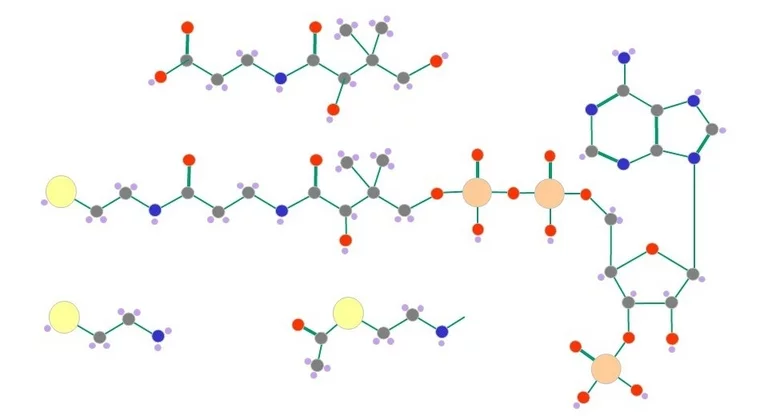
Co-Enzym A (ppt generiert, Reinhard Agerer)
Co-Enzym A setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen: dazu gehören Adenosindiphosphat, ADP (rechts im Molekül), das Vitamin Pantothensäure, B5 (Mitte des Moleküls und darüber in Einzeldarstellung) sowie Cysteamin (links im Molekül und darunter in Einzeldarstellung). Acetyl-Co-Enzym A (Mitte darunter, nur das acetylierte Schwefelende des Co-Enzym A dargestellt)
Grau: Kohlenstoff; blau: Stickstoff; rot: Sauerstoff; violett: Wasserstoff; Gelb: Schwefel; ocker: Phosphor; dünne grüne Linie: Einfachbindung; dicke grüne Linie: Doppelbindung.
Autor: R. Schunk, IVA Univ Ulm, 06/1999
Eingestellt am 6. Juli 2024
.

Eukarya, Echtzellkerner
15 Verwurzelung
.
Weit unterlegen noch ist diese Geißel[1] den
Denn flugs knickt sie
An der Wurzel zur übrigen Zelle noch ab.
.
Widerstandsfähig verankert inmitten des winzigen Körpers
Verlieh’ dem Bionten[4] Stabilität,
Um der schwingenden Geißel entwickelte Kraft,
Zu übertragen auf den vorderen Part.
.
So wird die Basis der Tubuliröhre[5] verlängert
Hinein in den Körper der Zelle,
Verankert das zellinnere Ende von
Beinahe keglig arrangierten, zu Scheiden gebündelten Tubuli.
.
Kurze und lange, geregelt im Wechsel,
Verstreben die Geißel wie haltende Taue;
Geleiten Vesikel gezielt an die Basis,
Zu stillen das Verlangen nach mehr Energie.
.
Verlängern allein den äußeren Tubulikranz,
Belassen die mittigen, so wie sie ursprünglich waren.
Die Zwillinge lagern nach innen sich viel kürzere Tubuli an
Gestalten dabei sich zu Drillingen um.
.
Als Basalkörper[6] grenzt sich die Neubildung
Von der übrigen Geißel oft mit hauchdünner Basalplatte[7] ab,
Um die eigene Identität zu bewahren
Und als Grundfeste dem Bau der Geißel zu dienen.
.
Nur peripher fest verklebt,
Zum Zylinder geformt,
Funktioniert auch diese Struktur wie eine Leitstruktur
Für Lieferung dringend benötigten ATPs[8].
.
Haarfeine Speichen ins Zentrum hinein
Separieren in der Geißelbasis den neu entstandenen Körper
Vom restlichen Teil des Flagellums,
Leisten möglichem Abtrennen Vorschub.
.
Cytoplasmaproteine verknüpfen abwechslungsreich
Das Basalorganell mit den strahlig und scheidig verorteten Tubuli;
Geben der Geißel den nötigen Halt,
Effizient Bewegungskraft an den vorderen Teil der Amöbe[9] zu lenken. –
.
Ein halbautonomes Genom an der Geißelbasis basalem Zylinder
– Nur in einziger Zelle bis dato gefunden –
Verlangen tatsächlich nach neuen Beweisen
Für der Geißel endosymbiotische Integration.
.
Fußnoten
[1] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.
[2] Flagellum, Geißel (Bakteriengeißel): Aus vielen globulären Flagellinproteinen zusammengesetzte Hohlröhre
[3] Flagellum, Geißel (Archäengeißel): Aus vielen globulären Proteinen zusammengesetzte nichthohle Peitsche
[4] Bionten: Allgemeine Bezeichnung für Lebewesen
[5] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.
[6] Basalkörper: Gehen unmittelbar aus Cenriolen hervor, wie sie auch feinstrukturell den Centriolen sehr ähnlich sind. Bei der Umwandlung von Centriolen in Basalkörper wandern diese unter die Plasmamembran und orientieren sich senkrecht zu ihr. An der Kontaktstelle, von der dann die Geißel auswächst, wird eine Basalplatte gebildet. Von hier nach außen wird das typische 9x2 + 2-Muster ausgebildet, während im Basalkörper hinsichtlich der Anordnung der Mikrotubuli die charakteristische Centriolenstruktur (9x3 + 0) erhalten bleibt.
[7] Basalplatte (Eukaryageißel): Dünne, elektronendichte Platte zwischen Geißel und ihrem Basalkörper
[8] ATP: Adenosin-Tri-Phosphat; bestehend aus Ribose und Adenin; Ribose trägt an seiner nicht in den Zuckerring einbezogenen Kohlenstoffgruppe drei hintereinander liegende Phosphatgruppen. Diese lineare Anordnung der Phosphate hat zur Folge, dass das dritte, äußerste Phosphat, mit seiner ihm dadurch innewohnenden Energie, diese leicht unter Abspaltung auf andere Moleküle übertragen kann
[9] Amöben, Wechseltierchen: Verändern ständig ihre Form, weil zellwandlos, stülpen Fortsätze des Protoplasten aus, umfließen Nahrung, um Nahrungsvakuolen (Endosomen) zu bilden, ihren Fang zu verdauen. Amöben kommen in verschiedenen Organismenreichen vor; repräsentieren also keine Verwandtschaft, sondern nur eine Lebensstrategie; ein Organismenreich (Amoebozoa) umfasst jedoch nur Amöben
Eingestellt am 6. Juli 2024
.

Eukarya, Echtzellkerner
16 Endlich frei! (HP)
.
Ständiger Druck intern auf die Zelle,
Folge beständigen Schlagens der Geißel[1],
Beschleunigt das Gleiten, verringert die Haftung am Boden
Löst die Amöbe[2], für kurze Zeit zwar nur, vom festen Substrat.
.
Ein Anflug von Schwimmen ist’s,
Bestimmt noch kein Eilen.
Denn schnell geh‘n Reserven zur Neige.
Für Nahrungssuche wird es längst wieder Zeit!
.
Schwimmen, dann wieder grasen in nahrhaften Gründen
Gestalten gewonnene Freiheit,
Zwingt doch Reservestoffmangel, die Ausbreitungsweite
Empfindlich beschränkend, oft sie schnell auf den Boden zurück.
.
Auftanken heißt die Devise!
Reserven aus öligen Fetten[3]
Befüllen Vesikel, begrenzt von halben Membranen[4],
Ballongleich Cisternenwänden[5] entsprungen.
.
Langstreckenschwimmen ist nun Programm dimorpher Wesen[6].
Doch gleitendes, bodenverhaftetes Wandern
Bleibt – anfangs noch zumindest – unverzichtbare Disziplin.
Wechselnde Umweltbedingungen fordern die nun befreiten Bionten[7] erheblich heraus.
.
Fußnoten
[1] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.
[2] Amöben, Wechseltierchen: Verändern ständig ihre Form, weil zellwandlos, stülpen Fortsätze des Protoplasten aus, umfließen Nahrung, um Nahrungsvakuolen (Endosomen) zu bilden, ihren Fang zu verdauen. Amöben kommen in verschiedenen Organismenreichen vor; repräsentieren also keine Verwandtschaft, sondern nur eine Lebensstrategie; ein Organismenreich (Amoebozoa) umfasst jedoch nur Amöben
[3] Fettes Öl, Lipide: Ein Triglycerid aus Glycerin (mit drei [–OH]-Gruppen) und drei Fettsäuren, die als Fettsäurereste unter Wasserabspaltung ans Glycerin gebunden und eine Bindungsgruppe –C–O–(C=O)– ergeben
[4] Zellmembran: Lipiddoppelmembran (Bacteria, Eukarya) oder Glyceroldiethermembran (Archaea), die das Zellinnere umgibt
[5] Cisternen (Zell-): Abkömmlinge des endoplasmatischen Retikulums in hohler und oft flacher Form; Zellvesikel auch Zellkerne sind damit umgeben, besitzen den gleichen Grundbau wie die Zellmembran.
[6] Dimorph: Sind Organismen treten sie in zwei verschiedenen vegetativen Erscheinungsformen auf; hier als Amöbe und als geißeltragender Flagellat
[7] Bionten: Allgemeine Bezeichnung für Lebewesen
Eingestellt am 6. Juli 2024
.

Eukarya, Echtzellkerner
17 Antriebsvielfalt (SP)
.
Beständig erfährt Freiheit natürliche Grenzen,
Bedingt durch eingeschränkte Beweglichkeit, Nahrung, verfügbaren Freiraum und Konkurrenz.
Zudem begrenzen Sauerstoffmengen die Effizienz
Organische Quellen energetisch zu nutzen.
.
Innovationen mit Zukunftspotential,
Immer am Start von Evolutions- und Differenzierungsschüben,
Bestimmen auch hier Optimierungsversuche,
Geeignete Stellung der Geißeln am Körper zu finden.
.
Ob zwei oder mehr noch davon, besondere Vorteile bringen,
Zügig den Raum zu erschließen, Rivalen schnell zu entfliehen,
Bedarf wiederholten Versuchs.
.
Schlangengleich schlägt die am hinteren Ende der Zelle entspringende Geißel.
Welle für Welle bewirkt sie winzige Drücke nach vorne nur,
Schiebt dennoch ununterbrochen den zierlichen Körper voran.
Opisthokonte Begeißelung[3] wird dieser Typus genannt.
.
Am vorderen Ende fixierte, schnell kreisende Geißeln
In Ein- oder Zweizahl, rotieren fast trichtergleich
Längs voran um die Achse der langsam sich drehenden Zelle.
Die ziehende Richtung legt treffend den Namen als Zuggeißel fest.
Schlagen sie dennoch nach hinten,
Ähneln sie Armen brustschwimmender Sportler.
Gleichlang, heißen sie isokont[4],
Wenn anisokont[5], sind sie von ungleicher Länge.
.
Gleichfalls zwei Geißeln, doch inserierend an
Unterschiedlichen Orten, am Apex und an der Seite,
Schlagen wie Peitschen nach hinten, treiben Bionten voran.
Namenlos noch ist der seltene Typ.
.
Zwei Geißeln, fest ineinandergefügt an ihrer Basis,
Die kurze vereint mit der langen,
Tief eingesenkt der am vorderen Ende gelagerten Grube,
Sind typisch für wenige, geißelgezogene Algen[6].
.
Auftrieb vergrößernde Flächen aus zwei feinen Reihen von Haaren,
An einer nach vorne blickenden, hin und her wedelnden Geißel[7],
Ergänzt durch einen zweiten, nach hinten gerichteten, glattflächigen Partner,
Charakterisieren den heterokonten[8] Begeißelungstyp.
.
Schwimmen erschließt zwar zukunftsverheißenden Raum,
Aber Kriechen ist manchen unumgänglich noch,
Gehaltvolle Nahrung zu jagen,
Deshalb behalten manche Bionten[9] lange beide Bewegungsweisen noch bei.
.
Konservative Amöben[10] verzichten vollkommen auf neue Beweglichkeit;
Bleiben am Felsen inmitten saftiger Matten,
Geben nicht frei den günstigen Ort
An Zeitflagellaten gelegentlich amöboider Gestalt.
.
Fußnoten
[1] Schubgeißel: Die Geißel ist am hinteren Ende des Flagellaten angebracht und schiebt den Körper voran
[2] Zuggeißel: Die Geißel ist am vorderen Ende des Flagellaten angebracht und zieht den Körper voran
[3] Opisthokont begeißelt: Die Geißel inseriert am hinteren Ende des Flagellaten und schiebt den Körper voran.
[4] Isokont: Trägt der Flagellat zwei Geißeln, so sind sie gleichgestaltet und auch gleichlang
[5] Anisokont: Trägt der Flagellat zwei Geißeln, so sind sie gleichgestaltet aber ungleich lang
[6] Algen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für überwiegend im Wasser lebende Thallophyten
[7] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.
[8] Heterokont: Trägt der Flagellat zwei Geißeln, so sind sie ungleich gestaltet; eine ist mit zwei Reihen seitlicher Haare ausgestattet und ragt nach vorne, die andere ist glatt und peitschenartig nach hinten gerichtet
[9] Bionten: Allgemeine Bezeichnung für Lebewesen
[10] Amöben, Wechseltierchen: Verändern ständig ihre Form, weil zellwandlos, stülpen Fortsätze des Protoplasten aus, umfließen Nahrung, um Nahrungsvakuolen (Endosomen) zu bilden, ihren Fang zu verdauen. Amöben kommen in verschiedenen Organismenreichen vor; repräsentieren also keine Verwandtschaft, sondern nur eine Lebensstrategie; ein Organismenreich (Amoebozoa) umfasst jedoch nur Amöben
Eingestellt am 6. Juli 2024

Eukarya, Echtzellkerner
18 Zum Verschnaufen
.
Zwölf Komma zwei Milliarden Jahre sind schon vorbei
Seit damals die Welt mit dem Urknall[1] begann.
Die letzte Milliarde galt der Evolution
Einer Vielfalt eigenbeweglicher, gutorganisierter Zellen.
.
All die lebenswichtigen, fein abgestimmten Prozesse
Sind universell verfügbar nun und warten gespannt,
Ob neue Optionen die Evolution noch beflügeln und
Schöpferisch weisen in die nähere oder auch fernere Zukunft.
.
Eines vermissen Eukaryoten,
Was Prokaryoten schon längstens bekannt:
Verwehrt ist ihnen noch, Licht in chemisch gebundene Energie zu verwandeln
Für kinetische Kraft.
.
Auch dieser Mangel wird zu bewältigen sein!
Hat nicht die Amöbe vor urlangen Zeiten
Schon einmal Prokaryoten verschlungen und
Große Gewinne gezogen, den Check-Pot geknackt?
.
Sieben ungleiche Reiche besiedeln
Verschied‘ne Gewässer,
Drängen gezielt – mitunter gemeinsam –
Ans unwirtlich leere und steinige Land.
.
Amoebozoa, Rhizaria, Excavata,
Amöbentierchen, Wurzelfüßer und Ausgehöhlte,
Wandern gerne noch kriechend daher.
Chromalveolaria, Farbmuldige[2],
Lieben die Vielfalt des Lebens.
Animalia, Fungi[3] und Plantae,
Tiere, Pilze und Pflanzen,
Besiedeln jeden erdenklichen Raum. –
.
Du freust Dich, was aus Deinen Ideen
Zur Erschaffung der Welt schon erfolgreich geworden;
Gibst ihr noch einmal tausendfünfhundert Millionen Jahre,
Deine Wünsche mit neuen Ideen zu füllen.
.
Fußnoten
[1] Weltalter: 3,8 Milliarden Jahre
[2] Farbmuldige: Bläschenumgrenzte
[3] Sind zunächst noch mit gemeinsamen Vorfahren in Opisthokonta vereint
Eingestellt am 6. Juli 2024
.

Der Organismen Reiche (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer)
Aus dem Wasser ragen Bacteria, Bakterien, (links unten, gelb) der Zukunft entgegen, wie auch Archaea, Archäen, (rechts unten, ocker). Eukarya, Echtzellkrner, erheben sich weit darüber hinaus: Chromalveolaria, Bläschenumgrenze, Farbmuldige (links, orange), Plantae, Echte Pflanzen, (2. von links, grün) mit Rhodophyta, Rotalgen (violettlich) und typischen grünen Plantae (freudig grün), Rhizaria, Wurzelfüßer, (dunkelgrün) und Excavata, Ausgehöhlte, (blau) schließen sich an; Opisthokonta, Schubgeißler, folgen mit Fungi, Echte Pilze (braun) und Animalia, Echte Tiere (rot), mit gemeinsamer Basis mit Amoebozoa, Amöbentiere (violett).
Eingestellt am 6. Juli 2024
.

.