Bacteria
zum Glossar über:

Bacteria, Bakterien
Bakterien bilden zusammen mit Archäen die sogenannten Prokaryoten, weil sie noch keinen echten Zellkern aufweisen, wie dies für Eukaryoten gilt. Wegen ihrer Kleinheit und ihrer einfachen Spaltung, um aus einer Zelle zwei zu bilden – und dies in einer recht kurzen Generationszeit – auch wegen Fehlens oft zeitaufwendiger sexueller Vermehrung, waren Bakterien schon zu frühester Zeit in ihrer Vielfalt die Lebewesen schlechthin für die Besiedlung diversester Habitate. Auch heute noch spielen sie für die Natur und für jeden einzelnen höher entwickelten Organismus eine erhebliche, oft lebenserhaltende, aber auch lebensgefährdende Rolle. Diese Einflussnahme auf die Evolution und auf das Leben generell, wurde lange wegen der Bakterien Kleinheit, die oft kaum ein Tausendstel Millimeter messen, übersehen. Heute werden sie jedoch immer mehr als Grundlage unseres Lebens verstanden. Welch entscheidende Rolle sie nicht nur für den menschlichen Körper spielen, wird immer deutlicher. Das Mikrobiom des Darms, das hauptsächlich aus Prokaryoten besteht, ist buchstäblich in mancher Menschen Mund, wenn es gilt, das Mikrobiom des Darms neu aufzubauen.
Ein Steckbrief mit Wesensmerkmalen charakterisiert die erste Gruppe eigenständig lebensfähiger Bionten (1 Steckbrief). Dabei werden Eigenschaften der Zellwand, der sterilen Hülle um die eigentliche Zelle, in den Blick genommen, wie auch Charakteristika des inneren Baus und der Bakterien Anfälligkeit gegenüber Stoffwechselprodukten anderer Organismen. Diese Zusammenstellung bereitet auf die Unterschiede zu anderen Bionten vor, die an geeigneter Stelle vergleichend hervorgehoben werden. Gemeinschaften von Bakterien (2 Gemeinschaft) bildeten sich, um in einer Art Zusammenwirken Abfallprodukte der anderen zu verwenden. So können einige Heterotrophe, die bezüglich Energie von schwefelhaltigen Mineralien leben, nicht allen Schwefel verwenden. Geben diesen als zunächst in Wasser gelösten, in höherer Konzentration auch gasförmigen Schwefelwasserstoff, H2S, ab, das anderen als Elektronenlieferant dienen kann (2 Gemeinschaft). Genetische Vielfalt zu erreichen und aufrechtzuerhalten, war sicher zu früher Zeit eine wichtige Voraussetzung für die Besiedlung neuer Habitate. Da sexuelle Fortpflanzung noch keine Option war, kam es höchstwahrscheinlich sehr bald zu Übertragung und Austausch von Erbmolekülen, deren Abgabe und Übernahme noch unspezifisch gewesen sein mochten und damit keiner wesentlichen Beschränkung unterlagen, was als Promiskuität aufgefasst werden kann (3 Promiskuität). Durch Unabhängigwerden von organischen Substanzen der näheren Umgebung und Verwendung von Licht als Energielieferant wird es Bionten möglich, weiter entfernte und auch größere Areale zu besiedeln. Um sich erfolgreich über weite Strecken ausbreiten zu können, ist Eigenbeweglichkeit von großem Vorteil (4 Auf zu neuen Ufern). Zwei Neuerungen, die möglicherweise in engem Zusammenhang stehen, kennzeichnen vieler Bakterien Aussehen und Verhalten. Zunächst musste im Laufe der Evolution ein Transportsystem geschaffen werden, das Ionen und Moleküle durch die Lipiddoppelmembran in das Innere der Zelle schleust. Dazu dient auch heute eine Vielzahl sog. Kanäle in Membranen, die von Proteinen umgeben sind. Sie dienen mit Hilfe von ATPasen Energie des ATPs freisetzen, um gegen den Widerstand der Membran und/oder gegen den Widerstand des gegensätzlich geladenen Innenraums, geladene oder ungeladene, Ionen und kleinere Moleküle zu transportieren. Die Mechanik der in mehreren Etagen angeordneten Proteinmoleküle ist einem Trommelrevolver recht ähnlich, denen in Proteintaschen immer wieder Ionen eingefügt, und durch ein Weiterdrehen dann auf der anderen Seite abgesetzt werden. Nur so is es unter Energieaufwand möglich, einen Transport in die Zelle zu gewährleisten. Doch auch für Transportvorgänge nach außen, können solche Kanäle von Bedeutung sein (5 Mit aller Kraft voraus). In ihrem Aufbau recht ähnlich erscheinen die zum Rotieren der bakteriellen Geißel nötigen Motoren. Doch anstelle Ionen und andere Moleküle nach außen zu bringen, wird ein Kanal genutzt, ein spezifischen Proteins, Flagellin, das in der Zelle synthetisiert wird, nach außen zubrinen, wo es schraubenförmig zu einer Hohlröhre zusammengebaut wird. Sie wird an ihrem Ende nach Erreichen der endgültigen Länge geschlossen. An der Basis krümmt dann ein spezielles Protein die Geißel, so dass ihre Schrägstellung eine propellerartige Anordnung bewirkt. Ein Rotieren erfolgt in ähnlicher Weise wie dies für zu transportierende Ionen gilt. Weil aber die Geißel mit den Kanalproteinen fest verbunden ist, dreht sie sich rasch propellerartig und treibt oder zieht das Bakterium voran. Die recht ähnlichen Grundlagen von Transport durch den Kanal und der Geißelbewegung geben Anlass, auf einen gemeinsamen Ursprung der beiden Bauprinzipen zu schließen. Entsprechend der lebenswichtigen Bedeutung von Transportvorgängen, in die und aus der Zelle, kann geschlossen werden, die Etablierung von Transportkanälen war der Prototyp, aus dem sich auch die Geißelbewegung entwickelte. Der Kreationisten Argument der nicht reduzierbaren Komplexität, weil bei Fehlen eines einzigen Bausteins die Geißelbewegung komplett nicht funktionierte (7 Der Streit), kann mit dem schon früher vorliegenden Prinzip der rotierenden Ionentransportbewegung begegnet werden (6 Zum Innehalten). Warum im Laufe der Evolution eigenbewegliche Bakterien entstanden sind, erklärt sich aus der Möglichkeit, damit neue Gebiete zu erreichen, um Nahrung oder einfach nur um bessere Lebensbedingungen zu finden, oder um einschränkender Konkurrenz zu entkommen. Gleichfalls aber kann der energieaufwendige Bewegungsmodus wieder reduziert werden, wenn stationäres Leben sich als ökonomischer erweist. So lässt sich auch die Weiterexistenz von Motoren erklären, obwohl auf die Eigenbeweglichkeit wieder verzichtet wird (7 Der Streit). Auch dies zeigt, selbst bei Einbuße der Beweglichkeit, bei eventuellem Fehlen eines einzigen Bausteins, ist für Bakterien nicht generell alles verloren (7 Der Streit). Ein Modell, wie schnell sich evolutiv Grundsätzliches ändern kann wird am Beispiel von Kohl,Brassica oleracea, dargestellt. Aus einer Grundform dieser Art, haben sich durch des Menschen selektierenden, evolutionsimitierenden Einfluss, unterschiedlichste Sorten ergeben, die sich sogar sexuell fortpflanzen und damit auch als stabile Varietäten, z. B.Brassica oleraceavar.gongylodesfür Kohlrabi, erkannt werden. Freilich, würde der Mensch seine isolierende Tätigkeit beenden, würden sich unter natürlichen Bedingungen diese Veränderungen wohl nicht erhalten können. Der Mensch schafft aber durch seine Bemühungen diese stabilen ökologischen Nischen, die auch in der Natur als Voraussetzung für ein Bestehenbleiben von Änderungen erforderlich sind (6 Zum Innehalten). Weitere Beispiele für solche vom Menschen hervorgebrachten Veränderungen können diese Tatsache stark untermauern. Ein wesentlicher Faktor für die Geschwindigkeit, mit der sich solche Änderungen manifestieren, ist die Anzahl der Generationen, bzw. die Länge der Generationszeit. Je mehr Generationen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sich Änderungen ergeben und auch durchsetzen. Für Bakterien, die unter guten Bedingungen sich binnen 20 Minuten in ihrer Anzahl verdoppeln können, ist eine evolutive Veränderung schneller zu erwarten, besonders, falls sich ihre Umwelt als sehr heterogen erweist, oder der selektierende Druck sie zu Änderungen gleichsam zwingt. Rezentes Beispiel, wie schnell sich Bakterien an solche evolutiven Drücke anpassen können, ist die Entstehung gegen Antibiotika multiresistenter Vertreter. Dieser Vorgang zeigt, worauf die Evolution gründet und wie schnell Organismen auf neue Herausforderungen reagieren können. Für andere Organismen beträgt die Generationszeit kaum ein halbes Jahr, z. B. für Ratten, ein Jahr für viele Kulturpflanzen und Haustiere, für Menschen, etwa 25-30 Jahre (6 Zum Innehalten). Ein fiktiver Streit zwischen Designisten und Kreationisten einerseits und jenen, die der Tatsache der Evolution anhängen, der verbal, doch auch in Büchern seinen Niederschlag findet, schließt die Einführung zu den Bakterien ab (7 Der Streit).
Eingestellt am 6. April 2024
.

Bacteria, Bakterien
1 Steckbrief
.
Lipide[1] bilden doppelte Membranen,
Proteine[8] und andere Substanzen lagern sich dazwischen noch.
.
Bilden ein Enzym[9] nur
Der Helix[10] Holme zart zu trennen.
Nukleotide[13] Kopf an Schwanz zusammenbinden.
.
Lagern sich, falls zart getrennt,
Bei 50S[16] und 30S.
Unzerlegte Ribosomen zeigen sich bei 70S in Summe etwas leichter.
.
Beginnt der Proteine Bau
Mit Transfer-RNA[17],
Startet diese nur und immer
.
Wärme und Kälte im Wechsel, konzentrierte salzige Umgebung
Ließen manche Pioniere vorschnell kollabieren, auch zerplatzen.
Verleiht der Zelle Raum für Leben, Fortbestand und Halt.
.
Binden sich zur Kette, verklammern sich zur Raumstruktur mit
.
Mit dicker Schicht umgeben sich die einen,
Nach Gram[29] gefärbt und nachgespült, gelten sie als positiv.
Nur dünne Lagen formen doch die meisten, sind dafür noch lipidmembranumhüllt[30]:
Wenn sie gut nach Gram gefärbt, nach Spülen dann verblassen, gelten sie als negativ.
Mit resistenten Zuckerketten kapselartig eingehüllt
Schützen manche Zellen so vor Angriff sich, speichern Wasser auch damit.
.
Zum Ärger der Bionten kämpft der Arzt erfolgreich gegen sie
Doch manch ein Stamm wird – ebenso erfolgreich –
Resistent und damit schnell immun. –
.
Des Rätsels Lösung ist – Bakterien!
.
Fußnoten
[1] Lipide (Membranlipide): Stoffe mit zwei verschiedenen Enden, ein fettlösliches (wasser-abweisendes) und ein wasserlösliches, oft phosphatverknüpftes Ende; je nach umgebender Flüssigkeit können sich die Moleküle orientieren und flächige Verbände bilden und auch zu Doppellagen assoziieren, deren wasserabstoßende Seiten zueinander weisen
[2] Hydrophil (Gegensatz: hydrophob): wasserfreundlich
[3] Cholin [(CH3)3N+CH2CH2OH]: ist ein Amin und bildet zusammen mit dem daran gebundenen Phosphat die hydrophile Gruppe des Phospholipids, der Hauptkomponente der Lipidmembranen
[4] Phosphat: An andere Atome oder Moleküle gebundene Phosphorsäure [H3PO4entspricht O=P(–OH)3]
[5] Glycerin: Dreifachalkohol, [CH2OHCHOHCH2OH], der zwischen Phosphat und den beiden Fettsäuremolekülen des Phospholipids vermittelt; Glycerin gehört noch zum hydrophilen Teil, während die beiden Fettsäureketten hydrophob sind
[6] Hydrophob (Gegensatz: hydrophil): wasserabstoßend
[7] Fettsäuren: Langkettige Kohlenwasserstoffe mit einer Säuregruppe [–COOH] an einem ihrer Enden
[8] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt
[9] Enzym: Protein, das, an spezielle Moleküle angepasst, die Synthese katalysiert.
[10] Helix Holme: gemeint ist hier Die DNA ist aus zwei komplementären, leiterförmig angeordneten Strängen, deren Sprossen durch die gegenüberliegenden Basen A und T, bzw. G und C gebildet werden; diese Stränge sind selbst wiederum verdrillt
[11] Ribonucleasen (RNasen): zerschneiden RNA
[12] DNA (=DNS):DesoxyribonucleinicAcid, Desoxyribonukleinsäure, eine reduzierte Ribose; Baustein der Erbinformation
[13] Nucleotide: Desoxyribonucleosid- bzw. Ribonucleosidtriphosphate (ATP, TTP, CTP, GTP, UTP)
[14] Ribosom: Organell aus ribosomaler RNA und Proteinen. Es dient zur Translation der mRNA-Informationen in Proteine. Meist sind mehrere Ribosomen über die mRNA kettenartig verbunden, um zugleich mehrere Ablesevorgänge hintereinander ablaufen lassen zu können
[15] Ribosomale RNA (rRNA), verknäuelt sich unter Beteiligung von Proteinen zum Ablesegerät (Ribosom) der tRNAs, um Aminosäuren zu Proteinen zu verknüpfen
[16] 50S, 30S, 70S: Die Abkürzung S ist die Sedimentationskonstante beim Zentrifugieren von Teilchen. Je größer die Konstante, umso schwerer sind sie. Die bakteriellen Ribosomen, aus zwei ungleichgroßen Untereinheiten zusammengesetzt, sind mit 70S schwerer als die separierten Teile, mit den Größen 30S und 50S. Dass die Summe der beiden Untereinheiten 70 und nicht 80 ergibt, liegt an der größeren relativen Oberfläche der Einzelteile im Vergleich zur Doppelstruktur
[17] Transfer-RNAs (tRNAs): Übersetzen die Informationen der mRNA in die verschiedenen Aminosäuren
[18] Formyliertes Methionin: Das Methionin, eine Aminosäure, trägt, wenn formyliert, am Stickstoff noch einen Formylrest (–CHO), eine Aldehydgruppe
[19] Methionin: Schwefelhaltige Aminosäure
[20] Murein: Zellwand fast aller Bakterien, in der kettenförmig verbundene Zuckermoleküle, an denen Ammoniumgruppen (–NH2) hängen und diese wieder mit verschiedenen Molekülen verknüpft sind. Diese Ketten sind noch durch kurze Folgen von Aminosäuren verbunden und ergeben so einen sehr stabilen Sack um die Zelle
[21] Osmostress: Osmose ist die Diffusion eines Lösungsmittels (z. B. Wasser) durch eine für eine bestimmte Substanz nur in einer Richtung durchlässige Membran. Ziel der Diffusion des Wassers ist es, einen Konzentrationsausgleich zwischen den beiden durch die Membran getrennten Räume zu erreichen. Ist z. B. die Salzkonzentration innerhalb einer Zelle höher als außen, so wird so lange Wasser in die Zelle aufgenommen, bis es zu einem Konzentrationsausgleich kommt. Ist die Salzkonzentration innerhalb der Zelle niedriger, so wird Wasser nach außen entweichen. Als Folge würde sich im ersten Fall die Zelle ständig vergrößern, bis sie unter Umständen sogar platzt, im zweiten Fall würde sie kollabieren. Zumindest das Zerplatzen infolge des Osmosestresses kann durch eine widerstanderzeugende Zellwand verhindert werden.
[22] Glucose: Ringförmiger Zucker mit sechs [C]-Atomen [C6H12O6]; der Ring besteht aus fünf [C]-Atomen und einem Sauerstoffatom; das restliche [C]-Atom hängt als [–CH2OH]-Gruppe an einem dem Sauerstoff benachbarten [C]-Atom; vier [–OH]-Gruppen stehen an [C]-Atomen des Rings
[23] Amin: Derivat (= Abkömmling) des Ammoniaks [NH3], wobei ein, zwei oder drei Wasserstoffatome durch eine Kohlenstoffverbindung ersetzt sind, z. B [H3C-NH2]
[24] Seitengruppen (von Molekülen): An einer Hauptkette (oder Hauptring) eines Moleküls können verschiedene Seitengruppen (oft als funktionelle Gruppen), z. B. [–CH3], [–CH2OH], [–NH2], [–CHO] oder [–COOH] hängen
[25] Milchsäurerest: [CH3CHOHCO–]; Milchsäure: [CH3CHOHCOOH]
[26] Essigsäurerest: [CH3CO–]
[27] Peptide: Kurze Ketten aus (verschiedenen) Aminosäuren.
[28] Bionten: Allgemeine Bezeichnung für Lebewesen
[29] Gram-Färbung: Eine Methode, Bakterien anzufärben, die der dänische Arzt Hans Christian Gram entwickelt hatte, um Bakterien nach Farbreaktionen einzuteilen. Dabei werden die Bakterien zunächst mit Kristallviolett und Jod angefärbt und anschließend mit Ethanol ausgewaschen und nochmals mit Safranin oder Fuchsin gefärbt. Gram-positive Bakterien sind danach purpur gefärbt, Gram-negative pinkfarben.
[30] Lipidmembran: Lipide, bestehend aus einem mit drei Hydroxylgruppen [–OH] versehenen Glycerinmolekül, an dem zwei Fettsäuren und ein Cholin unter Wasserabspaltung angeknüpft sind, zeigen einen hydrophilen Kopf (Glycerin und Cholin) und den hydrophoben Fettsäureschwanz. Nach dem Motto Gleich zu Gleich gesellt sich gern, ordnen sich die hydrophilen Köpfe zum einen und die hydrophoben Schwänze zum anderen nebeneinander an und bilden eine geschlossene Schicht. Eine Doppelmembran entsteht dann, wenn sich zwei solcher Schichten, hydrophobe Schwänze zueinander gereckt, aneinanderlegen
[31] Streptomycin: Antibiotikum, das heute zum Bekämpfen von Bakterien verwendet wird
[32] Chloramphenicol: Antibiotikum, das heute zum Bekämpfen von Bakterien verwendet wird
Eingestellt am 6. April 2024
.

Murein (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer)
Schräg in der Mitte des Bildes zeigen parallele Stränge den Aufbau des Mureins aus regelmäßig über Sauerstoffbrücken (rot) verknüpften Zuckern, N-Acetyl-Glucosamin (moosgrün) und N-Acetyl-Muraminsäure (ocker). Kurze Peptide verbinden benachbarte Muraminsäuren in lockerer Folge. Peptide sind jeweils (ausgehend vom Zucker) aus L-Alanin (hellgrün), D-Glutaminsäure (dunkelgrün), Diaminopimelinsäure (blaugrün) und D-Alanin (hellgrün) aufgebaut. Der Sauerstoff im Zucker (rot) ermöglicht einen Einblick, an welche Kohlenstoffatome die Zucker und Peptide verknüpft sind. Die beteiligten Moleküle sind in Atomdarstellungen an den Seiten des Bildes detailliert gezeigt und mit den entsprechenden, oben erwähnten Farben hinterlegt: links oben das Peptid, rechts oben die einzelnen Aminosäuren, linke Mitte als einzelne Zucker, rechts unten verknüpft. Links unten ist ein verkleinerter Mureinausschnitt dargestellt, rechts fast mittig drei Mureinschichten übereinander. Freistehende Peptide deuten die Verknüpfung zwischen den einzelnen Schichten an. (Angelehnt an Slonczewski und Foster 2012, Abb. 3.17)
Eingestellt am 6. April 2024
.

Bacteria, Bakterien
2 Gemeinschaft
.
An Ufern des Wassers mit steinigem Abhang
Und felsigen Höhlen voll schmutzigen Abfalls
– Aus Resten landnah schwimmendlebender Zellen –
Schweben vielerlei licht- und nahrungsuchende Wesen.
.
Aus Schichten mit Schlick bewegen stinkende Gase
Zuvor noch glatte, ruhig liegende Flächen,
Verpesten die Luft mit schwefelwässrigem Stoff[1]:
Ungenutzte Ressourcen gehen perlend verloren.
.
In der faulenden Masse walten Heterotrophe[2],
Verwenden Proteine[3] abgestorbener Zellen.
Das Zuviel des Schwefels lassen achtlos sie liegen,
Doch gasperlender Schwefelwasserstoff wird Nahrung den andern.
.
In lichtexponierten, gasgekräuselten Wassersystemen
Orientieren sich schwebend grüne Schwefelbionten[4],
Um mit Licht Chlorophylls Porphyrinelektronen[5]
Zur Arbeit zu bringen, so Ladungslücken zu bilden.
.
Leerstellen warten wieder auf Füllung!
Entziehen H2S nun gleichfalls Elektronen[6],
Oxidieren es so zum Schwefelmolekül[7].
.
Versiegen Schwefelwasserstoffquellen,
Oxidieren fremde Bionten molekularen Schwefel,
Liefern Schwefeltetroxid[10] sulfatabhängigen Zellen,
Energiereserven zu bilden, Speicher zu füllen.
.
Abhängigkeiten unterschiedlichster Gruppen
In ersten ökologischen Nischen
Sind Stärke, nicht Schwäche, früher Evolution,
Denn Schwefelbionten leben recht gut in dieser Situation.
.
Vergesellschaftung unterschiedlich wirkenden Lebens
Bringt optimalen Wertschöpfungsgewinn:
Kein kostbares Gut geht ungenutzt seiner Wege,
Der Kreislauf der Stoffe nimmt Enden erneut zum Beginn.
.
Eine Gemeinschaft einander ergänzender Lebensstrategen
Gilt allen als vielversprechend, als Synergismus erzeugende Weise.
Doch Schlüssel und Zukunftshoffnung ist
Fotosynthetisch erzeugtes Kohlenhydrat.
.
Fußnoten
[1] Schwefelwasserstoff, H2S: [H-S-H], ein geknicktes Molekül mit mittigem Schwefel
[2] Heterotrophe: Darunter werden alle Organismen subsumiert, die für ihr Leben auf bereits vorhandene organische Substanzen angewiesen sind
[3] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt
[4] Grüne Schwefelbionten, Grüne Schwefelbakterien: sind einzellige, phototrophe, obligat anaerobe Bakterien mit verschiedenen äußeren Formen, ohne aktive Bewegung.
[5] Porphyrinelektronen: Elektronen des Porphyrinringsystems im Chlorophyll
[6]Elektronen: Negativ geladene Bestandteile von Atomen, die den positiv geladenen Atomkern umgeben. Sie sind an den Atomkern gebunden und bilden die sogenannte Elektronenhülle des Atoms
[7] Schwefelmolekül, [S2]: Elementarer Schwefel, der als Molekül aus zwei Atomen Schwefel besteht; (16S), besitzt sechzehn Protonen; 16 Neutronen kommen noch hinzu. (16S, Anzahl der Protonen = Ordnungszahl 16)
[8] Chlorophyll (Bakterienchlorophyll): „Bakteriengrün“, bestehend aus Porphyrinringsystem mit angehängter Kohlenstoffkette. Es unterscheidet sich vom „Blattgrün“ durch bestimmte Seitenmoleküle am Porphyrinringsystem
[9] Photonen: Lichtquanten, oder Lichtteilchen, aus denen Lichtstrahlung besteht
[10] Schwefeltetroxid (SO42-): Eine maximal oxidierte Schwefelverbindung mit vier Atomen Sauerstoff; liegt als zweifach negativ geladenes Ion vor
Eingestellt am 6. April 2024
.

Gemeinschaft macht stark (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer)
Eingestellt am 6. April 2024
.

Bacteria, Bakterien
3 Promiskuität
.
Ringförmig lagern verschlungen Chromosomen[1] im Zentrum.
Sich im Zentrum vereinend, trennt sie die Zelle in gleichgroße Räume,
Chromosomen in zufälligen Raten verteilend.
.
Zuletzt bricht die mitwachsende Zellwand mittig entzwei.
Die anfangs vereinten Zellen gehen bald eigene Wege,
Um allein sich zu nähren, sich erneut zu vergrößern
Und, wiederholt sich spaltend, ihre Zahl zu erhöhen.
.
Die Zeit für Wachstum, für Teilung und Trennung
Ist kurz bei günstiger Umwelt und guter Ernährung:
Kaum dreißig Minuten bis zum Verdoppeln; bei manchen genug,
In wenigen Tagen Massen zu bilden so riesig wie unser Planet.
.
Ungünstig noch die damalige Zeit, um zu leben.
Bakterien breiten sich aus, noch freie Bezirke zu finden,
Passen sich an als genügsame Wesen;
Ihr Wissen gespeichert in schraubigen Ringen der DNA.
.
Mehrfach verändert im Chromosom, treffen Bakterien nah oder fern ihrer Heimat
Fremde Gesellen mit gleichfalls mutiertem Genom,
Nehmen freie Fragmente bereitwillig in ihr eigenes Chromosom,
Bauen sie ein, verändern das Erbgut durch Transformation[4].
.
Andere wiederum bleiben gezielt
An der klebrigen Flanke des Nachbarn,
Schieben heraus, umgehend hinein
In den Partner den gestreckt nun liegenden Faden der DNA.
Etabliert sind auf schonende Weise
Die ersten noch zarten geschlechtlichen Reize,
Und wer sich auch zufällig trifft,
Nimmt gerne neu gestaltete Gene mit sich.
.
Vielleicht half Jeder Jedem zur damaligen Zeit,
Um so zu erhöhen den Wert genetischer Information
Für Modifizierung und Anpassung an neue,
Herausfordernde Nischen der Evolution.
.
Transfer von Genen von Nachbar zu Nachbar
Wird bald schon zum Motor der Evolution.
Auch noch Milliarden Jahre danach
Spricht man von horizontalem Transfer genetischer Information[5].
.
Fußnoten
[1] Chromosom: Genetische Informationseinheit aus unterschiedlichen Mengen DNA diverser Basensequenzen; Bei Bakterien sind die DNA-Helices zu Ringen geschlossen
[2] Cytoplasma: Flüssiger Zellinhalt mit darin liegendem Cytoskelett
[3] Lipiddoppelmembran: Lipide, bestehend aus einem mit drei Hydroxylgruppen [–OH] versehenen Glycerinmolekül, an dem zwei Fettsäuren und ein Cholin unter Wasserabspaltung angeknüpft sind, zeigen einen hydrophilen Kopf (Glycerin und Cholin) und den hydrophoben Fettsäureschwanz. Nach dem Motto Gleich zu Gleich gesellt sich gern, ordnen sich die hydrophilen Köpfe zum einen und die hydrophoben Schwänze zum anderen nebeneinander an und bilden eine geschlossene Schicht. Eine Doppelmembran entsteht dann, wenn sich zwei solcher Schichten, hydrophobe Schwänze zueinander gereckt, aneinanderlegen
[4] Transformation: Direkte Aufnahme von DNA durch andere Organismen.
[5] Horizontaler Gentransfer: Im Gegensatz zum vertikalen Gentransfer (von einer Generation zur anderen) wird beim horizontalen Gentransfer genetisches Material, DNA-Bruchstücke, auf andere Individuen, andere Arten oder sogar auf andere Organismengruppen übertragen. Dies kann direkt erfolgen (Transformation) oder mit Fremdhilfe
Eingestellt am 6. April 2024
.
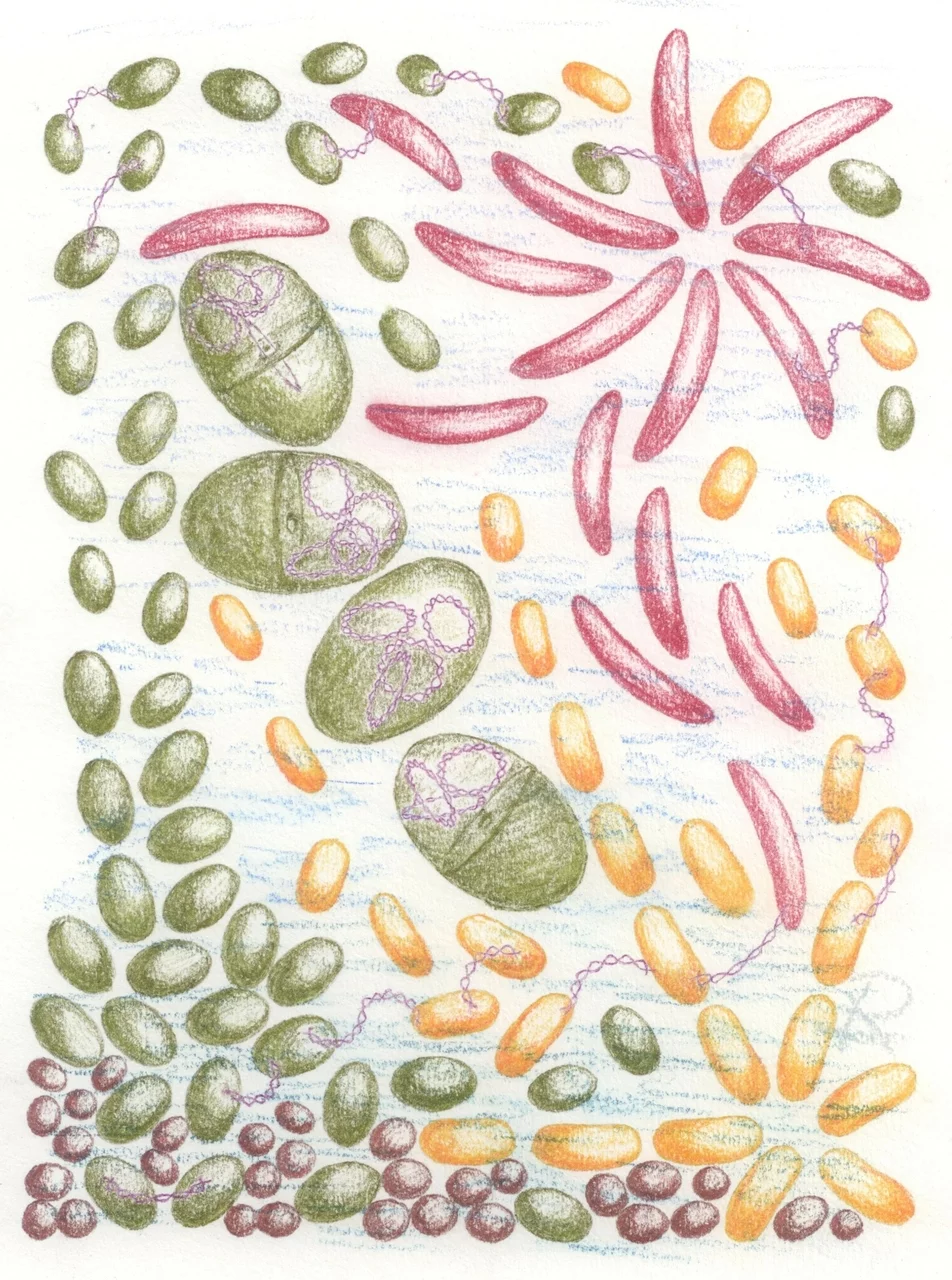
Jede mit Jeder (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer)
Diversität von Bakterien, vermittelt durch unterschiedliche Größen, Formen und Farben (Einzelzellen der Bakterien sind grundsätzlich farblos, in dichten Kolonien können sie aber Farben zeigen). Violett werden DNA-Helices gezeigt, die von Zelle zu Zelle reichen; doch bei so großen Abständen zwischen Spender und Empfänger würde in der Natur die Transformation nicht gelingen. Zwischen gleichen und ungleichen Zellen wird ein DNA-Transfer angedeutet. Die stark vergrößerten grün dargestellten Zellen zeigen ringförmige DNA und deren mögliche ungleichmäßige Verteilung im Zuge der Tochterzellbildung.
Eingestellt am 6. April 2024
.

Bacteria, Bakterien
4 Auf zu neuen Ufern
.
Viele Bionten[1] kleben an Ort und Stelle ausdauernd fest,
Doch Hunger treibt sie nach Nahrung, Freiheit und Licht.
Unglaublicher Vorteil, geläng‘ ein Absondern,
Um der Nachbarn Konkurrenz zu entflieh‘n!
.
Zwei Wege, raffiniert der eine, wie der andere,
Gingen allmählich sie Schritt für Schritt,
Dicht schon besetzten Raum zu vermeiden:
Eilen schraubend, andere treibend, neuen Quellen entgegen.
.
Fußnote
[1] Bionten: Allgemeine Bezeichnung für Lebewesen
Eingestellt am 6. April 2024
.
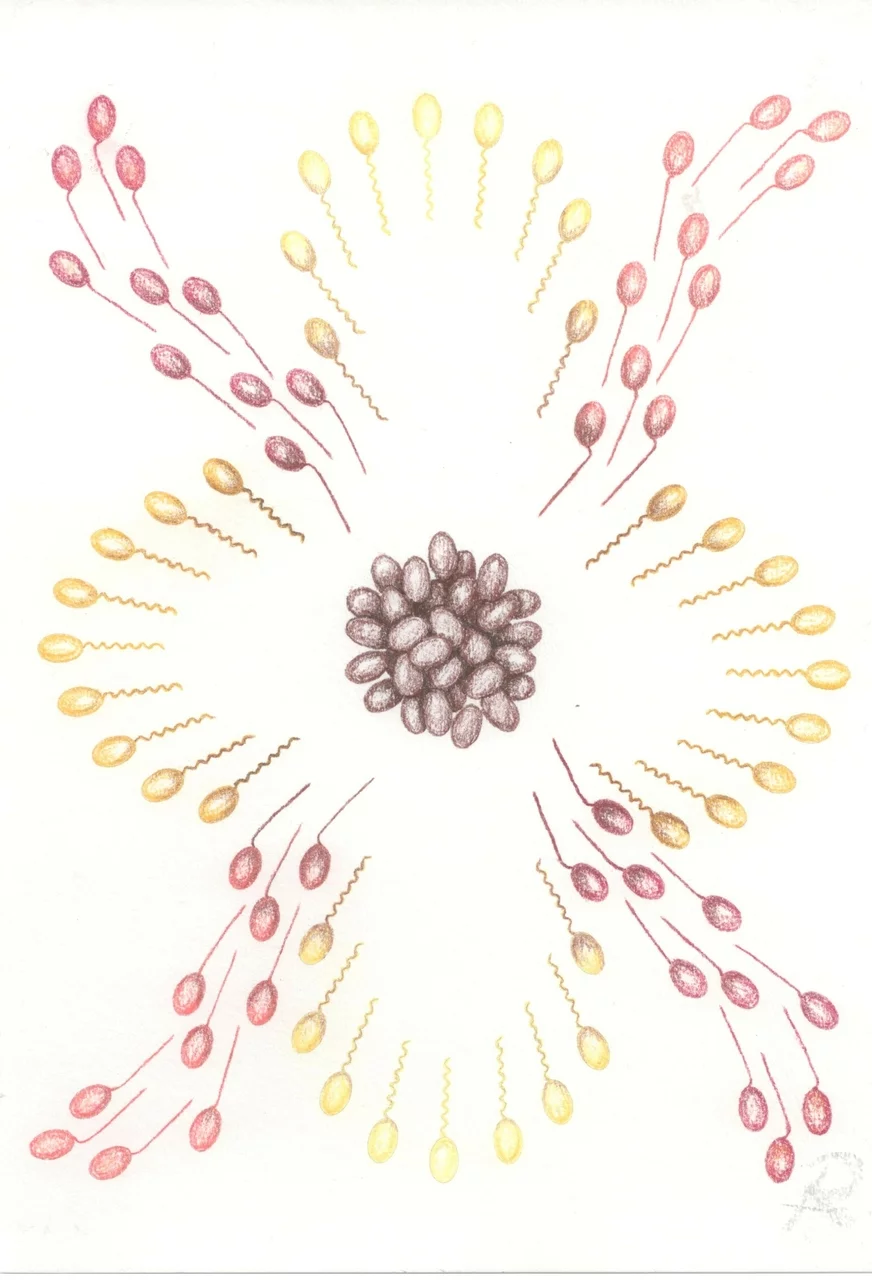
Freiheit! (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer)
Fort streben sie alle, wer ein Flagellum besitzt
Eingestellt am 6. April 2024
.

Bacteria, Bakterien
5 Mit aller Kraft voraus
.
Der Bakterien äußere Doppelmembran[1]
Gilt als abwechslungsreiche Hülle.
Proteinkomplexe[2], Miniporen eng umgebend, kontrollieren hochspezifisch
Molekültransporte zwischen Außen- und dem Innenraum.
.
Unersetzlich sind Protonenpumpen[3]:
Liefern, ATP[4]-verbrauchend, permanent H+ zum [5] zum Nachbarraum,
Häufen dadurch positive Ladung[6] außen,
Folglich negative innen an.
.
Diesem Gradienten folgend, wandern positiv gelad‘ne Ionen in das Innere der Zelle
Versorgen damit es mit ladungspositiven Elementen:
Ladungsfreie Moleküle wählen, in der Zelle Zentrum zu gelangen, rückkehrwillige Protonen.
.
Über viele Hunderte von Pforten wachen diese Proteine.
Aus- und Eingang sind geregelt.
Zucker, Säuren und Peptide[10],
Stehen auf der Zelle Aus- und Eintauschliste an.
.
ATP, zentral in diesem Tauschverkehr, nutzt ATPase[11], sein Enzym.
Stockwerkartig hochgetürmt, kontrolliert ein ausgesuchter Satz Peptide,
Die Kanäle[12] fest umgebend, ATPs Bindungsenergie verwendend,
Mengen, auch Transport sich selbst genügender Protonen.
.
Mittig zum Kanal gebracht,
Rasch in trommelrevolvergleiche Fächer aus Peptid gedrängt,
Wird, den Ring des Rades kurz um einen Klick gedreht,
Das Ion schon ausgeliefert, andernseitig abgesetzt. –
.
Des Enzymes Rad dient nun als Modell,
Den motorengleichen Antrieb der Bakterien zu versteh‘n,
Der rotierend bringt Bionten[13] rasch voran,
Um Neuland zu erkunden, Gefahren zu entgeh’n:
.
Ein Transportvehikel dieser Art
War vielleicht die Basis der Motoren:
Klickend dreh‘n sich Ringe, eingespannt in Wand und die Membran,
Flagellin[14] hinauszubringen, der Bionten Geißelprotein.
.
Gramnegative[15], sowie Grampositive
Agieren oft mit ATP-getriebenen Motoren,
Um Flagellen wie Propeller zu bewegen.
Unterschiedlich aber sind die Antriebspeitschen in der Wand vertäut.
Vier der Ringe leisten sich Gramnegative:
Zwei der Ringe eingefügt der inneren Membran[16],
Grampositive brauchen allerdings nur zwei.
.
Ungezählte Moleküle Flagellin,
Stück für Stück nach außen durch die Ringe transportiert,
Lagern sich zur hohlen Röhre
– Bis zum Schluss als Schlauch benutzt –
Eng am fernsten Ende dicht zusammen,
Um das hohle Multiprotein,
Nun der Zelle angehängt,
Als Paddel[19] zu schwingen im Kreis.
.
Gestreckt noch steh‘n die Geißeln von den Zellen.
Ein Haken wird der Basis aber schon geformt,
Gibt der Peitsche[20] einen schrägen Winkel.
Nun in Gang noch den Motor gesetzt, treiben sie die Zellen schnell voran.
Kraftvoll sind Bionten selbstbeweglich,
Noch fehlt die Steuerung jedoch für zielgenaues Orientier‘n. –
.
Vehement bestreiten gegenwärtig Designisten[21]
Eine Schritt für Schritt Entwicklung ihres Triebs,
Betrachten es als Fertigteil des Schöpfers,
Nicht als Resultat der gottgewollten Evolution.
.
Fußnoten
[1] Zellumgebende Lipiddoppelmembran: Gramnegative Bakterien umgibt nur ein dünne Mureinschicht, die aber nach außen hin noch von einer Lipiddoppelmembran, mit Einschlüssen, umhüllt ist.
[2] Proteinkomplexe: Proteine sind häufig zu Komplexen vereint, wobei sich die einzelnen Proteine sich oft in Bau, Eigenschaften und Funktion unterscheiden
[3] Protonenpumpen: Transmembranproteine, die die positiv geladenen Protonen gegen einen elektrochemischen Gradienten transportieren
[4] ATP: Adenosin-tri-phosphat; bestehend aus Ribose und Adenin; Ribose trägt an seiner nicht in den Zuckerring einbezogenen Kohlenstoffgruppe drei hintereinander liegende Phosphatgruppen. Diese lineare Anordnung der Phosphate hat zur Folge, dass das dritte, äußerste Phosphat, mit seiner ihm dadurch innewohnenden Energie, diese leicht unter Abspaltung auf andere Moleküle übertragen kann
[5] Protonen: das positiv geladene (elektronennackte) Wasserstoffatom
[6] Positive Ladung: Fehlt einem Atom, einem Molekül, ein Elektron (oder mehr) so ist die positive Ladung der Protonen des betreffenden Atoms nicht ausgeglichen; das Atom, das Molekül, erscheint deswegen positiv geladen
[7] Calcium: als Ion doppelt positiv geladen, Ca++
[8] Magnesium: als Ion doppelt positiv geladen, Mg++
[9] Kalium: als Ion einfach positiv geladen, K+
[10] Peptide: Kurze Ketten aus (verschiedenen) Aminosäuren.
[11] ATPase: Enzym, das ATP unter Energieweitergabe in ADP und P spaltet; die Endung -ase kennzeichnet ein Protein als Enzym
[12] Kanäle, Membrankanäle: in den Lipiddoppelmembranen werden von bestimmten Proteinen feinen Kanäle gebildet, durch die verschiedene Substanzen transportiert werden können
[13] Bionten: Allgemeine Bezeichnung für Lebewesen
[14 Flagellin: Globuläres Protein, das sich zu vielen selbst zu einem Hohlzylinder anordnet und im westlichen das Flagellum der Prokaryoten (Bakterien und Archäen) bildet
[15] Gram-Färbung: Eine Methode, Bakterien anzufärben, die der dänische Arzt Hans Christian Gram entwickelt hatte, um Bakterien nach Farbreaktionen einzuteilen. Dabei werden die Bakterien zunächst mit Kristallviolett und Jod angefärbt und anschließend mit Ethanol ausgewaschen und nochmals mit Safranin oder Fuchsin gefärbt. Gram-positive Bakterien sind danach purpur gefärbt, Gram-negative pinkfarben.
[16] Innere Lipiddoppelmembran: Lipiddoppelmembran, die jedes Organismus‘ Zellinneres umgibt; im Gegensatz zur zellumgebenden Lipiddoppelmembran Gramnegativer Bakterien
[17] Murein: Zellwand fast aller Bakterien, in der kettenförmig verbundene Zuckermoleküle, an denen Ammoniumgruppen (–NH2) hängen und diese wieder mit verschiedenen Molekülen verknüpft sind. Diese Ketten sind noch durch kurze Folgen von Aminosäuren verbunden und ergeben so einen sehr stabilen Sack um die Zelle
[18] Zellumgebende Lipiddoppelmembran
[19] Flagellum, Geißel (Bakteriengeißel): Aus vielen globulären Flagellinproteinen zusammengesetzte Hohlröhre
[20] Flagellum, Geißel (Bakteriengeißel)
[21] Designisten („Intelligent Design“): Designisten glauben, Gott hätte einen Grundbauplan erschaffen, zum Beispiel den Typ Vogel, der sich dann weiterdifferenziert und -entwickelt hätte
Eingestellt am 6. April 2024
.

Modell einer ATPase getriebenen Protonenpumpe (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer)
Dargestellt ist eine pflanzliche Protonenpumpe. Der etagierte Aufbau aus verschiedenen Proteinen ist deutlich zu erkennen, auch das trommelrevolverartige Rad (grün), aus dem die Protonen entlassen werden. Die ATP-Hydrolyse findet unter Zusammenwirken der zwei Mal drei Köpfchen statt, wodurch das zentrale Stielchen (hellgrün) durch Konformationsänderung seines Proteins, das Rad drehen wird und so das Proton transportiert. – Nach Lüttge U, Kluge M (2012) Botanik. Die einführende Biologie der Pflanzen. 6. Auflage. WILEY-VCH, S. 52.
Eingestellt am 6. April 2024
.
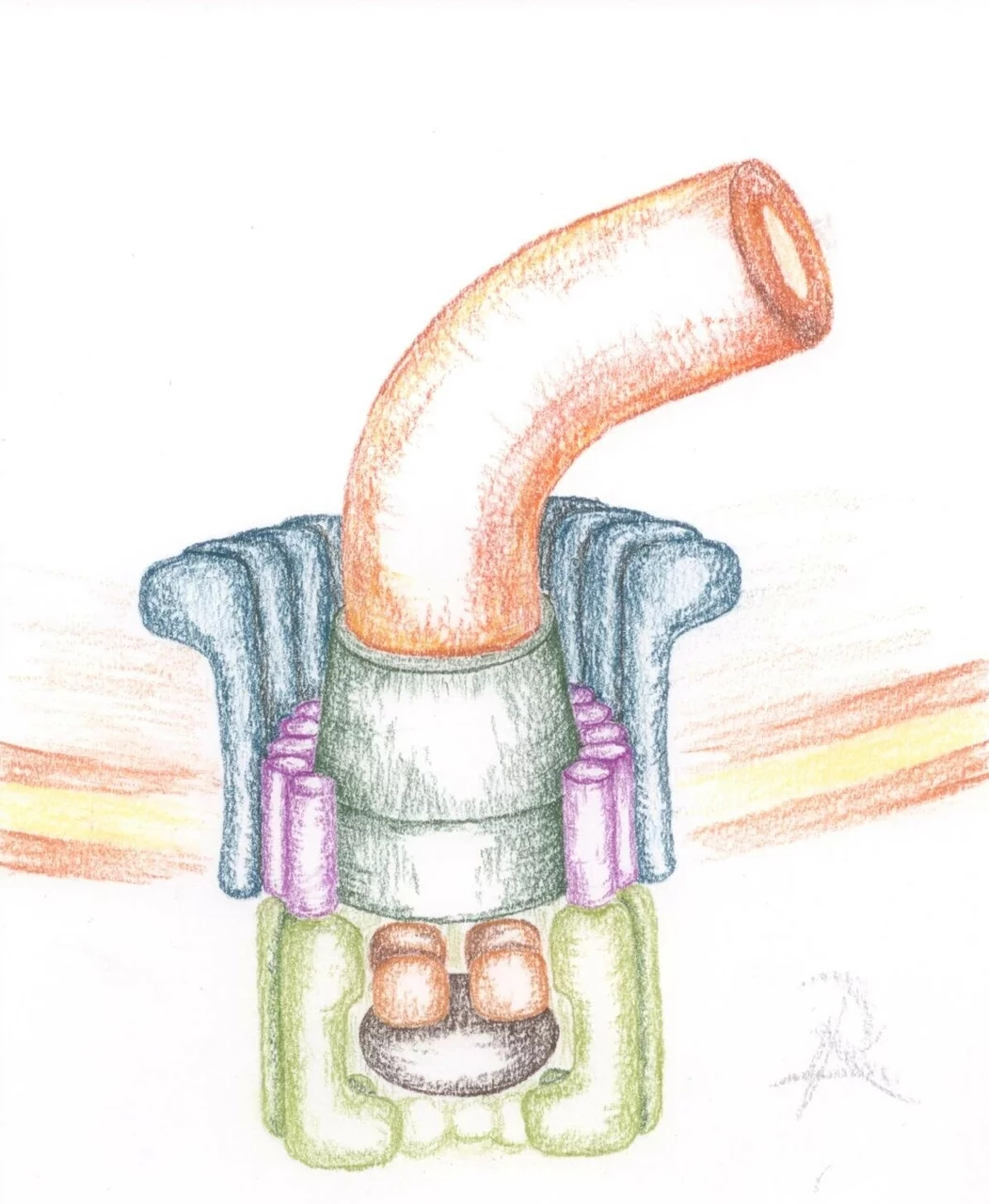
Motor der bakteriellen Flagellen (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer)
Der untere, in Hellgrün gehaltene Ring liegt cytoplasmaseitig, während der darüberliegende Ring mit seiner Basis (die violetten Zylinder deuten dies an) in der inneren Doppellipidmembran fixiert ist. Zwei Rotorenräder sind dabei beteiligt: Die violetten Zylinder für den Antrieb, die den etagierten Ring der Flagellenbasis (mittelgrün) umgeben und die ebenfalls kranzförmig angeordneten dunkelgrünen, hakenförmigen Proteine, die den Motorenkomplex in der Membran verankern. Der zentrale Schaft ist fest mit dem bewegungsaktiven Rotor (violette Zylinder) verbunden; so wird der zentrale Schaft durch die Motorproteine über ATPasen angetrieben. „Die beiden in der Membran verankerten Ringe (dunkelgrün, violett) bilden Ionenkanäle, durch die Protonen fließen, die Energie für die Drehung erzeugen. Im Flagellenmotor wird so die elektrochemische Energie des transmembranen Gradienten in mechanische Energie umgewandelt. Nach dem gleichen Prinzip funktionieren bakterielle ATP-Synthasen, die ebenfalls einen Ionengradienten zur Erzeugung eines Drehmomentes nutzen.“ – Nach Munk K, ed. (2008) Mikrobiologie. Thieme, S. 46. Schema der Flagellenbasis eines Gramnegativen Bakteriums, abgewandelt für ein Grampositives Bakterium, das nur die beiden unteren in der inneren Doppellipidmembran liegenden Ringe (Motorringe) besitzt.
Eingestellt am 6. April 2024
.

Bacteria, Bakterien
6 Zum Innehalten
.
Unseres Planeten Leben, vielfältig und artenmächtig,
Ändert sukzessiv in kleinen Schritten sich:
Durch Menschenhand, des Züchters ausgeklügelte Methoden,
Auch durch Druck und Konkurrenz, des Nachbarn Dasein zu bedrängen.
.
Wie veränderlich so manche Art, zeigt uns der bekannte Kohl[1]:
Des Grünkohls[9] angepasste Brüder
Sahen noch vor Hunderten von Jahren Blatt für Blatt sich gleich.
.
Manchen reichen tausend Jahre, oft nur Hunderte davon,
Um der Formen Vielfalt zu kreieren.
.
Mitentscheidend wirkt der Sippen Lebenslänge:
Ein Jahr bei Kohl, Tomaten, Weizen und Karnickeln[16];
Zwei Jahre gut bei Katzen, Hühnern, Hunden, Pferden.
Doch bei winzigen Bakterien ist sie kaum die Hälfte einer Stunde.
.
Der Generationen Zahl entscheidet aber
Wie schnell sich manche Eigenschaften ändern.
Dazu kommt noch der Umwelt wechselvolle Wirkung und
Der neuen oftmals harschen Siedlungsräume Härte.
.
Schnelle Folge, rasch veränderliche Gene,
Helfen nur den Fittesten fürs Überleben,
Doch mit der Umwelt angepassten Fähigkeiten
Können sie dem Druck der Konkurrenten hoffnungsvoll begegnen.
.
Eine Milliarde Jahre und noch mehr,
Zehntausend Milliarden Generationen
Waren den Bakterien gegeben,
Neue Wesenszüge zu entwickeln! –
.
Zeit war wohl genug, den effektiven Antrieb zu bekommen,
Pumpenmoleküle[17] umzufunktionieren und als Rotorblätter zu verwenden,
Denn manches Protein der Geißelbasis
Wirkte früher für Protonen- und Magnesiums Transport.
.
Fußnoten
[1] Kohl: Brassica oleracea (Brassicaceae – Brassicales – Malvanae – Rosidae – Superrosidae – …)
[2] Blumenkohl, Karviol: Brassica oleracea var. botrytis
[3] Kohlrabi: Brassica oleracea var. gongylodes
[4] Wirsing: Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda
[5] Blaukraut, Rotkohl: Brassica oleracea convar. capitata var. rubra
[6] Weißkraut, Weißkohl: Brassica oleracea convar. capitata var. alba
[7] Rosenkohl: Brassica oleracea var. gemmifera
[8] Brokkoli: Brassica oleracea var. italica
[9] Grünkohl: Brassica oleracea var. sabellica
[10] Hauspferd: Equus caballus (Hippomorpha – Mesaxonia – Ungulata – Übrige Laurasiatheria – Laurasiatheria – …)
[11] Haushund: Canis lupus familiaris (Cynoidea – Caniformia – Carnivora s.s. – Carnivora s.l. – Euarchonta – …)
[12] Hauskatze: Felis catus (Felis-Gruppe – Feloidea – Feliformia – Carnivora s.s. – Carnivora s.l. – …)
[13] Haushuhn: Gallus gallus domesticus (Gallini – Phasianinae – Phasianidae – Galliformes – Galloanseres – …)
[14] Saatweizen: Triticum sativum (Triticeae – Poideae – BOP-Verwandtschaft – Poaceae – Poineae – …)
[15] Tomaten: Solanum lycopersicum (Solanaceae – Solanales – Lamianae – Asteridae – Superasteridae – …)
[16] Karnickel, Hauskaninchen: Oryctolagus cuniculus forma domestica (Leporidae – Lagomorpha – Glires – Euarchontoglires – Boreoeutheria – …)
[17] Pumpenmoleküle: Transmembranproteine, die positiv geladene Ionen gegen einen elektrochemischen Gradienten transportieren
Eingestellt am 6. April 2024
.

Des Kohls vielfältiges Gesicht (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer)
Verschiedene Teile der Kohlwildform (Brassica oleracea, rechts oben hinten) wurden durch Züchtung verändert. Blaukraut, Rotkohl: Blätter dichtest zum Kopf geschichtet und blau/rot durch Anthocyane gefärbt (unten Mitte); Kohlrabi: basale Sprossteile zur Knolle umgebildet (in einer blauen Form links des Blaukrauts, in grüner Form darüber); Rosenkohl: seitliche Triebe der Blattachseln wurden zu dichtgeschichteten kleinen Köpfchen (schräg von rechts unten nach links oben); Blumenkohl, Karviol: eine gestauchte, dicht veräselte, steril gebliebene Sprossachse wird von großen basalen Blättern umgeben (rechts neben Rosenkohl).
Eingestellt am 6. April 2024
.

Bacteria, Bakterien
7 Der Streit
.
An der Bakterien Motor kam die Kontroverse erst in Fahrt!
Würde nur ein winzigst Teilchen fehlen
Wäre er bewegungslos und ohne Triebfunktion.
.
Der Motor sei deshalb von Anfang an
Von dir als Ganzes konstruiert und auch erschaffen:
Ihr Argument für deine Schöpfungsmacht
Und zugleich Negation von dir gewollter Evolution.
.
Manche der Bakterien verzichten wieder auf Flagellen[3],
Die Motoren jedoch bleiben integriert
Unbeweglich sind sie nun, wozu dann der Motor?
.
Sind sie nun vielleicht Verbindungen zur Außenwelt:
Den neu geöffneten Kanal
Für Schnelltransport und für Kontrolle sinnvoll nutzend?
.
O Gott, dein eigentliches Ziel war sicher nicht
Der endlos Zahl Bakterien Beweglichkeit.
Viel Größ‘res sollte deine Schöpfung noch zu Wege bringen!
Deine Ebenbilder und der Kreaturen Wunsch, dich als Schöpfer zu erkennen.
.
Wer also denkt und glaubt,
Gott würde auf dem Weg zum eigentlichen Ziele
Auf dem Nebenpfad zum Streit uns etwas konstruieren,
Der kennt vielleicht am Ende Gottes Größe nicht.
.
Und doch durchdringt sein Geist
Neutrinogleich all das, was damals schon entstand.
Bloß anders als Neutrinos[8], verweilt er zeitgleich überall,
Um Kraft und Zukunft auch dem Kleinsten schon zu geben.
.
Fußnoten
[1] Designisten („Intelligent Design“): Designisten glauben, Gott hätte einen Grundbauplan erschaffen, zum Beispiel den Typ Vogel, der sich dann weiterdifferenziert und -entwickelt hätte
[2] Nichtreduzierbare Komplexitat: Designisten (und Kreationisten) nehmen gerne für ihre Ansichten äußert komplexe Organe dafür als Beispiel, deren Funktion vollkommen zusammenbräche, würde nur ein entscheidender Baustein fehlen. Sie vergessen dabei jedoch, dass der komplexe Bau nach und nach erst entstanden ist und auch funktionell sich weiterentwickelt hat. Nur wer davon ausgeht, alles wäre schon so seit jeher existent, kann daher von einer nichtreduzierbaren Komplexität sprechen, weil, nicht verwunderlich, die Funktion beeinträchtigt wird oder gänzlich ausfällt, wenn ein entscheidendes Teil fehlt. So wie ein Auto nicht fährt, fehlen z. B. Räder. Der Bakterien Flagellen und das menschliche Auge dienen meist der Argumentation.
[3] Flagellum, Geißel (Bakteriengeißel): Aus vielen globulären Flagellinproteinen zusammengesetzte Hohlröhre
[4] Mureinsacculus: Der Bakterien Murein umgibt die Zelle sackähnlich durch der Zellwand widerstandsfähige, massive Konstruktion
[5] Lipidmembran: Lipide, bestehend aus einem mit drei Hydroxylgruppen [–OH] versehenen Glycerinmolekül, an dem zwei Fettsäuren und ein Cholin unter Wasserabspaltung angeknüpft sind, zeigen einen hydrophilen Kopf (Glycerin und Cholin) und den hydrophoben Fettsäureschwanz. Nach dem Motto Gleich zu Gleich gesellt sich gern, ordnen sich die hydrophilen Köpfe zum einen und die hydrophoben Schwänze zum anderen nebeneinander an und bilden eine geschlossene Schicht. Eine Doppelmembran entsteht dann, wenn sich zwei solcher Schichten, hydrophobe Schwänze zueinander gereckt, aneinanderlegen; Grampositive Bakterien besitzen dabei nur eine innere Membran, Gramnegative noch eine zusätzliche außen um den Mureinsacculus herum; in entsprechender Weise sind Ihre Geißelbasen gebaut; doppelringig bei Grampositiven; vierringig bei Gramnegativen.
[6] Protonen: Bausteine der Atomkerne; die positiv geladenen Protonen sind mit neutralen Neutronen assoziiert; oft auch nur verstanden als das positiv geladene (elektronennackte, einzige Proton) des Wasserstoffatoms
[7] Flagellin: Globuläres Protein, das sich zu vielen selbst zu einem Hohlzylinder anordnet und im westlichen das Flagellum der Prokaryoten (Bakterien und Archäen) bildet
[8] Neutrinos: Gehören zu den Leptonen, sind elektrisch ungeladen und in den Nachweisgrenzen masselos; sie zeigen keine Wechselwirkung mit Atomen
Eingestellt am 6. April 2024
.
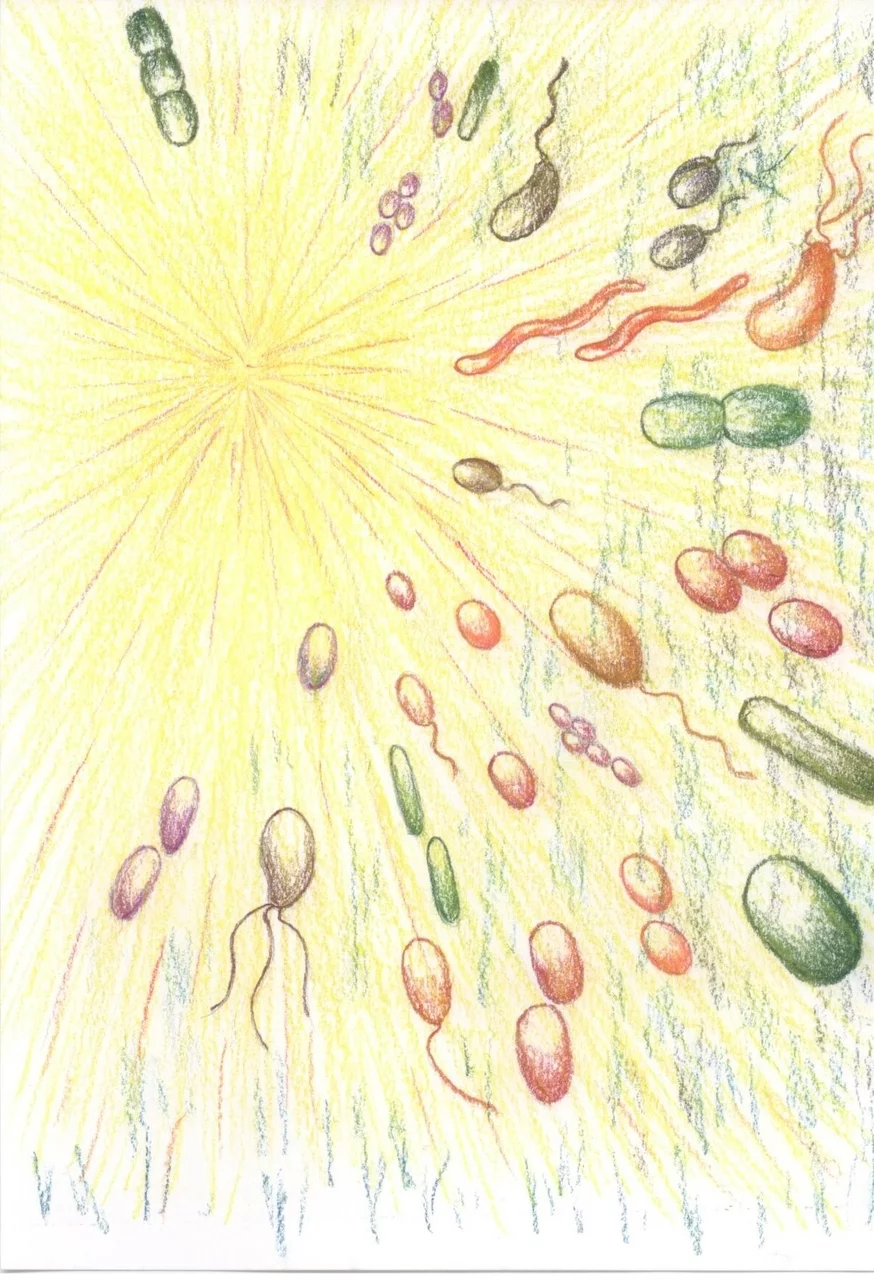
Bakterienexplosion (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer)
Eingestellt am 6. April 2024
.
